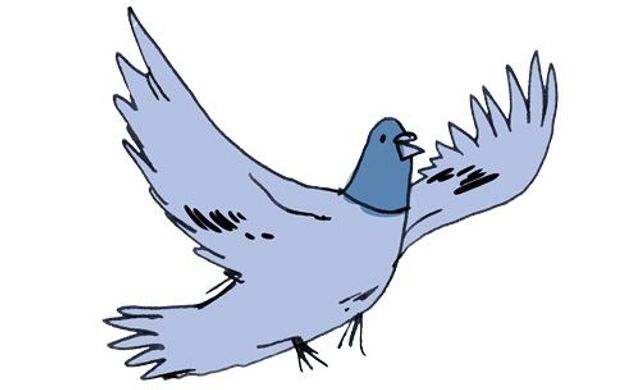Mitte Januar bekam Gudrun Stürmer wieder 13 Opfer dieses dreckigen Krieges angeliefert: Blasrohrpfeile in Bauch, Rücken, Kiefer und Schädeldecke, offensichtlich hatte der Schütze aus nächster Nähe gefeuert. Einer der Verletzten war nicht mehr zu retten, bei den anderen konnte der Arzt die Pfeile entfernen und mit Antibiotika verhindern, dass sich die Wunden entzündeten. Zwei Wochen später befinden sich noch drei der attackierten Tauben in Stürmers Obhut, sie sind geschwächt und fressen kaum. Die Rentnerin ist immer noch fassungslos, obwohl sie schon viel gesehen hat: Tauben mit Imbissgabel im Rücken, Tauben mit Büroklammern im Auge, Tauben ohne Skalp. Warum der Hass? »Wenn man den Leuten diese Frage stellt, heißt es meist nur: Die scheißen alles voll. Schon bizarr, da wird ein Tier wegen seines Stoffwechsels dämonisiert.«
Die Rentnerin betreut mit ihrem Mann und einigen Helfern im Südosten Frankfurts etwa 500 Tauben, verteilt auf zwölf Käfige. Sie sind ihr zugeflogen, verirrte Brieftauben, oder wurden von aufmerksamen Menschen vorbeigebracht. Manche hat Stürmer selbst auf der Straße aufgelesen, über eine Hotline kann sie jeder anrufen, der ein verletztes Tier in der Umgebung findet. Von 2500 Tieren, die Jahr für Jahr bei ihr landen, ist die Hälfte so übel zugerichtet oder ausgezehrt, dass sie der Tierarzt einschläfern muss.
Gudrun Stürmer ist eigentlich Katzenliebhaberin, aber vor gut zwanzig Jahren hatte sie ein Schlüsselerlebnis: Während eines Spaziergangs entdeckte sie eine Taube, die auf der Straße kauerte, ihr Flügel blutete. Sie brachte den Vogel zum Tierarzt, der den Flügel schiente. Nach drei Wochen war die Verletzung geheilt, aber fliegen konnte der Vogel nicht. Wohin mit ihm? Über Wochen irrte Stürmer von einem Tierheim zum nächsten, niemand wollte den Vogel. Schließlich fand sich doch ein Taubenfreund, aber der Gedanke ging ihr nicht mehr aus dem Kopf: Was fehlte in der Stadt, war eine Zuflucht für die Opfer des Straßenkampfes, ein Sanatorium für Tauben. 2006 setzte sie den Plan in die Wirklichkeit um. Sie hat lange genug in einer Werbeagentur gearbeitet, um zu wissen, dass es prestigeträchtiger wäre, für Pandabären in China oder Sattelrobben in Kanada zu kämpfen. Selbst Tierschützer belächeln ihr Engagement, die meisten Stadtbewohner sehen die Vögel ohnehin als Ungeziefer, das es mit allen Mitteln auszurotten gilt.
Der Taubenhass ist keineswegs nur ein deutsches Phänomen. Weltweit nehmen Städte die Befindlichkeiten ihrer Bürger zum Anlass, generalstabsmäßig gegen den Vogel vorzugehen: London, Peking und Santiago de Chile haben den Krieg gegen die Taube ausgerufen. In Barcelona werden die Tiere mit Netzen gefangen und getötet, in Montevideo wurden Wanderfalken angesiedelt, um die Tauben zu jagen, in Los Angeles wurde versucht, die Gebärfreude der Weibchen mit Kontrazeptiva zu stoppen. »Alles aussichtslos«, sagt Daniel Haag-Wackernagel, ein Biologe an der Universität Basel, der den Problemvogel seit dreißig Jahren erforscht: »Der Krieg gegen die Taube ist nicht zu gewinnen.«
DER FEIND
Über Jahrtausende betrachtete der Mensch Tauben als enge Verbündete. Die Ägypter nutzten sie, um Nachrichten zu versenden, ebenso der Kaiser von China, Feldherren wie Hannibal, Julius Cäsar und Dschingis Khan. Eine Taube überbrachte die Botschaft von der Niederlage Napoleons in Waterloo. Fast eine Million Tauben wurden in den beiden Weltkriegen eingesetzt und retteten das Leben von Tausenden Soldaten, indem sie wichtige Botschaften zu Kommandostützpunkten überbrachten. Auch beim Feldzug gegen Saddam Hussein begleiteten Tauben US-Soldaten, als lebendige Frühwarnsysteme für Giftgasangriffe.
Tauben sind heimattreue Tiere mit einem erstaunlichen Orientierungsvermögen. Selbst wenn sie Hunderte Kilometer von zu Hause entfernt ausgesetzt werden, suchen und finden sie so gut wie immer wieder ihren Weg zurück, was natürlich auch dem Ego des Besitzers schmeichelt. Sie fliegen mit Tempo hundert und schneller, über Stunden, ohne Pause oder Zwischenmahlzeit – die idealen Boten. Einige Wirtschaftsunternehmen verdanken Tauben ihren Aufstieg: Die Nachrichtenagentur Reuters etwa nutzte in ihren Anfangsjahren die Vögel, um Nachrichten und Börsenkurse zwischen Brüssel und Aachen auszutauschen. Weil es auf der Strecke noch keine elektronischen Übertragungswege gab, wurden die für Geschäftsleute und Spekulanten so wertvollen Informationen zuvor per Bahn transportiert. Die Tauben beschleunigten den Nach-richtenfluss um mehrere Stunden.
Die Tiere verfügen über außerordentliche visuelle Fähigkeiten, das Sehzentrum nimmt im Gehirn der Taube überdurchschnittlich viel Platz ein. Es gab Versuche, auch dieses Talent kommerziell zu nutzen, Tauben wurden zum Beispiel probeweise zur Qualitätskontrolle bei der Herstellung von Tabletten eingesetzt. Die Tiere saßen hinter einer Glasscheibe und sollten bei jeder Pille, die ihnen als makellos erschien, mit dem Schnabel auf einen Sensor picken. Bei deformierten, falsch eingefärbten oder sonst wie von der Norm abweichenden Exemplaren sollten sie nicht reagieren. Nach einer Woche Training entschieden die Vögel zu 99 Prozent richtig. In einem ähnlich gelagerten Experiment nahm die US-Küstenwache Tauben auf Hubschrauberflügen mit, um im Meer nach Überlebenden von Schiffsunglücken zu spähen. Wieder erledigten sie ihre Aufgabe zuverlässiger als der Mensch. Doch letztlich überwogen die Bedenken, den Vögeln so viel Verantwortung zu übertragen.
Wie kein anderes Tier hat der Mensch die Taube mit Symbolkraft überfrachtet. Weil sie das ganze Jahr über Eier legt, steht sie für Fruchtbarkeit, ebenso für die wahre Liebe. »Haben sich Männchen und Weibchen einmal gepaart, bleiben sie ein Leben lang zusammen«, notierte 1955 der Schriftsteller John Updike, der damals noch als Journalist arbeitete. Was allerdings nur die halbe Wahrheit ist: Das Taubenmännchen lässt kaum eine Gelegenheit zum Seitensprung aus, weshalb der Vogel auch als Sinnbild der Lasterhaftigkeit gilt. Die Friedensbewegung malte das Tier, das keine nennenswerten Waffen zur Selbstverteidigung besitzt, auf ihre Transparente. Und natürlich spielt die Taube im Christentum eine zentrale Rolle, nicht nur als Verkörperung des Heiligen Geists: Nach der großen Sintflut waren es Tauben, die Noah von seiner Arche losschickte, um nach Land zu spähen. Ein modernes Familienbild hat der Vogel überdies, das Ausbrüten und Füttern des Nachwuchses übernehmen Männchen und Weibchen zu gleichen Teilen.
Wie konnte ein Tier, das so lange mit dem Menschen zusammenlebt und von ihm verehrt wurde, bei den Städtern so in Ungnade fallen?
Die Propaganda?
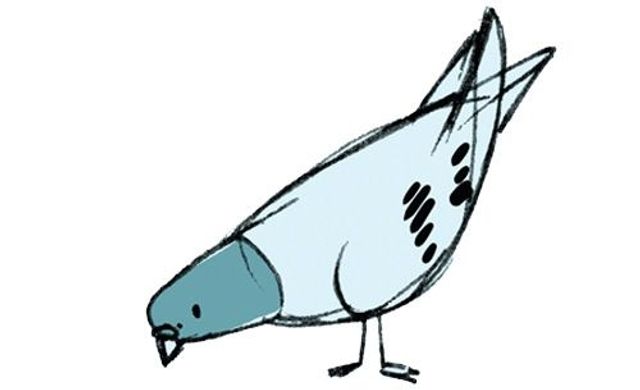
DIE PROPAGANDA
Colin Jerolmack ist Soziologe, aber vor wenigen Jahren begann er sich auch für Tauben zu interessieren. Seine Heimatstadt New York, wo schätzungsweise eine Million der Vögel leben, hatte gerade ein rigoroses Futterverbot verhängt. Wer sich nicht daran hielt – laut Jerolmack »vor allem 75-jährige Damen« – wurde mit Geldstrafen überzogen. Einflussreiche Stadtpolitiker forderten sogar einen Taubenbevollmächtigten, der der Plage ein Ende machen sollte. Jerolmack fragte sich, wie es zu dieser aufgeheizten Stimmung gekommen war. Er begab sich in die Zeitungsarchive und fand zwischen 1850 und 1950 noch relativ ausgewogene Artikel. 1927 zum Beispiel bat der Leiter der städtischen Bibliothek die Bevölkerung, Tauben nicht mehr nahe dem Gebäude zu füttern, weil sie dort gern nisteten und ihre Exkremente die Fassade verschmutzten. Gleichzeitig äußerte er Verständnis für das Füttern »dieser hübschen Vögel«, die unter seinen Mitbürgern »viele Freunde« hätten. Ab den Fünfzigerjahren wurde der Vogel zunehmend problematisiert. Es häuften sich Berichte über Krankheitserreger, die Tauben mit sich schleppten, und 1963 empfahl ein Gesundheitspolitiker der Stadt erstmals ein Fütterungsverbot und die Tötung aller Tauben. Die Erreger, die sie mit sich trugen, schwebten überall in New Yorker Luft, »und jeder atmet sie ein«, argumentierte er. »In der Stadt sterben Menschen, weil es anderen Vergnügen bereit, die Vögel zu füttern.«
Drei Jahre später beklagte ein städtischer Beamter den Niedergang eines Parks in Manhattan: Vandalismus, Dreck, Obdachlose und Schwule prägten das Bild – und Tauben, »die schlimmsten Vandalen überhaupt: Sie fressen unseren Efeu, unsere Wiesen, unsere Blumen und sie machen uns krank«. Er nannte sie »rats with wings«, die Ratten der Lüfte. Der Vogel war nun ganz unten in der Hierarchie der Stadtbewohner angelangt. In der Folge wiederholten Zeitungen weltweit dieses Bild. In den Artikeln war nicht länger von einzelnen Taubenhassern die Rede, vielmehr lehnte die Mehrheit der Bevölkerung den Vogel ab.
Rational begründen lässt sich die Haltung kaum. Zwar sind heute mehr als hundert Erreger bekannt, die unter Tauben grassieren, aber nur sieben davon seien bisher nachweislich auf Menschen übertragen worden, erklärt der Schweizer Bio-loge Haag-Wackernagel. Der New Yorker Immunologe Arturo Casadevall ergänzt: »Was die Verbreitung von ansteckenden Krankheiten betrifft, unterscheiden sich die Tauben nicht von Hunden, Katzen oder Fledermäusen. Man kann sich bei jedem Tier infizieren.«
Auch die Schäden, die der Taubenkot anrichtet, wären zu verkraften: In München verursachen die Tauben angeblich etwa eine Million Euro Schaden jährlich, die Stadt Köln zahlt 250 000 Euro, um ihre Bahnunterführung zu reinigen – Peanuts in den städtischen Haushalten. Der Soziologe Jerolmack führt den Taubenhass deshalb vor allem auf die Psyche der Stadtbewohner zurück, die sich nicht damit abfinden wollen, dass sich die Natur vor und über ihrer Haustür ungehindert ausbreitet. »Viele Menschen ertragen Tiere nur noch in domestizierter Form. Wildtiere wie Tauben, die nicht kontrolliert werden können, nehmen sie als Eindringlinge wahr, als Angriff auf die zivilisierte Welt.«
Dabei haben sich die Tauben nie aufgedrängt. Sie stammen von der Felsentaube ab, einem Vogel, der an den Felsenküsten Südeuropas und des Nahen Ostens hauste und diese Heimat auch im Winter nicht verließ. Heute ist der Vogel überall zu Hause, außer am Nord- und Südpol – weil der Mensch ihn stets im Gepäck hatte, wenn er neue Länder und Kontinente eroberte. Den Tauben wiederum garantierte die Nähe zu den Menschen sichere Nahrungsquellen, sie vermehrten sich explosionsartig. Auf jeden zehnten bis zwanzigsten Stadtbewohner kommt heute eine Taube, das entspricht einem weltweiten Bestand von 170 bis 340 Millionen Tieren.
Möglicherweise gründet genau in der Nähe die tiefe Abneigung vieler Menschen: Anders als Ratten bewegen sich die Tauben tagsüber auf der Straße, für jeden sichtbar, und ergreifen auch nicht umgehend die Flucht, wenn sie einen Menschen bemerken. Schon vor vierzig Jahren bemerkte der Wiener Verhaltensforscher und Zoologe Otto Koenig, ein Schüler von Konrad Lorenz: »Die psychische Belastung, ständig in der Masse zu leben, ist für den Menschen zu groß. Denn dort ist er wertlos, und er selbst wertet auch jede andere Masse als minder. Vielleicht gerade darum wurden durch direkten Angriff und Eingriff des Menschen vorwiegend Massentiere vernichtet. Die sogenannten ›Taubenkriege‹ in den Großstädten mögen zum Teil in diesen Bereich hineingehören. Die vielen Tauben locken durch anscheinend hohe Populationsdichte, durch ihre Allgegenwart und große Individuenzahl der Schwärme zum Angriff, zur Vertreibung oder Vernichtung. Der Mensch ist gegen Masse aggressiv.«
DER SINNLOSE KRIEG
Anfang der Sechzigerjahre lebten im schweizerischen Basel etwa 20 000 Tauben. Das war den Stadtoberen entschieden zu viel. Sie heuerten Taubenjäger an, die bis 1985 etwa 100 000 Vögel fingen und töteten. Am Ende des Gemetzels wurde wieder gezählt: Es lebten immer noch 20 000 Tauben in der Stadt. Daniel Haag-Wackernagel arbeitete zu dieser Zeit gerade an seiner Doktorarbeit. Er sollte ergründen, welche Methode sich am besten eignet, um die Taubenbestände zu verringern. Haag-Wackernagel sah bald ein, dass die archaische Herangehensweise, die Tiere einfach abzuschießen, »vielleicht für Blauwale oder Antilopen« funktionierte, aber sicher nicht für Straßentauben. Unter optimalen Bedingungen zeugt ein Taubenpaar bis zu zehn Junge im Jahr. Schon bei jährlich einem Jungen pro Paar müsste mehr als die Hälfte der Population vernichtet werden, um den Bestand zu verringern. Das jedoch sei unmöglich, wie Haag-Wackernagel beobachtete: Die Vögel würden »sehr schnell lernen, Fallen oder Gebiete, in denen abgeschossen wird, zu meiden«. Inzwischen haben die Wissenschaftler auch festgestellt, dass sich bei den überlebenden Tauben nach Tötungsaktionen die Geburtenrate erhöht und die Jungen sofort die entstandenen Futternischen nützen.
Für ebenso aussichtslos hält Haag-Wackernagel den Ansatz, die Geburtenrate der Taubenpopulation zu senken, etwa durch Sterilisation oder als Futter getarnte Kontrazeptiva. Zum einen erhöhten sich dann Überlebenschancen und Lebenserwartung der übrigen Tiere. Zum anderen sei es unmöglich, sämtliche Tauben der Geburtenkontrolle zu unterziehen. Damit sei alle Mühe vergebens, denn schon etwa zehn Prozent der Tauben könnten genug Nachwuchs zeugen, um die Ausfälle zu kompensieren.
Der Schweizer Forscher hat auch viele Fallen getestet, die auf dem freien Markt angeboten werden. Die meisten seien wirkungslos, im besten Fall verlagerten sie das Problem auf das Nachbarhaus – was immerhin die Firmen freut, die ihr Geld mit Taubenabwehr verdienen. Manche Städte siedeln Raubvögel an, als natürliche Feinde der Taube, mit gemischten Resultaten: Aus Berlin hieß es kürzlich zwar, die Taubenbestände seien daraufhin zurückgegangen, aber an der Alten Oper in Frankfurt griff ein neu importierter Wüstenbussard statt der Vögel auf dem Dach einen Hund auf der Straße an. Zudem sind die Tauben durchaus in der Lage, sich auf neue Feinde einzustellen: Werden sie zum Beispiel von Falken angegriffen, fliegen sie nah an der Hauswand entlang, wo die Jäger nicht zupacken können.
Der Vogel habe sich in der Stadt eben weiterentwickelt, sagt Haag-Wackernagel, »nur die Besten und Klügsten haben überlebt«. Die an den Menschen angepasste Stadttaube sei sogar fitter als die Ursprungsart, auf der arabischen Halbinsel habe sie die Felsentaube zum Teil verdrängt. »Versuchen Sie das mal mit einem Pudel und setzen ihn in einem Wolfsrevier aus – der hat wenig zu lachen.« Und trotzdem hat der Forscher einen Weg gefunden, um die Taubenbestände zu dezi-mieren: »Man muss den Vögeln die Nahrungsgrundlage entziehen. Dann sind sie gezwungen, mehr Zeit in die Suche nach Essbarem zu investieren – und haben keine Zeit mehr zu brüten.« Statt auf rigorose Futterverbote setzt er auf Aufklärungskampagnen. In Basel habe sich das bewährt, wer dort heute Tauben füttere, werde von seinen Mitmenschen schief angeschaut. Und der Bestand sei von 20 000 auf 8000 Vögel gesunken. Dennoch stößt das Modell in Deutschland auf wenig Gegenliebe.
Wandel durch Ännäherung
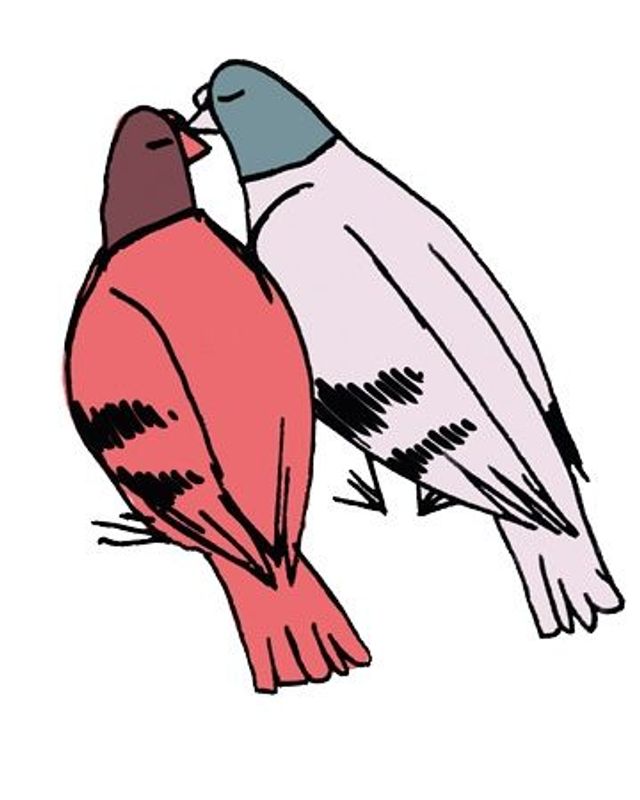
WANDEL DURCH ANNÄHERUNG
Die Augsburger Stadtverwaltung sitzt in einem denkmalgeschützten Gebäudekomplex, der schlimme Zeiten hinter sich hat. Der Innenhof war lange mit Taubenkot bedeckt, auf den Fenstersimsen türmten sich die Exkremente fingerdick. Bis 1995 beschäftigte die Stadt deshalb zwei Taubenjäger, dann machte sie den Vögeln ein Friedensangebot. Im Dachstuhl entstand ein Schlag, sieben Meter lang, drei Meter breit, mit Öffnungsschlitzen und hundert kleinen Nistzellen. Auf dem Boden wurden gehäckselte Hanfstengel eingestreut und ausreichend Körner, Weizen und Mais. Die Tauben nahmen ihr Zuhause an und verlassen es seitdem kaum noch, warum auch, schließlich ist das Nahrungsangebot dort besser als alles, was sie auf der Straße finden. »Die Probleme mit dem Taubendreck haben sich erledigt«, sagt Rudolf Reichert zufrieden. Der ehemalige Hauptschullehrer ist der geistige Vater des Augsburger Modells. Verschwunden sind die Vögel und ihre Kotspuren, an der Fassade der Stadtverwaltung ebenso wie auf dem Dach der hundert Meter entfernten Moritzkirche.
Zwölf Taubenschläge hat Reichert in der Stadt bereits errichten lassen, bis vor Kurzem betreuten der 78-Jährige und seine Frau noch selbst zwei davon. Die Schläge werden regelmäßig gereinigt, frische Eier durch Attrappen ersetzt. Es handelt sich um Plastikeier, mit 18 Gramm genauso schwer wie ein echtes Taubenei, das ist wichtig, sonst würden die Vögel den Schwindel sofort bemerken und ein neues Ei legen. Seit 1997 haben Reichert und seine Helfer etwa 90 000 Eier getauscht. Die Taubenpopulation sei sogar etwas geschrumpft, vermutet er, aber natürlich gebe es einige Tauben, die auch außerhalb der Schläge lebten und weiter fleißig Nachwuchs produzierten. Die Stadt ist dennoch mit der Entwicklung zufrieden und unterstützt die Taubenfreunde mit etwa 30 000 Euro jährlich. Zwei Dutzend deutsche Städte haben das Modell bereits übernommen, aber die Abdeckung mit Taubenschlägen ist in Frankfurt oder München bei Weitem nicht so flächendeckend. Selbst in Augsburg gibt es noch einige Brennpunkte, gerade erst leistete sich der Eishockeyverein für 160 000 Euro neue Video-wände – die alten Anzeigetafeln im Stadion hatten die Tauben mit einer robusten Dreckschicht überzogen, der auch eine Spezialreinigung nichts anhaben konnte.
GRABENKÄMPFE IN DER FRIEDENSBEWEGUNG
Daniel Haag-Wackernagel kann dem Konzept der deutschen Tierschützer wenig abgewinnen. Auf seinem Computer hat er eine Datenbank angelegt, mit mehr als 3000 Fachartikeln. Kein Zweifel, sagt er, die Explosion der Taubenbestände in den Städten ist ein Wohlstandsphänomen. Während der beiden Weltkriege seien die Populationen stark zurückgegangen, weil die Menschen schon selbst wenig zu knabbern hatten und für die Tauben nichts mehr übrig blieb. Seitdem finden die Tiere genügend Essensabfälle auf den Straßen, um sich rasch zu vermehren. Wozu da noch füttern? Haag-Wackernagel zeigt Fotos eines alten Mannes, dessen Wohnung die Polizei nach seinem Tod räumte: überall Säcke mit Taubenfutter. Er hatte Jahr für Jahr mehr als 16 Tonnen Körner an die Tauben verfüttert, genug für 1400 Tiere. Ein grenzwertiges Verhalten, findet der Forscher, »aber in Deutschland bekommt man dafür Tierschutzpreise«.
Damit tut er Menschen wie Rudolf Reichert und Gudrun Stürmer, die 2007 tatsächlich vom Land Hessen ausgezeichnet wurde, natürlich Unrecht. Auch ihnen sind die Wildfütterer ein Dorn im Auge, weil sie die Tauben von ihren Schlägen weglocken. Reichert betont, dass seine Helfer keine Beziehung zu den einzelnen Tauben aufbauen, »die Tiere sollen frei sein«. Doch die Methode des Professors aus Basel, die Vögel sich selbst und dem Müll der Stadt zu überlassen, hält er für Tierquälerei. »Die Menschen schmeißen ihnen doch oft nur Zeug hin, das sie krank macht: Nudeln, Knochen, verdorbene Semmeln, Kuchen. Unsere Tauben werden artgerecht gefüttert und sind kerngesund.«
Reichert räumt ein, dass die Fütterer es nur gut meinen, außerdem versteht es der Vogel, den Menschen den Kopf zu verdrehen: Die großen Augen und die hohe Stirn wecken Beschützerinstinkte, für viele der Wildfütterer sind die Tauben eine Art Ersatzfamilie. Meist handelt es sich um ältere Menschen, was den Wissenschaftler Haag-Wackernagel wie auch den Tierschützer Reichert hoffen lässt, dass sich zumindest dieses Taubenproblem bald auf natürliche Weise lösen werde – vorausgesetzt natürlich, dass die nächste Generation aus der Geschichte gelernt hat.
Abwehr ohne großen Nutzen
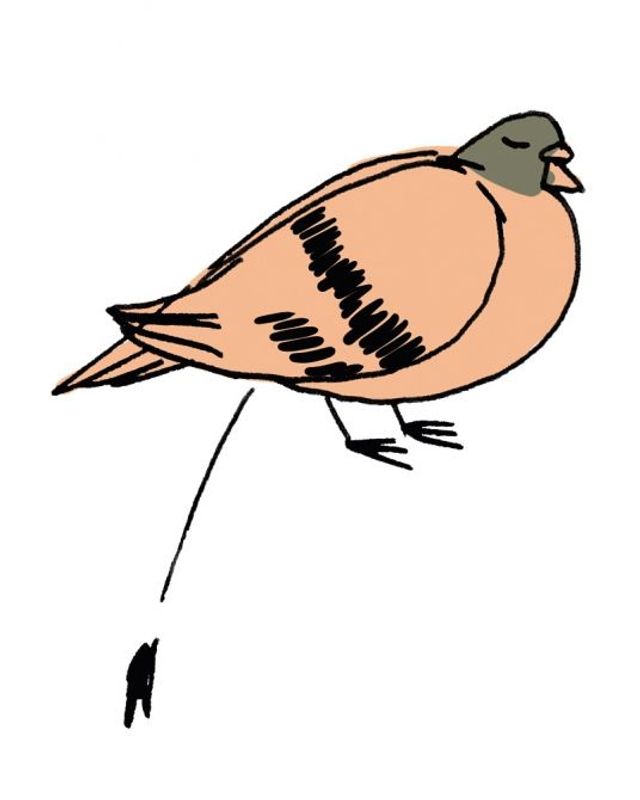
ABWEHR OHNE GROSSEN NUTZEN
Taubenpille
Verhütungsmittel, das dem Futter beigegeben wird. Wurde in -verschiedenen Städten getestet, änderte nichts an der Populationsgröße. Teuer: Ein Jahr Pille kostet etwa 20 Euro pro Tier.
Spikes
Drahtsysteme mit aneindergereihten Metallspitzen. Hindern die -Vögel an der Landung - und verlagern das Problem zum Nachbarn.
Ultraschall
Laut Herstellerangaben vertreiben Ultraschall-Systeme die Tauben. Der Biologe Haag-Wackernagel entgegnet, die Vögel könnten die hohen Töne gar nicht hören.
Vogelscheuchen
Abschreckung mag bei Amseln oder Drosseln funktionieren, aber Tauben lernen schnell, dass Kunststoffraben und Greifvögelattrappen ungefährlich sind.
Anti-Tauben-Gel
Gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ein Gel, das Chili enthält, soll laut Hersteller bei Tauben ein Brennen an den Genitalien verursachen. Kaum möglich, sagt Haag-Wackernagel, die Vögel haben nur innere Genitalien.
Illustrationen: Dirk Schmidt