SZ-Magazin: Frau Schygulla, der Philosoph Peter Sloterdijk sagt: »Ich gehöre zu den armen Menschen, bei denen die Geburtserinnerung nicht aus dem körperlichen Gedächtnis gelöscht ist; ich weiß, dass es eine bestimmte Form von Geburtsstress gibt, der sich zeitlebens reproduziert.« Geht es Ihnen ähnlich?
Hanna Schygulla: Ja. An meinem Anfang stand nichts als Schmerz. Als ich schon im Kommen war, wurde meine Geburt durch eine Spritze um einen Tag verzögert, weil der Arzt den Heiligen Abend lieber zu Hause verbringen wollte. Später erfuhr ich, dass er ein Assistent von Josef Mengele in Auschwitz war. Das KZ lag nur wenige Kilometer von meinem Geburtsort Königshütte entfernt, dem heutigen Chorzów. Meine Mutter sagte, meine künstlich verschleppte Geburt sei trotz Krieg und Flucht das furchtbarste Erlebnis ihres Lebens gewesen. Und dann hatte sie auch gleich eine Infektion in der Brust und ich eine im Darm. Mein wahnsinniges Schreien brachte sie fast um den Verstand.
Wie hat Sie Ihr Geburtstrauma geprägt?
Ich hatte früher oft das Gefühl, gelähmt zu sein oder zu ersticken. Aus Horror vor dem Steckenbleiben habe ich in Räumen immer darauf geachtet, am Ausgang zu sitzen. Ich kam nicht richtig aus mir raus und musste mir jedes Mal einen Stoß geben, um zu sprechen. Andere fanden es geheimnisvoll und anziehend, dass ich so wenig gesagt habe, aber mich quälte das Gefühl, durch einen unsichtbaren Schleier von der Welt getrennt zu sein. Ich fühlte mich wie die Knospe einer Blume, die nicht aufgehen kann, weil der Blumenhändler sie fürs Schaufenster mit Konservierungsspray haltbar gemacht hat.
Filmkritiker hielten Ihre Malaisen für Schauspielkunst und schwärmten von Ihrer »melancholischen Aura« und »somnambulen Verlangsamung«.
Mein slawischer Anteil, der ebenfalls zur Langsamkeit tendiert, hat diese Wahrnehmung noch verstärkt. Wenn ich mit Russen zusammen bin, empfinden die instinktiv eine Nähe zu mir.
Im Winter 1948, fast fünf Jahre nach Ihrer Geburt, klopfte ein Mann an die Tür, der gerade aus der Kriegsgefangenschaft entlassen worden war – Ihr Vater.
Ich hatte keine Erinnerungen an ihn. Als meine Mutter mich ihm mit den Worten »Schau mal, dein Hannchen« entgegenhielt, kriegte er die Arme nicht hoch. Die nächsten Jahrzehnte war er für mich ein Fremder, eine tote Seele mit zerstörter Fähigkeit zum Glück, die mich Abstand halten ließ. Dass er in sich eingeschlossen blieb, lag an seinen Kriegserlebnissen. Er sollte 1944 die Landung der Alliierten in Italien verhindern und geriet in die Hölle von Anzio und Nettuno. Seine Kameraden waren fast noch Kinder, er sah sie durch Granaten reihenweise in die Luft fliegen. Das eigene Leben wurde ihm so egal, dass er sich für Himmelfahrtskommandos meldete. Als er meiner Mutter davon erzählte, führte das bei ihr zu einer furchtbaren Desillusionierung. Ich höre sie noch schluchzend fragen: »Und wir? Hast du denn gar nicht an uns gedacht? Bedeuten wir dir nichts?« Jahrzehntelang wiederholte er immer wieder den Satz: »Das Leben ist gar nichts wert!«
Ihr Vater hatte acht Geschwister, Ihre Mutter zehn. Warum blieben Sie ein Einzelkind?
Zwischen meinen Eltern herrschte kalter Krieg. Eine große Rolle spielte Hitler. Meine Mutter war von Anfang an gegen ihn, später sah sie KZ-Häftlinge, die durch den Schnee zur Arbeit getrieben wurden. Mein Vater ist seine Hitler-Verehrung nie losgeworden. Er hat nie ausgekehrt in dieser Ecke. Dafür verachtete ihn meine Mutter. Als ich sechs war, versuchte sie, vom vierten Stock in die Tiefe zu springen. Dass sie trotz ihrer Verzweiflungsschreie zusammenblieben, war eine Sache der Konven-tion. Ihr wichtigster Ratschlag für mein Leben war: »Mach dich nie von einem Mann abhängig. Du siehst ja, was mit mir ist.« Daran habe ich mich immer gehalten.
Obwohl Sie mit 13 einen Schönheitswettbewerb gewannen, fühlten Sie sich hässlich. Warum?
Ich war noch ein Kind, als dieses Gefühl plötzlich da war. Ich fand immer alle schöner als mich. Die Robustheit meines Körpers passte nicht dazu, wie ich mich innerlich fühlte. Ich wollte ein Elflein sein, etwas ganz Zartes, denn so fühlte ich mich: zart, wie ein Blättchen im Wind. Ich habe dann immer am Spiegel geklebt um nachzusehen, ob ich nicht doch noch schön geworden war.
Wie lange quälte Sie das Gefühl, nicht schön zu sein?
Bis ich wirklich nicht mehr schön war – zumindest nach dem, wie die Männer das halt sehen. Wenn der Sex-Appeal aufhört, ist man in Männeraugen eben nicht mehr schön. Ob jemand von innen leuchtet, zählt nicht.
Sie wurden früh von berühmten Beauty-Fotografen wie Sante D’Orazio und Peter Lindbergh abgelichtet und waren auf den Titelseiten von Vogue, Time und Vanity Fair. Und trotzdem glaubten Sie immer noch, hässlich zu sein?
Ich begann mich manchmal schön zu finden, aber es war immer etwas, was nicht selbstverständlich war und ein Thema blieb. Ich wusste immer, dass Glamour zum Teil eine Lüge ist, und das macht tief im Inneren unsicher. Als Marilyn Monroe starb, war ich 17. Ich habe immer geschaut, was um diese Frau ist. Die hat mich fasziniert. Man kriegte mit, dass sie von Tabletten und Alkohol abhängig war und in der letzten Phase von einer Nervenklinik zur anderen ging. Sie war eine in Glamour verpackte Katastrophe. Schönheit kann auch ein Fluch sein. Der Satz, je schöner die Frau, desto unglücklicher ist sie, stimmt meistens. Die Überschönen werden eher auf einen Sockel gestellt und angebetet als geliebt. Dauernde Schönheit hat auch etwas Langweiliges, wenn sich das nicht mal mit etwas Groteskem ablöst. Im alten Japan haben die Handwerksmeister ein Reiskorn in ihre Vasen eingearbeitet. Indem die Vase nicht ganz perfekt war, wurde sie einmalig. Seit ich nicht mehr konkurrieren muss, kann ich mich auch so sehen. Das löst und tut gut.
Vor sieben Jahren sagten Sie: »Ich bin nicht mehr filmogen.« Was ließ Sie das sagen?
Ich habe es gesehen, wenn Fotos gemacht wurden – beim Film wollte man mich
ja schon nicht mehr. Die Augen werden kleiner, der Mund wird schmaler, die Haare werden weniger. Ich wog zehn Kilogramm mehr. Es war eine Schwere in mich hineingekommen. Ich habe der auch nachgegeben und nicht versucht, mir das irgendwie runterzuhungern. Ich esse gerne und genieße gerne. Wenn die Liebesfähigkeit zunimmt, ist alles andere unwichtig, finde ich. Sie ist es, die die Ausstrahlung ausmacht. Ich will Richtung innere Gesundheit, hin zum Meer. Ich beobachte mein Unbewusstes. Wann kriege ich einen Schluckauf? Wann verspreche ich mich? Was machen meine Hände, während ich diesen Satz sage? Das sagt so viel. Da bin ich in Kontakt mit dem Herzen meiner Wünsche und Abneigungen.
Mit Anfang zwanzig haben Sie drei Jahre lang mit einem italienischen Maler unter einem Dach gelebt, der sich Luis del Pizzo nannte. Wenn Sie im Restaurant einen zweiten Gang bestellen wollten, rastete der Mann aus und warf Ihnen Völlerei vor, eine Todsünde, wie er meinte.
Antiautoritäre Menschen wie ich haben gleichzeitig eine Faszination für Autorität. Luis war zwölf Jahre älter als ich und sah noch älter aus. Weil er Autorität und Stärke ausstrahlte, sind ihm viele auf den Leim gegangen, ich auch. Er wollte Leuchtturm sein und war in Wahrheit ein Schiff in Not. Er bekämpfte, dass ich beim Film war und wollte aus mir eine Intellektuelle machen. Dabei litt er furchtbar darunter, dass der Intellekt für ihn das oberste Kriterium war. Da wird ja keiner wirklich froh, wenn das die letzte Instanz ist. Die Erfahrungen mit ihm haben mich bestärkt, keine eheähnlichen Verhältnisse mehr einzugehen.
»Wenn ich in Brand war, dann habe ich das auch gezeigt.«

Hanna Schygulla schauspielerin Nach 20 Filmen mit ihrem Ent-decker Rainer Werner Fassbinder - darunter »Lili Marleen« und »Die Ehe der Maria Braun« - arbeitete Hanna Schygulla mit europäischen Regiegrößen wie Jean-Luc Godard, Carlos Saura, Ettore Scola und Andrzej Wajda. Seit den Neunzigern tritt die Wahlpariserin auch als Chansonsängerin auf. Am 25. Dezember wird sie 70 Jahre alt.
1973 fragte sich ein Reporter des Stern, was Sie sagen würden, wenn ein Mann Sie fragt: »Was ist, gehen wir bumsen?« Er schrieb: »Die Frage muss ihr gar nicht gestellt werden, denn die würde sie selber stellen.« Richtig?
Den Ausdruck bumsen hätte ich nie gebraucht, auch vögeln nicht. Man versteht sich auch ohne diese ernüchternd motorischen Vokabeln. Mein Satz ging eher so: »Sollen wir oder sollen wir nicht?« Ich bin keine gewesen, die endlos Katz und Maus spielt. Wenn ich in Brand war, dann habe ich das auch gezeigt. Ich habe mich selber dazu erzogen, dass mir die Wahrheit sofort rauskommt, wenn es geht auf eine kesse Art. Unsichere Männer hat so viel offensive Bereitschaft verschreckt. Für die war ich too much.
Als Sie 1985 Delta Force in Israel drehten, steckten Sie in Jerusalem einen Zettel in die Klagemauer. Ihr Wunsch: ein Kind.
Für mich wäre damals jedes Kind ein Wunschkind gewesen, aber das wirkliche Wunschkind wäre von Jean-Claude Carrière gewesen.
Carrière schrieb Drehbücher für Luis Buñuel, Milos Forman, Louis Malle und Jean-Luc Godard und zählt zu den Granden der französischen Kultur. Wie haben Sie ihn kennengelernt?
Wir trafen uns 1981 in Paris, weil er das Drehbuch für Die Fälschung schrieb, wo ich mitspielte. Es war Liebe auf den ersten Blick, und es folgten 13 Jahre Eros. Den Jüngling Jean-Claude hatten großzügige Huren mit Vergnügen in diese Kunst eingeweiht. Er war der Mann meines Lebens und der Grund, dass ich nach Paris zog. Seine überbordende Kreativität nahm einem den Atem, und er sagte so schlicht-schöne Sätze zu mir wie: »Ich schaue dir gern beim Leben zu.«
Carrière war verheiratet und Vater einer Tochter.
Deshalb suchten wir uns ein Liebesnest hoch oben auf dem Montmartre. Ich hatte meine Wohnung, er sein Haus und seine Frau. Die beiden kannten sich seit frühester Kindheit und nach ihm zu schließen, war die Ehe schon lange ein brüderlich-schwesterliches Verhältnis. Jean-Claude ist ein Südfranzose. Wie es war, war für ihn wunderbar. Und ich dachte, das mit uns könnte ein Leben lang halten und wünschte mir ein Kind von ihm. Aber er wollte nicht.
Warum nicht?
Er ist ein toller Schriftsteller und macht dauernd Kinder – geistige. Er sagte: »Ich bin ein armer Mann. Wenn du ein Kind von mir kriegst, bist du mir halb verloren. Wenn du keins kriegst, bist du mir auch halb verloren.« Wenn ich Kindern zuschaute, spürte er, dass ich von ihnen stärker fasziniert war als von Erwachsenen. Er war immer überzeugt, dass ich diejenige bin, die geht. Es kam dann umgekehrt.
Carrière verließ Sie wegen einer Jüngeren und wurde mit 72 noch mal Vater.
Als er mir die Wahrheit einträufelte, saßen wir in dem Lokal, das Sie sehen, wenn Sie bei mir aus dem Fenster schauen. Das Treffen hat nicht mehr als drei Minuten gedauert. Ich wusste, entweder folgt ein bitterer Geschmack für immer, oder ich hole die letzte Süße aus mir heraus. Das zweite hat dann die Oberhand gehabt. Es hat mich glücklich gemacht, dass ich zu dieser Geste fähig war. Deshalb erzähle ich jetzt in meinem Buch davon.* Ich habe ja immer diskret gelebt.
Als Zeichen Ihrer Trauer schickten Sie Carrière immer wieder kommentarlos die gleiche Postkarte: Ein Auge, aus dem Wasser quoll. Als letzte Karte bekam er das Auge mit der Kunstträne von Man Ray.
Die Neue hatte auf einem Kind beharrt, während ich nicht darauf beharrt hatte. Später fragte Jean-Claude manchmal, warum ich denn nicht hartnäckiger gewesen wäre oder gegen seinen Willen ein Kind bekommen hätte. Aber das bin ich nicht. Ich hatte auch Angst. Was, wenn irgendwas mit dem Kind ist?
Sie haben Carrières neuer Freundin angeboten, »Patenmutter« zu werden.
Es wäre wunderbar für mich gewesen, ein Kind aufwachsen zu sehen. Ich bin viel hingegangen zu der Kleinen. Ihre Mutter gab sich Mühe, freundlich zu sein, aber es blieb Getue. Vielleicht dachte sie, ich will den Vater zurückerobern. Ich zog dann Leine.
Haben Sie in Ihrem Leben Heiratsanträge bekommen?
Nein. Die Männer haben gespürt, dass ich es schöner fand, sich gegenseitig zu besuchen, als unter einem Dach zu leben. Die Männer, die mich gehabt haben, haben mich nie ganz gehabt, und ich wollte sie auch nicht ganz haben. Ich bin gern allein und brauche es, dass man sich immer wieder fremd wird. Zusammensein ist für mich die Unterbrechung im Alleinsein. Vielleicht wird man zum Einzelgänger
geboren.
Sie leben seit zwanzig Jahren mit der kubanischen Schauspielerin und Regisseurin Alicia Bustamante unter einem Dach. Was macht es einfacher, mit einer Frau zusammenzuleben?
Alicia ist ein Kind des Glücks, das den ständigen Rollenwechsel so liebt wie ich und mit ihrem Kommunikationsgenie Steine zum Vibrieren bringen könnte. Sie hat nie aufgehört, Kind zu sein und kann Menschen mit wenigen Tönen oder Gesten so gut nachahmen, dass unser Alltag zur Bühne wird. Ihre unwiderstehliche Clown-Power ersetzt mir das späte Kind, das ich nie gehabt habe. Sie ist für mich Schwester, Lehrerin und Großmutter. Ein Satz, den ich oft von ihr höre, lautet: »Du musst dich endlich selber so lieben wie ich dich – und du mich!«
Haben Sie je überlegt, ein Kind zu adoptieren?
Ja. Ich hatte mir bereits den Anwalt von Mia Farrow genommen, der bei ihr ja sehr erfolgreich war, und bin in eine größere Wohnung gezogen. Aber dann kam alles anders. Meine Mutter stürzte nach mehreren Schlaganfällen in die Hilflosigkeit des Alters und wurde die nächsten acht Jahre in gewisser Weise zu meinem Kind. Am Ende ging es mehr und mehr Richtung Rollstuhl und Sprachlosigkeit und Verlöschen. Mein Vater kam dann auch nicht mehr allein zurecht. Er starb mit 96. Bei beiden erlebte ich, wie ähnlich Anfang und Ende des Lebens sind. Als ich meiner Mutter die Hosen hochzog, kam plötzlich der Satz aus ihrem Mund: »Bist du mir auch nicht böse, dass ich jetzt dein Kindchen bin?«
*Hanna Schygulla, Wach auf und träume, Schrimer/Mosel Verlag
»Ich habe manchmal keine Brille auf. Etwas undeutlich zu sehen, heißt, etwas anderes zu sehen.«
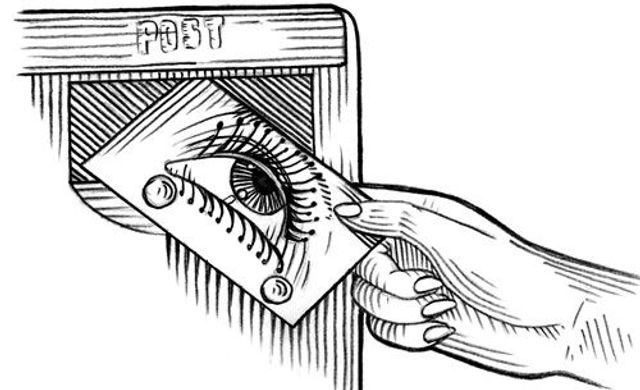
In den 18 Jahren zwischen 1987 und 2005 ruhte Ihre Filmkarriere, weil Sie Ihre Eltern pflegten. Haderten Sie?
Ich wusste, dass ich die letzten Glamourjahre vor mir hatte, aber es gab keine Sekunde des Abwägens, ich musste mich um sie kümmern. Ich habe dann mit einem ungeheuren Aufwand an Energie fast zwanzig Jahre lang ein Doppelleben geführt zwischen der großen Welt von Paris und der kleinen Welt von Zorneding bei München.
Die Zeitungen sind voll von Stars, die sich nicht um ihre Eltern kümmern. Wie leicht fiel Ihnen der Wechsel vom Filmstarleben zur Altenpflege?
Ich hatte von früh auf das unbewusste Bedürfnis, gutzumachen, was das Leben den beiden an Glück schuldig blieb. Wir haben Familienglück auf die verrückteste Weise nachgeholt. So geherzt wurde meine Mutter nie wie von mir. Und ich durfte Kind sein. Mein Vater genoss es, das erste Mal Arm in Arm mit mir zu gehen und erlebte die vielleicht glücklichste Zeit seines Lebens. Er wurde zum Schluss richtig sonnig und sein Herz strahlte. Es gelangen ihm endlich die Gesten, die bei unserem Kennenlernen misslangen. Ich habe es auch genossen zu dienen, statt bewundert zu werden. Wegzukommen vom Egozentrischen hat mir gutgetan. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich nicht wusste, dass das fast zwanzig Jahre geht.
Was war die interessanteste Rolle, die Sie wegen Ihrer Eltern abgelehnt haben?
David Lynch wollte mich für Blue Velvet. Die Rolle hat dann Isabella Rossellini bekommen.
Zwischen 1969 und 1980 spielten Sie in rund 20 Filmen von Rainer Werner Fassbinder mit. Nervt es Sie, dass Ihnen heute noch jeder mit diesem Thema kommt?
Nein. Der Rainer war schicksalhaft für mich, denn die Schauspielerin Hanna Schygulla hätte es ohne ihn und die verdeckte Liebe zwischen uns nicht gegeben. Wir spürten beide, dass wir füreinander bestimmt waren, ohne dass wir allzu viel gemein hatten. Ich lebe schon doppelt so lange wie er und trage einen kleinen Teil seines Vermächtnisses weiter. Das ist doch etwas Schönes, dass er durch mich weiterlebt.
Wenige Tage vor seinem Tod sagte Fassbinder: »Als ich die erste Einstellung in meinem Leben gedreht habe, war das toller als der tollste Orgasmus, den ich je hatte. Eigentlich bin ich nur glücklich, wenn ich Filme mache.« Warum war er trotz 41 Filmen in 13 Jahren am Ende ein manisch-depressives Kokainwrack?
Wenn ihm bei seinen frühen Filmen etwas besonders gut gelang, hüpfte er am Set herum wie ein glückliches Kind. Später wirkte er oft wie ein müder Imperator. Vielleicht begann es ihn zu langweilen, dass er sein Leben nur auf dem Umweg über Filme leben konnte.
Fassbinder war am Set ein cholerischer Despot. Nur Sie behandelte er wie ein rohes Ei.
Er wusste, wenn er mich schlecht behandelt, dreh ich mich um und geh. Ich bin keine, die Verletzungen genießt. Das heißt aber nicht, dass ich mich ihm nicht unterworfen habe. Ich liebe die Überwältigung, wenn ich spüre, dass etwas größer ist als ich. Es war ein hoch kompliziertes Wechselspiel zwischen uns. Sein unausgesprochenes Versprechen lautete: Zeig mir, was du alles mit dir machen lässt, und ich zeige dir, wer du bist. Nach Drehschluss ging ich dann auf Abstand. Ich wollte auch nie in die Kommune-Villa in Feldkirchen bei München ziehen. Lieber bin ich dort ein- und ausgeflogen wie ein Vogel aus einem Käfig mit offener Tür. Das Tragische an ihm war, dass er einerseits sagte, die Freiheit fängt da an, wo die Unterdrückung aufhört, andererseits musste er selber immer unterdrücken. Hörigkeit war für ihn ein Liebesbeweis. Wie kann man mit den eigenen Filmen dafür kämpfen, dass der Mensch nicht mehr getreten wird und dabei selber treten? Aber wahrscheinlich sind alle Genies mehr oder weniger unerträglich.
1981, ein Jahr vor seinem Tod mit 37, sagte Fassbinder, dass er und Sie »in all den Jahren keinen, wirklich nicht einen einzigen privaten Satz gewechselt haben«.
Ich war ihm gegenüber scheu und er mir gegenüber. Wir brauchten zwischen uns eine geheimnisvolle Spannung, und die bedurfte keiner Worte. Aber da wäre auch Substanz für anderes gewesen. Ende der siebziger Jahre kam der Wunsch in mir hoch, ein Kind mit ihm zu haben. Ich habe ihm das aber nie gesagt. Als ich schließlich bereit war, war er wegen der Drogen schon jenseits von allem.
Waren Sie jemals im »Führerbunker«, wie Fassbinders mit Spiegeln ausstaffierter Schlafraum in der Münchner Clemensstraße genannt wurde?
Nein.
Stimmt es, dass Fassbinder Sie heiraten wollte?
Das haben mir Leute aus seiner Gefolgschaft erzählt. Mich hat er nie gefragt.
Später machte er Barbara Valentin und Ingrid Caven Anträge.
Nach mir waren die Tore offen.
Warum wollte Fassbinder, bekennend schwul, unbedingt heiraten?
Ein Tabubrecher sein und gleichzeitig das sogenannte bürgerliche Glück leben, diese beiden Extreme wollte er gleichzeitig ausleben.
Fassbinder schnupfte am Ende sieben Gramm Kokain am Tag.
In den ersten Jahren hat er nie an Drogen rangehen wollen. Wir mussten heimlich kiffen. Wenn er kam, hieß es: »Mach den Joint aus, der Rainer kommt!« Am Ende war er ein ausgepumpter Koloss. Kokain macht ja so fickrig. Ich habe es einmal genommen. Ich mochte das überhaupt nicht. Es hat mich in eine Art Dauereile gebracht, furchtbar. Ich liebe eher Dinge, die mich halluzinieren lassen. Deshalb setze ich manchmal keine Brille auf. Etwas undeutlich zu sehen, heißt, etwas anderes zu sehen.
Sie werden im Dezember siebzig. Wie kommen Sie mit dem Alter zurecht?
2011 habe ich wegen meiner Wirbelsäule fast ein Jahr im Rollstuhl gesessen und brauchte Morphium, um wegen der Schmerzen nicht durchzudrehen.
Gehen Sie deshalb erst um drei, vier Uhr morgens schlafen?
Nein, das hat einen anderen Grund. Mir gelingt das Tagträumen am besten nachts. Um Mitternacht herum lasse ich mich in der Zeitlosigkeit nieder, und dann wird das, was ich mir vorstelle, die Wirklichkeit. Ich kann in mir frühere Lebensalter hochkommen lassen, Erotisches eingeschlossen. Darin habe ich Übung. Wofür bin ich Schauspielerin.
Ein Kritiker beschrieb Sie mal als »das ungewöhnlichste erotische Ding seit Marlene Dietrich«.
Die Zeiten sind vorbei, dass Männer mich ansprechen. Ich habe bei Frauen inzwischen mehr Anklang. Bei Männern fangen ab fünfzig die Hormone noch mal an zu prickeln. Es kommt zu einer biologischen Verblendung. Sie sind fixiert auf junge Mädchen und schauen bei Frauen meines Alters gar nicht mehr hin. Man wird unsichtbar.
Sie haben sich in Berlin eine Wohnung gekauft. Was bringt Sie nach mehr als dreißig Jahren zurück nach Deutschland?
Es ist die Aussicht auf ein neues Leben, die mich ein letztes Mal die Wohnung wechseln lässt. Jetzt geht es darum, gute Freunde zu finden, ohne dass ich zwanzig Jahre Zeit dafür habe. Das muss schneller wachsen als früher.
Warum gehen Sie nicht nach München zurück, der Stadt Ihrer Erfolge?
Weil ich dort knietief in meiner Vergangenheit wate. Jeder Stein erinnert mich an etwas. Ich brauche das Gefühl, dass bei mir noch mal was losgeht. Wie unter Zwang habe ich monatelang die Pflanzen in meiner Wohnung mit ihrem Wurzeltuff aus der Erde gezogen und in andere Töpfe verpflanzt. Sie haben es ausgehalten. Deshalb blicke ich mit Wehmut nach vorn.
Wird Alicia Bustamante mitkommen nach Berlin?
Nein. Sie mit 83 Jahren noch einmal zu verpflanzen, würde nicht gehen, allein schon wegen der neuen Sprache, die sie lernen müsste. Sie hat ein zweites Zuhause in Kuba und kann in den Schoß ihrer Familie zurückkehren. Unsere Liebe ist inzwischen so tief, dass sie auch über den Ozean reicht. Das ist unser beider Lebensglück.
Ist es, wie neuerdings behauptet wird, zu neunzig Prozent Veranlagung, ob man glücklich ist?
Ich kann an mir beobachten, dass das nicht stimmt. In den Jahren meiner Karriere hatte ich stets diese Traurigkeit im Blick. In den letzten zwanzig Jahren ist mein Blick immer lichter geworden. Als Kind habe ich mir das Beste auf dem Teller für zuletzt aufgehoben. Diese Marotte ist meine Leuchtspur für mein drittes Alter. Ende gut, alles gut.
Fotos: Jérôme Bonnet Illustration: Danilo Agutoli

