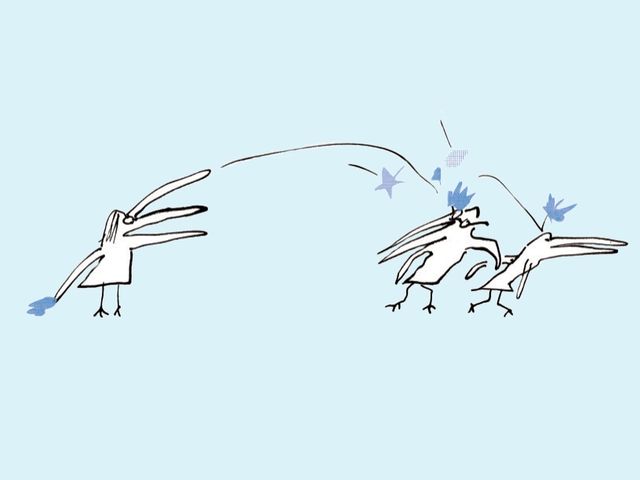Frau Parker, Sie haben ein Buch mit fiktiven Briefen an die Männer Ihres Lebens veröffentlicht. Unter den Adressaten findet sich aber auch ein Fabelwesen.
Mary-Louise Parker: Tja, das ist etwas verwirrend, nicht? In erster Linie schreibe ich über Männer, die mir wichtig waren, und erzähle von einzelnen Momenten, die mich geprägt haben, und für die ich eher dankbar bin. Ich schreibe Ex-Liebhabern, deren Namen ich großteils geändert habe, meinem Vater, einem Schauspiellehrer, meinem Nachbarn, aber auch Männern, deren Namen ich gar nicht kenne: einem Feuerwehrmann, der meinem Sohn einmal die Angst genommen hatte, einem Taxifahrer, bei dem ich mich entschuldigen wollte, einem Indianerjungen, der mich zum Tanzen aufgefordert hatte, als ich 14 Jahre alt war und mich als Mädchen so komisch und unwohl fühlte. Es war das erste Mal, dass mich jemand bemerkt hatte, ein romantischer, poetischer Moment, nichts Sexuelles. Und dann adressiere ich auch einen Brief an eine Person, in der ich die Erlebnisse mit drei eher schwierigen Ex-Freunden vermischt habe. Ich nenne ihn Zerberus, den Hund mit drei Köpfen. Hört sich merkwürdig an, aber ich wollte mit der Figur beschreiben, wie man die Probleme mit dem Ex-Freund in jede neue Beziehung mitschleppt. Ein etwas düsterer Brief, aber ich musste beim Schreiben auch viel lachen.
Wie würden Sie Ihr Buch bezeichnen: als Biografie oder eher als gesammelte Erzählungen?
Ich wollte auf keinen Fall klassische Memoiren schreiben. Dieses Buch erzählt wenig aus meinem Schauspielerleben, wenig aus meiner Kindheit. Alle heftigen Dinge, die mir natürlich auch widerfahren sind, die richtig gemeinen, habe ich ohnehin außen vor gelassen. Aber natürlich verraten die Briefe einiges über mich. Die Briefe passen in keine Schublade. In diesem Land soll alles in Schubladen passen. Vor allem Schauspieler. Wäre ich Verkäuferin oder Lehrerin, würde sich die Frage nach der Wirklichkeit kaum stellen.
Colum McCann, der irische Schriftsteller, hält Ihr Buch in jedem Fall für »unterhaltsam, überraschend, wütend, intim, tiefgründig und sehr, sehr zärtlich«.
Es war schon deprimierend, wie viele Leute sich darüber verwundert zeigten, dass ich so wenig über dies oder jenes geschrieben und keinen Klatsch über Schauspielerkollegen ausgebreitet habe. Umso dankbarer war ich für alle Leute, die sich mit dem Buch wirklich auseinandergesetzt haben, besonders Colum McCann, den verehre ich.
Die meisten Details aus Ihrem Buch entsprechen also der Wirklichkeit. Sie mögen Knoblauch?
Habe ich das etwa geschrieben?
Beim Auszug aus der Wohnung eines Ex-Freundes packen Sie wütend Ihre Knoblauchpresse ein.
Ich fürchte, das war gar nicht meine, sondern sie gehörte meinem Freund und mir gemeinsam. Eine sehr aufgebrachte Freundin half mir beim Packen, und meinte, ich dürfe die Küchengeräte auf keinen Fall in der Wohnung lassen. Da sehen Sie: Einige Dinge und Szenen mit verschiedenen Freunden fanden tatsächlich genau so statt, wie ich sie beschreibe, aber gleichzeitig habe ich auch alle möglichen Details und Erlebnisse vermischt. Das meiste ist der Wirklichkeit entlehnt, manchmal hab ich die Stadt verändert oder einen Namen, insbesondere an einer Stelle, wo es zum Sex mit jemandem kam, dessen damalige Partnerin nicht verletzt werden soll.
Sie sind alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, Sie spielen am Broadway, drehen in Hollywood. Finden Sie im wirklichen Leben überhaupt Zeit, Briefe zu schreiben?
Ja, das mache ich. In bestimmten Momenten reichen E-Mails einfach nicht. Und ein paar handschriftliche Sätze können vielen Menschen etwas bedeuten.
Soziale Medien meiden Sie. Sind Sie altmodisch?
In gewisser Weise. Ich wirke oft wiedersprüchlich, bin rebellisch und altmodisch zugleich. Soziale Medien sind gleichmacherisch. Jeder will da toll rüberkommen, wer postet schon ein hässliches Foto von sich? Ich bin 52. Als ich mit der Schauspielerei anfing, gab es keine Handys, niemand fotografierte einen mit seinen Kindern im Restaurant. Ich möchte da nicht mitmachen. Und wehe dem, den ich beim Fotografieren in der Vorstellung erwische. Das lenkt sehr ab. Eine Kollegin von mir meint sogar, am Theater dürfe nicht mal gefilmt werden, das käme immer flach rüber. Eine ganze Dimension, das Herzklopfen, die Atmosphäre fehlen.
Wie lange haben Sie an dem Buch geschrieben?
Viereinhalb Monate. Ich hatte fünf Briefe zur Ansicht eingeschickt, und als der Verleger fragte, ob ich mit den anderen bis Ende des Jahres fertig werden könnte, sagte ich leichtsinnigerweise zu. Ich war ja ganz unerfahren. Aber ich hatte noch stapelweise alte Notizen und Briefe, die ich benutzen konnte. Es gab einen einzigen Mann, von dem ich mir nur einen Satz notiert hatte: der Surfer, der in Kalifornien am Strand lebte und immer nur einen Lendenschurz trug. Er verschmähte mich als junges Mädchen, aber ich habe ihn so verehrt, dass mir viele Details in Erinnerung blieben. Er war beim Schreiben noch ganz präsent.
Haben Sie Ihr Buch geschrieben, um Ihre Beziehungen aufzuarbeiten und Ihr Leben besser zu verstehen?
Ich habe einen inneren Dialog über die Frage geführt, warum ich mich mit bestimmten Typen eingelassen habe. Die Frage ist noch nicht endgültig geklärt. Außerdem wollte ich endlich mal was Längeres schreiben. Ich habe ja lang für das Esquire-Magazin alle möglichen Artikel geschrieben: Kochtipps für das erste Date und so. Auch den ersten offenen Brief an die Männer meines Lebens. Es ging mir bei dem Buch darum, meine Grenzen als Schreiberin auszutesten. Der Brief an Zerberus war eine echte Herausforderung für mich.
Macht Ihnen das Schreiben Spaß?
Sehr. Ich fühle mich dabei so produktiv. Nach einer gelungenen Theaterprobe, wenn ich denke, das Bestmögliche getan zu haben, fühle ich mich abends ganz ruhig. Vom Schreiben dagegen werde ich richtig euphorisch und könnte ewig weiterschreiben. Zu reiner Fiktion fehlt mir vielleicht das Talent. Ich würde ja liebend gern so zwischen den Erzählebenen herumspringen können wie Kate Atkinson. Meine Geschichten beginne ich immer mit meinen eigenen Problemen und Erfahrungen und abstrahiere dann davon.
Sind Sie stolzer auf Ihr Buch als auf Ihre Arbeit als Schauspielerin?
In gewisser Weise ja.
Langweilt Sie Ihre Arbeit?
Nein, es gibt schon einige Auftritte, auf die ich ähnlich stolz bin, und ich liebe die Schauspielerei immer noch, besonders auf der Bühne ist es eine enorme Herausforderung. Trotz aller Erfahrung weiß man nie, ob man gut ist. Ich probe zurzeit ein Stück am Broadway, das ich im Frühjahr schon einmal gespielt habe: Heisenberg, mit nur zwei Personen, und ich fühle mich kein bisschen sicher. Jedes Mal, wenn ich die Bühne betrete, besteht die Gefahr, komplett zu versagen. Ich liebe diesen Druck, aber man muss ihn auch aushalten können. Die Schauspielerei hat mir erlaubt, so mit Menschen zu reden, wie ich persönlich nie mit irgendjemandem geredet habe. Aber der Text auf der Bühne wird gekürzt und umgeschrieben. Das Schreiben erlaubt noch größere Freiheiten. Deswegen war es mir auch so wichtig, mein Buch genau so zu schreiben, wie ich es wollte, und nicht wie etwas, was die Leute vielleicht lieber gehabt hätten: eines mit meinem Foto auf dem Cover und schockierenden Sensationen darin. Ich habe kein Buch geschrieben, um es gut zu verkaufen.
Vielleicht nimmt man Ihnen die Rolle einer ernsthaften Schriftstellerin nur schwer ab, weil Sie sich mit nichts als einer Schlange um den Hals fotografieren ließen?
Wer sich nackt fotografieren lässt, muss damit rechnen, nicht ernst genommen zu werden. Das verstehe ich, es macht mich nicht wütend, aber etwas enttäuscht bin ich schon, dass ich im Fernsehen ständig Dinge gefragt werde, die überhaupt nichts mit meinem Buch zu tun haben.
Zum Beispiel über den Vater Ihres Sohnes, der Sie während der Schwangerschaft verlassen hat?
Über Dinge jedenfalls, über die ich sicherlich nicht sprechen möchte. Es ist wirklich hart. Ich habe das gute Gefühl, etwas geschaffen zu haben, worauf ich stolz bin, und jeder erinnert mich nur an diese Geschichte.
Die Sex- und Kochtipps in Esquire haben vielleicht auch eine falsche Erwartungshaltung geweckt.
Da habe ich eigentlich über alles geschrieben, worum ich von der Redaktion gebeten wurde. Lustig, kaum jemand hat davon Notiz genommen, dass ich sicher 16, 17 Jahre für Esquire geschrieben habe. Die Leute haben mein Foto mit einem Text daneben gesehen und gefragt: Wer hat das für Sie geschrieben? Sogar Freunde fragten mich das. Ich könnte das ja auch als Kompliment verstehen, aber die Antwort hört sich schon ein bisschen komisch an: Ich habe das für mich geschrieben. Sogar das wollte man einer Frau mit Schlange um den Hals nicht glauben. Ich wurde übrigens nicht mal stark redigiert.
Haben Sie mehr gute Freunde unter Männern?
Unter den Menschen, die ich Freunde nenne und in deren Gesellschaft ich mich wohl fühle, sind tatsächlich mehr Männer. Nat, mein Nachbar von unserem Wochenendhaus auf dem Land, mein Freund aus Uganda, viele schwule Freunde. Aber meine Frauenfreundschaften sind extrem eng und gut.
Glauben Sie, Männer ebenso gut verstehen zu können wie Frauen?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir überhaupt irgendjemand anderen verstehen können. Das würde mich überraschen. Ich finde Männer einfach faszinierend und es fällt mir leicht, mit meinen Freunden abzuhängen. Meinen Brüdern habe ich mich schon immer sehr nah gefühlt, obwohl der eine viel älter ist als ich, er hat geheiratet, als ich neun war. Seine Tochter ist heute vierzig und meine beste Freundin. Beide Brüder sind gute Männer, haben jung geheiratet und kümmern sich gut um ihre Frau. So wie mein Vater.
In dem Brief an Ihren Vater schreiben Sie: »Meine Familie ist Deine.« Hat Ihr Vater Sie stärker beeinflusst als ihre Mutter?
Ja, das habe ich geschrieben, gleichzeitig habe ich das Buch meiner Mutter gewidmet. Und er hätte es geliebt, wenn er das noch hätte erleben dürfen. Mein Vater hing so sehr an meiner Mutter, war ihr treu ergeben. Dabei war mein Elternhaus wirklich keines, in dem es leicht gewesen wäre aufzuwachsen, und mein Vater war auch niemand, mit dem es leicht gewesen wäre, verheiratet zu sein. Mein Sohn ähnelt ihm ein wenig, ich auch. Ich wünschte, ich hätte mehr von meiner Mutter. Jeder Mensch sollte so wie meine Mutter sein. Sie ist 92 Jahre alt, immer noch klug, bisweilen etwas vergesslich, und unglaublich hübsch. Wahrscheinlich, weil sie so rein ist. Ich habe sie nie fluchen gehört, nie ein böses Wort zu irgendjemanden. Eine echte Lady. Auf ihre Art exzentrisch, auch etwas altmodisch. Sie lebt bei meiner Schwester in Kalifornien. New York ist zu kalt für sie. Meine Tochter hat viel von ihr.
Verkörpert Ihr Vater das, was Männer Ihrer Meinung nach sein sollten?
Das wäre unrealistisch. So hingebungsvolle Männer wie ihn gibt es nicht mehr. Meiner Nichte geht es da ganz ähnlich. Wir sind beide in Familien aufgewachsen, in denen die Eltern zusammenbleiben, egal was passiert. Dass man an einer Beziehung arbeitet, selbst wenn sie es einmal nicht wert erscheint, das gibt es kaum mehr.
Dabei hat Ihr Vater auch Schwächen gehabt.
Seine zeitweilige Arbeitslosigkeit konnte er kaum ertragen. Er war voller Wut, manchmal mussten wir ein Lokal verlassen, weil er plötzlich unausstehlich wurde. Mit 19 kam er in den Krieg, erlebte in Korea furchtbare Schlachten, nach seinem Ausscheiden hielt er an seiner Soldatenehre fest. Niemals hat er bei seiner Arbeit als Richter einem Freund oder etwa seiner Tochter einen Strafzettel für zu schnelles Fahren erlassen. Da war er unflexibel und kleinlich. Andererseits konnte er großzügig sein: Ein Soldat hat ihm in Korea den Fallschirm falsch gepackt, er öffnete sich nur halb. Als er an der Bar zufällig den Mann kennenlernte, der ihn beinah umgebracht hatte, lud er ihn auf einen Drink ein. Das war typisch für ihn.
Hatten Sie eine glückliche Kindheit?
Nein, sie war unglaublich ungemütlich. All die vielen Umzüge, als mein Vater noch bei der Armee war. Ich hab auch mal in Deutschland gewohnt, in Garmisch, ein Jahr lang, dann ging es weiter nach Thailand, aber ich war drei und kann mich kaum erinnern. Vor allem litten wir Kinder unter der Wut meines Vaters. Wir wussten immer, dass er sein Bestes gab und sich im Zweifel für uns auch vor ein Auto geworfen hätte. Das hat uns davon abgehalten, ihn für seine Wutausbrüche zu hassen. Er wurde weicher, als er in Pension gehen konnte und der finanzielle Druck nachließ. Ich frage mich oft, was ohne den Krieg aus ihm geworden wäre. Manchmal fürchte ich sogar, dass sich seine Kriegstraumata bis auf meinen Sohn vererbt haben könnten.
Auf den Enkel Ihres Vaters? Wie soll das gehen?
Es gibt doch Forschungsergebnisse der Epigenetik, die darauf hindeuten, dass Erfahrungen mitunter vererbt werden. Alles andere käme mir auch unlogisch vor: Wenn einem etwas Schlimmes zustößt, hinterlässt das sicher chemische Spuren im Gehirn. Aber jede Theorie wird durch die nächste versenkt. Alles ist ein großes Rätsel, nichts ist sicher. Außer der Liebe zu meinen Kindern. Und meinem Hund.
Wie bewusst vergleichen Sie jeden Ihrer Freunde mit Ihrem Vater?
Sehr. Oder lassen Sie mich das zurücknehmen: Es geschieht wahrscheinlich eher unterbewusst.
Schon in dem Augenblick, in dem Sie sich verlieben, oder erst wenn es ernst wird?
Sobald ein Mann seinen ersten Fehler begeht. So in etwa zwei Wochen nach dem Kennenlernen. Leider bin ich ein großer Anhänger von Ehrlichkeit und spreche die Dinge, die mir nicht passen, immer gleich an. Das ist nicht immer von Vorteil. Andererseits: Alles, was wir uns schulden, ist die Wahrheit.
Waren Ihre Freunde alle Ihrem Vater ähnlich?
Keiner. Doch, einer vielleicht. Über meinem Vater hörte ich ständig nur Gutes. Die Leute sagten alle, sie hätten nie gedacht, dass es Männer wie ihn tatsächlich gibt. Er war lustig, offen, an allem Möglichen interessiert und wollte in jedem Menschen nur das Beste sehen. Ich bin oft bei gebrochenen, kaputten Männern gelandet. Auch wenn man ihnen das nicht unbedingt auf den ersten Blick ansehen konnte und sie meist viel intakter und mehr bei sich wirkten als ich. Offenbar springe ich unbewusst auf Männer mit tief sitzenden Kindheitstraumata an. Menschen, die sich nicht voll verantwortlich für sich zeigen.
Sie haben als Kind gestottert.
Ja, als ich sehr klein war, auch mein Sohn hat eine Weile gestottert. Ich stottere immer noch gelegentlich, wenn ich wütend werde. Zuletzt gestern.
Sie waren ein schüchternes, eher ängstliches Kind.
Sehr hilflos. In Gesellschaft habe ich mich immer unwohl gefühlt. Ich bekam Herzklopfen, sobald ich das Klassenzimmer betrat. Ich fühlte mich in jeder Hinsicht unzulänglich, sogar unfähig, Freundschaften zu schließen. Meine Schwester war so hübsch, außergewöhnlich schön. Dazu noch charmant und charismatisch. Jeder flog sofort auf sie und liebte sie, das ist heute noch so. Für mich war sie immer das unerreichbare Idol. Ich dagegen fühlte mich überall fremd. Das steckt immer noch in mir drinnen. Wenn ich Leute näher kennenlerne, insbesondere Frauen, dann überreagiere ich heute noch oft, bin ganz aufgeregt und plappere ganz schnell.
Heute macht es Ihnen nichts aus, in Ihrem Buch preiszugeben, sechs Mal hintereinander Sex gehabt zu haben. Warum ist Ihnen das nicht mehr peinlich?
Ich wusste ja, was ich preiszugeben bereit war und was nicht. Ich schreibe über Beziehungen und ich kann ja nicht alles Schwierige oder Extreme weglassen, wenn ich will, dass der Leser mir als Erzähler glaubt. Sex kommt in dem Buch vor, aber daran finde ich nichts Anstößiges und ich habe auch keine Sexgeheimnisse preisgegeben.
Fällt es Ihnen leicht, über Sex zu schreiben?
Manchmal leicht, manchmal etwas schwerer, aber blockiert bin ich bei dem Thema nie. Über Sex zu schreiben ist natürlich eine Herausforderung. Genau wie ihn zu spielen. Meistens wird Sex auf der Bühne so gezeigt, dass jeder richtig Spaß dabei hat, hübsch aussieht und immer einen Orgasmus bekommt. Aber je spezieller die Schilderung, desto interessanter wird sie.
So ähnlich könnte sich auch ein Sex-Ratschlag von Ihnen in dem Männermagazin angehört haben – jede Routine vermeiden.
Durchaus. Es fiel mir merkwürdigerweise immer leicht, den richtigen Ton, die richtige Stimme in dem Männermagazin zu treffen. Ich habe dann auch mal probiert, für Frauenmagazine zu schreiben, aber da hieß es immer, mein Ton sei zu schroff.
Waren die Nacktbilder auch eine Herausforderung oder nur ein Spaß?
Die habe ich immer nur zum Spaß gemacht. Ich habe mich öfter nackt fotografieren lassen, zuletzt mit Mitte vierzig. Man sieht selten nackte Frauen in dem Alter. Warum eigentlich? Wir definieren in diesem Land sehr pingelig, was akzeptable Nacktheit etwa in der Kunst ist und was nicht. Ich verstehe die Aufregung darum nicht und weigere mich auch, die Sache so ernst nehmen. Nicht mal Sexszenen im Film finde ich schockierend. Mit der einen Ausnahme, dass Kinder das wirklich nicht sehen sollten, bevor sie nicht auch selbst Sex hatten. Ansonsten gehört Sex doch zum Leben, sogar zum besseren Teil des Lebens, und ist nichts, wofür sich irgendjemand schämen sollte.
Wen unter den Empfängern Ihrer Briefe würden Sie am liebsten noch einmal wiedersehen?
Meinen Vater natürlich. Auch meinen Mentor, Mike Nichols, und überhaupt meine vielen schwulen Freunde, die längst gestorben tot sind. Jeder vermisst die schwulen Künstler, die an Aids gestorben sind, aber niemand trauert um das schwule Publikum, das ausgelöscht wurde. Das Publikum im Ballett und in der Oper ist wie ausgewechselt. Eine ganze Generation, die Ahnung von Tanz und Musik hatte, alle weg.
Foto: Getty Images