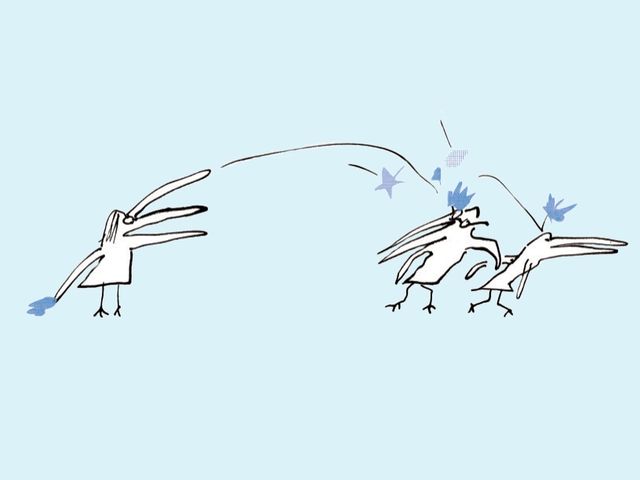Hallo Herr Cicero, lassen Sie uns gleich über die auffälligste Neuerung Ihres Albums Artgerecht reden: Statt ausschließlich Jazz spielen Sie nun auch Soul.
Genau.
Das scheint neu zu sein, ist für Sie aber eine Art Rückkehr, oder?
Es ist für mich so, als würde ich einen länger nicht mehr gesehenen Freund wieder herein bitten. Rückkehr würde heißen, dass Jazz und Swing Ausflugsprojekte waren, aber die gehören genauso zu meinen Wurzeln wie die Soulmusik.
Bevor Ihr großer Erfolg kam, haben Sie in einer Soulband gesungen.
Ja, mit der Soullounge habe ich einige Tourneen gemacht und auch auf zwei Platten mitgesungen.
Was waren Ihre Paradenummern?
Prince! Ich war der Prince-Experte in dieser Band.
Ich finde, dass es sehr schwierig ist, Soulmusik nachzuspielen und war überrascht, wie gut es Ihnen gelungen ist, den Modern-Soul-Sound der Siebziger zu imitieren. Wie haben Sie das hingekriegt?
Wir haben die Grundbesetzung der Big Band – acht Bläser plus Bass, Schlagzeug, Piano – genauso aufgenommen wie immer, nämlich gleichzeitig. Das ist von der Aufnahmeweise ähnlich, wie man es früher gemacht hat. Darum klingt es auch sehr homogen und nicht klinisch.
Welche Soul-Sänger haben Sie beeinflusst?
Mit Sicherheit Leute wie Ray Charles, Donny Hathaway, Al Green, George Benson und Al Jarreau. Am meisten aber Stevie Wonder. Ich habe viele Jahre eigentlich niemand anderes gehört.
»Ich habe mir früher Stunden über Stunden die Phrasierung von Stevie Wonder angehört und dann versucht, seine Schnörkel nachzusingen«
Haben Sie Stevie Wonder gesehen, als er letzten September in Deutschland gespielt hat?
Das war jetzt wohl eher eine rhetorische Frage! Stevie Wonder ist, glaube ich, der Künstler, den ich in meinem Leben am häufigsten live gesehen habe. Den lasse ich mir nicht entgehen, wenn er in der Nähe ist.
Ich habe einmal bei einer Karaoke-Party versucht, »I Just Called To Say I Love You« nachzusingen – und war überrascht, wie schwierig selbst diese scheinbar so simple Nummer ist, sobald man den Refrain hinter sich lässt.
Gut, aber für die Klasse von Stevie Wonder gibt es nun wirklich bessere Beweise als »I Just Called To Say I Love You«! Da gibt es viele Titel, die klingen total logisch, aber wenn man sich die Akkorde heraushört und die Stücke nachspielt, merkt man, dass da absolut unübliche Akkordwendungen verwendet werden, die man normalerweise nie so spielen würde. Bei Stevie Wonder klingen sie aber völlig selbstverständlich. Das ist eine große Stärke von ihm – eine von unschätzbar vielen. Stevie ist eines der letzten lebenden Genies.
Fast alle großen Soulsänger haben in der Kirche zu singen gelernt ...
... das war bei mir nicht so. Ich musste mir die tollen, in der Kirche geschulten Sänger rauf und runter anhören und mich von denen schulen lassen, außerdem durch Privatunterricht und Musikstudium.
Stelle ich mir trotzdem schwierig vor.
Soulgesang ist definitiv nicht einfach. Da kann man nicht einfach sagen, das mache ich jetzt mal. Ich habe mir früher Stunden über Stunden die Phrasierung von Stevie Wonder angehört und dann versucht, seine Schnörkel nachzusingen. Es hat teilweise sehr lange gedauert, bis ich auch nur in die Nähe von so einem Schnörkel kam.
Aber es kann ja nicht damit getan sein, andere Sänger nachzusingen.
Andere zu imitieren ist für einen Sänger absolut essenziell. Irgendwann muss man allerdings das Imitieren hinter sich lassen und seine eigene Stimme, seinen wahren Klang finden. Wenn man den hat, können die ganzen Sachen hineinfließen, die man von anderen Sängern gelernt hat – und dann klingt es auf einmal eigen.
Ein besonderer Hammer auf Ihrem Album ist das Stück »Ohne Worte«. So einen virtuosen Einsatz der Kopfstimme hört man selten! Ich frage mal ganz platt: Wie haben sie das gemacht?
Ich habe bei meinen Prince-Interpretationsausflügen festgestellt, dass ich eine ziemlich hohe Kopfstimme habe. Aber außer den Prince-Songs hatte ich keine Stücke, bei denen ich das ein wenig ausleben konnte. Fürs neue Album wollte ich unbedingt eine Nummer haben, wo ich die Kopfstimme anbringen kann. Es war dann aber recht schwer, das auf Deutsch zu machen. Das kommt nicht so wahnsinnig selbstverständlich über die Lippen.
Musikalisch gefällt mir Ihr Album gut, was ich allerdings inzwischen oll finde, sind Texte über männlich-weibliche Rollenklischees, getreu dem Motto: Mann glotzt Sportschau, Frau kauft Boutique leer. Wollen Sie dieses Terrain nicht lieber Mario Barth überlassen?
Ich finde, wir gehen anders mit diesen Themen um als Mario Barth. Und es sind nach wie vor lustige Geschichten. Natürlich wird da mit Klischees gespielt – aber ich sage ja nicht, dass es in jedem Haushalt so zugeht wie in den Liedern beschrieben.
Eines Ihrer neuen Lieder handelt von Online-Singlebörsen. Ich finde es verwunderlich, dass es so wenige Popsongs gibt, die vom Internet handeln.
Ja, ich habe noch keinen gehört.
Woran liegt das?
Das weiß ich auch nicht. Wir waren in dem Fall die ersten, die da zugeschlagen haben. Ich finde, das Thema gibt unglaublich viel her. Auch über Beschwerdehotlines könnte man viele Lieder schreiben.
Ihr Vater war ein bekannter Pianist. Was haben Sie von ihm gelernt?
Vor allem die Begeisterungsfähigkeit und die Leidenschaft für Musik. Das hat er mir vermittelt hat, indem er es vorgelebt hat. Wir haben sehr sehr häufig zusammen Musik gehört, im Auto zum Beispiel, und darüber gerdet. Er hat dann immer die prägnanten Stellen herausgehoben und mir erklärt, was er daran so toll findet. Dabei konnte er richtig ausflippen: »Mein Gott – hör dir das an – das ist ja der Wahnsinn – und da da da – oh, wie toll – jetzt jetzt jetzt!« Ich weiß nicht, ob ich mir als 14-Jähriger viel von Errol Garner angehört hätte, aber mit ihm zusammen war das ein Riesenspaß.
Beschreiben Sie genauer, was er Ihnen erklärt hat!
Es ging ihm zum Beispiel um Dynamik, Aufbau und Spannungsbögen. Was er sagte, hat mir eingeleuchtet, und ich dachte, jaja, klar, logisch. Erst viele Jahre später ist mir klar geworden, dass das sehr besondere, eigene Ansichten waren, die er mit mir geteilt hat. Da hat er mir viel hinterlassen.
Der Jazz gilt als heutzutage als elitär. Zu Recht?
Definitiv gibt es im Jazz einige Künstler, deren Musik nur sehr, sehr wenige verstehen – teilweise sogar nur andere Musiker. Manche verteidigen das sehr militant, die haben in der Szene den Beinamen »Jazz-Polizei«. Die sogenannte Jazz-Polizei mag es gar nicht, wenn man jazzige Musik für ein etwas breiteres Publikum macht, indem man nicht ganz so komplizierte Sachen spielt. Da kriegt man von der Jazzpolizei auf den Deckel.
Sie auch?
Ich hatte aus diesem Lager viel mehr Widerspruch erwartet und war überrascht, als der ausblieb. Von meinen früheren Kollegen habe ich viel Anerkennung bekommen. Endlich trifft es mal einen von uns, haben viele gesagt.
Man hätte vermuten können, dass ihr Erfolgsrezept kopiert wird und eine Welle von Swing-Sängern über uns hereinbricht. Warum ist das ausgeblieben?
Wir haben selbst mit mehr Nachahmern gerechnet. Der Punkt ist aber: Mein Sound ist nicht so leicht zu imitieren. Es ist nicht mal eben so ratzfatz gemacht. Unsere Produktionen sind sehr aufwändig, da steckt viel Arbeit drin, viel Knowhow. Die üblichen Verdächtigen, die sonst irgendwelche Hitrezepte kopieren, sitzen zu Hause am Rechner. Aber eine Big Band kann man nicht eben mal im Schlafzimmer zusammenbasteln.
Sie hatten in den letzten drei Jahren unglaublichen Erfolg, haben über eine Million CDs verkauft. Falls dieser Erfolg nun aber nicht dauerhaft anhalten sollte – treten Sie dann wieder im kleinen Jazzclub an der Ecke auf?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals leben kann, ohne auf der Bühne zu stehen. Das ist das, was ich liebe und was ich mache. Damit werde ich bestimmt nicht aufhören.
Im Jazz kann man gut altern.
Ja, aber in anderen Stilen geht das auch. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man bei sich bleibt und etwas tut, das man wirklich gerne macht. Ich habe neulich Prince gesehen in London, das war wirklich phänomenal.
Das waren diese Konzerte in der O2-Arena, oder?
Ja. In dem Fall war mir völlig klar, dass ich unbedingt eines dieser Konzerte sehen muss, weil niemand weiß, ob Prince je wieder eine Tour spielen wird; er weiß es wahrscheinlich selbst nicht. Das Konzert war unglaublich. Er hat auch die ganzen alten Hits gespielt und man hat keine einzige Sekunde gedacht, oh, das ist jetzt aber peinlich.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten: Mit welchem Musiker würden Sie gerne einmal zusammenspielen?
Also, nur mal so rumgesponnen: Prince und Stevie Wonder sind schon Leute, die ich unfassbar verehre.
Prince an der Gitarre und Stevie an den Keyboards?
Ach ja. (seufzt) Das wäre fett.
Roger Ciceros Album "Artgerecht" (Warner) erscheint am 3. April.
Fotos: Sven Sindt