Trost vom Showgirl: Schon nach dem ersten Tag steckt Alexandros Stefanidis 4000 Dollar in den Miesen und würde am liebsten wieder abreisen.
Ich brauche noch etwas Zeit. Um mich an die Umgebung zu gewöhnen: an die Filztische mit dem gepolsterten Rand und den zylinderförmigen Einlassungen für Getränke, an die Kartengeber im Smoking, an die herumwuselnden Kellnerinnen in Nylonstrümpfen und schwarzen Miniröcken, an die Ansagen aus den Lautsprechern, über die alle paar Minuten der Name eines Gasts ausgerufen wird, mit der Bitte, sich bei Tisch 23 oder 27 oder 43 zu melden. Vor allem muss ich mich aber an meine Gegenspieler mit den Kapuzen und verspiegelten Sonnenbrillen, an die amerikanischen Pokerbegriffe und an die höheren Beträge gewöhnen, um die hier gespielt wird. Denn sonst sitze ich mit Freunden und Bekannten immer an einem Küchentisch in München, paffe eine Zigarre und spiele den ganzen Abend um ein paar Euro. Vor zwei Stunden habe ich aber an Tisch Nummer 18 im »MGM Grand Hotel« in Las Vegas Platz genommen und in der Tischmitte liegen 3500 US-Dollar. Ich habe zwei Könige auf der Hand. Profis nennen diese Hand »Monster«, weil sie kaum zu schlagen ist. Trotzdem rast mein Puls. Ich versuche, ruhig zu atmen, aber dennoch spüre ich, wie das Hemd auf meiner Brust in schnellem Rhythmus bebt. Ein aufgeregtes, pumpendes Herz lässt sich nicht abschalten.
Kurz zuvor habe ich 400 Dollar gegen den Typ mit der T-Shirt-Aufschrift »I’m from Tel Aviv, Iran is our enemy« verloren, der mich mit seinen hervorquellenden Augen an Mesut Özil erinnert. Aber jetzt kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Jetzt darf auch nichts mehr schiefgehen – denn ich habe mein ganzes Geld gesetzt, 1750 Dollar, ich bin »all in«.
Mein Gegenüber ist ein hagerer alter Mann, auch er hat 1750 Dollar gesetzt. Mit seinem Herz scheint alles in Ordnung zu sein, aber ich hatte schon die ganze Zeit Mitleid mit ihm, weil seine Hände immer zittern, wenn er Chips in die Mitte schiebt. Dass sie nun nicht zittern, sollte mir vielleicht zu denken geben. Aber ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, meine Erregung zu verbergen, und überdies viel zu sicher, das stärkere Blatt in der Hand zu halten; schließlich gibt es nur eine einzige Anfangs-Hand, die noch stärker ist als zwei Könige. Zwei Asse, auch »Pocket Rockets« genannt. Dagegen sieht selbst ein Monster niedlich aus. Aber ich begreife das alles erst, als es längst zu spät ist. Mit einem breiten Grinsen deckt der Zitterer seine beiden Asse auf und streicht wenige Sekunden später den Gewinn ein. »Bad luck«, sagt der Alte. »Zwei Könige treffen nur selten auf zwei Asse.«
Mit dem schwer zu beherrschenden Gefühl, mein Geld unglücklich verloren zu haben, es wieder zurückgewinnen zu wollen, gehe ich von da an mehr Risiko, fange an zu bluffen und mache Fehler, die gnadenlos von den Mitspielern ausgenutzt werden. Ich verliere weitere 1800 Dollar, die ich – nach der Niederlage gegen den Zitterer – aus dem Geldautomaten gezogen habe. Um vier Uhr morgens steige ich niedergeschlagen in den Fahrstuhl. Und als der in Sekundenschnelle in den obersten Stock des Hotels fliegt, wird mir fast schlecht. Ich schließe die Tür auf, gehe auf die wandbreite Glasfront meines Zimmers zu und blicke stehend K. o. auf den Las Vegas Strip, der blitzt und funkelt, als wäre gar nichts passiert.
Dabei hatte ich mir Tage zuvor alles so schön ausgemalt. Mein Traum: eine Woche Pokern in Las Vegas. Weg vom Küchentisch in München, mitten rein in die Hauptstadt des Pokerns. Ein großer Tisch, Legenden wie Doyle Brunson oder Phil Hellmuth zu meiner Linken, Hollywoodstar Ben Affleck – ein passionierter Spieler – rechts von mir, und ich pokere endlich mit in der Champions League. Hier mal ein lockerer Spruch, da mal ein Bluff, Gewinn einstreichen, herrlich. Dieser Traum hat mich blind gemacht. Ich habe nämlich die verdammte Hauptregel beim Pokern nicht beachtet: Halte dir immer einen Ausweg offen.
Am Strip leuchtet die Miniatur-Nachbildung der Freiheitsstatue vor der Skyline des Hotels »New York«, gegenüber das »Excalibur«, eine Ritterburg mit roten und blauen Türmen, dahinter das »Luxor«, eine dunkle Pyramide. Nichts passt in dieser Wüstenstadt zusammen. Wie falsch das alles aussieht. Ein riesiges Durcheinander. Meiner Frau habe ich hoch und heilig versprochen, mit dem Zocken aufzuhören, wenn mein geplantes Poker-Budget von 2000 Dollar für die Woche aufgebraucht ist. Aber ich bin kaum einen Tag da, und stecke nicht 2000, sondern bereits 4000 Dollar in den Miesen. Mir wird wieder flau im Magen.
Für den nächsten Tag habe ich mir eine Pause verordnet. Mit Vince, einem Spieler, den ich gestern kennengelernt habe, fahre ich zum Grand Canyon. Es ist so heiß, dass jeder Atemzug in der Nase brennt. Vince ist Anfang 50, wohnt in einem amerikanischen Vorort-Häuschen mit akkurat gestutztem Rasen, ist verheiratet, hat zwei Töchter und fährt einen Jeep, in den locker noch zwei weitere Kinder passen würden. Aber als er vor 30 Jahren seiner Highschool-Liebe Sharon offenbarte, dass er professioneller Pokerspieler werden will, haben sie beschlossen, dass zwei Kinder reichen. Im Monat, sagt Vince, macht er im Schnitt etwa 2000 bis 3000 Dollar Gewinn. Steuern zahlt er nicht. Als wir zum Stausee Lake Mead fahren, um uns bei einem Bad etwas abzukühlen, erklärt mir Vince seine Strategie: Zunächst beobachtet er die Tische im Casino. Er wählt einen Tisch mit geringen Einsätzen (1 bis 3 oder 2 bis 5 Dollar) aus, an dem er einen oder mehrere Touristen vermutet, und geht anderen Profis aus dem Weg. Man kennt sich. Sharon kocht ihm Gemüsesuppe, die er in einer Thermoskanne neben sich platziert. Sobald er das Dreifache seines Einsatzes gewonnen hat, steht er auf und geht. Manchmal dauert das die ganze Nacht.
»Du schläfst nicht viel, oder?«
»Ich brauch nicht viel Schlaf.«
»Geht’s dir beim Poker nur ums Geld?«
»Nein. Geld ist nur ein Indikator für Erfolg. Poker ist Wettkampf in seiner reinsten Form. Wie ein Revolverduell im Wilden Westen – nur ohne Kugeln. Es ist egal, wer du bist. Oder was du bist. Am Pokertisch sind alle Menschen gleich. Es geht nur darum, den anderen fertigzumachen, bevor er dich fertigmacht. Der American Way of Life.«
Als er mich abends vors Hotel fährt und mich aus seinem Wagen entlässt, sagt Vince: »Denk dran, studiere deine Mitspieler, schau, wo ein Kentucky Fried Chicken sitzt, also ein Tourist mit viel Kohle, aber mittelmäßigem Spiel, und nimm ihn aus, so gut du kannst. Machst du das nicht, gehst du unter. Du hast dir einfach die schlechteste Zeit zum Pokern in Las Vegas ausgesucht.«
Ich blicke ihn verständnislos an.
»Sag mal, weißt du das wirklich nicht?«
»Was denn?«
»In ein paar Tagen beginnt die Weltmeisterschaft. Zurzeit sitzen die Besten der Welt an den Casino-Tischen. Kein Honigschlecken.«
Na, servus! Wie konnte ich das nur übersehen?
Die populärste Pokerspielvariante, die an den Casino-Tischen in Vegas gespielt wird, trägt den Namen »Texas Hold’em«. Die Regeln: Jeder Spieler bekommt zwei Karten, verdeckt. Nacheinander werden danach fünf Gemeinschaftskarten in der Tischmitte aufgedeckt. Zuerst drei, dann jeweils eine. Diese Karten heißen Gemeinschaftskarten, weil sich damit jeder Spieler sein Blatt zusammenstellen kann. Die zwei verdeckten Karten »auf der Hand« und drei beliebige Karten aus der Tischmitte bilden am Ende das persönliche Pokerblatt. Das Besondere: Bei keinem anderen Spiel wechselt das Glück so schnell und so oft die Seiten, weil durch die nacheinander aufgedeckten Gemeinschaftskarten ein nahezu todsicheres Gewinnerblatt innerhalb von Sekunden seinen Wert einbüßt. Der Spieler verliert zuerst seine Chips und anschließend seinen Verstand.
An meinem dritten Tag in Vegas spiele ich elf Stunden durch, Pausen mache ich nur, um zu essen, die meiste Zeit warte ich – streng nach Lehrbuch – auf gute Karten. Natürlich könnte ich auch mit »schlechten Karten« setzen, etwa einer Sieben und einer Zwei, aber das Risiko, mit dieser Kombination zu verlieren, ist ungleich höher, als mit zwei Buben oder einem Ass und einem König auf der Hand. »Anna Kurnikowa« nennen Pokerspieler diese Hand. Sieht gut aus, verliert aber oft. Wie die ehemalige Tennisspielerin. Und mit Anna Kurnikowa verliere auch ich. Gegen König-Neun. Ein König wird gleich am Anfang aufgedeckt. Die Neun kommt als letzte Karte. Der Typ, ein junger Kerl in Shorts und Flipflops, höchstens 25 Jahre alt, ist alle meine Erhöhungen mitgegangen, weil er dachte, ich bluffe. Ich lag aber die ganze Zeit vorn – bis die letzte Karte kam. Er streicht den Pot über 1400 Dollar ein, steht sofort auf und geht. Zwei Mitspieler buhen ihn leise aus. Er lächelt nur. Schwer zu ertragen.
Auf dem Weg zum Fahrstuhl komme ich geschätzt an 20 Bankautomaten vorbei. Alle zehn Meter ein Automat. Der Weg soll nicht lang sein für die Casino-Gäste. Ich fische die EC-Karte aus meiner Brieftasche. Dann denke ich an meinen momentanen Kontostand. Minus 4500 US-Dollar. Und stecke sie wieder zurück. Genug für heute. Oben setze ich mich auf die Bettkante und schalte den Fernseher ein. Es läuft eine Meisterschaft im Rülpsen. Der Rekord liegt bei fast 20 Sekunden. Der Sieger erhält einen überdimensionalen Scheck über 5000 Dollar. Neidisch schaue ich auf den Bildschirm – und versuche mein Glück: 2,8 Sekunden.
Baden Baden - Las Vegas
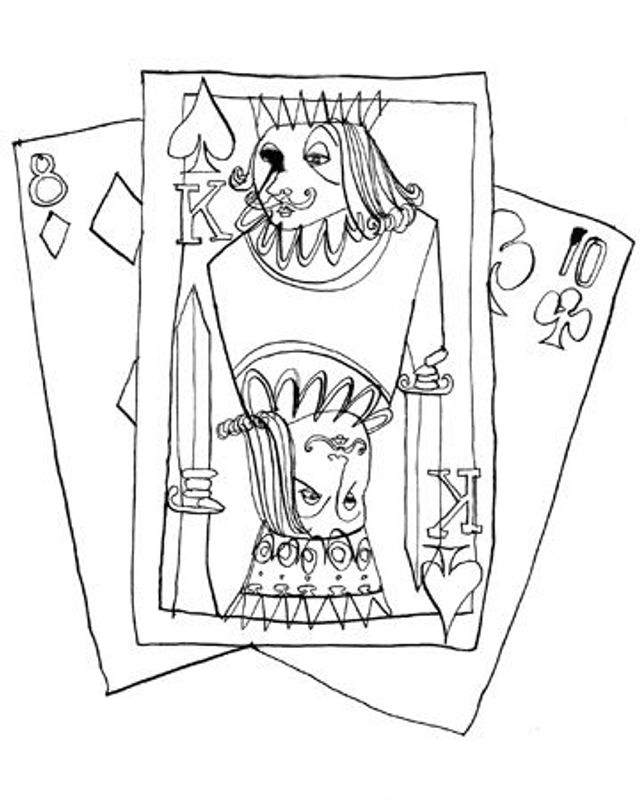
Der Hollywood-Streifen Rounders mit Matt Damon zählt zu den besten Pokerfilmen. Er beginnt mit diesem Zitat: »Pass auf, ich sag dir, wie’s läuft! Wenn du nicht innerhalb der ersten halben Stunde am Tisch erkennst, wer von den anderen der Dumme ist, dann bist du der Dumme.« Ein Satz für die Annalen des Spiels. In den vergangenen Tagen habe ich mich oft gefragt, ob ich der Dumme war und es nur nicht gemerkt habe. Mein Kontostand schreit laut: Ja! Analysiere ich allerdings mein Spiel, ist die Antwort nicht so eindeutig. Schließlich bin ich kein blutiger Anfänger. Ich spiele Poker, seit ich sieben Jahre alt war. Mein Vater war – bis ihn meine Mutter vor mehr als 20 Jahren zur Vernunft gebracht hat – ein richtiger Zocker. Er spielte täglich. Als ich 2006 für ein Magazin über den aufkommenden Pokerboom in Deutschland im Casino Baden-Baden recherchierte, fragte mich der technische Direktor des Hauses, ob ich einen Mann namens Christo kenne, wir hätten nämlich denselben Nachnamen. Als ich ihm antwortete, er sei mein Vater, lud mich der zuvor etwas steif wirkende Mann im Dreireiher spontan zu einem Drink ein und erzählte mir freudestrahlend Geschichten von früher. »Ihr Vater ist hier eine Art Legende«, sagte er und fragte: »Spielen Sie auch?« – »Nein, ich bin nur bei ihm in die Lehre gegangen.«
Im Gegensatz zur gediegenen Atmosphäre in Baden-Baden ist der charakteristische Klang eines Las-Vegas-Casinos nicht das Klirren der Eiswürfel in einem Cocktailglas. Es ist ein helles, fast blechernes »Ping«, der lechzende Ruf eines einarmigen Banditen, der sich nach Dollarnoten sehnt. Multipliziert man dieses Ping mal tausend, streut ein paar grelle Sirenen dazu (Zeichen eines eher kleinen statt großen Gewinns), entsteht eine pausenlose Ping-Ping-Sirene-Ping-Ping-Schießerei, die man nach wenigen Stunden nicht mehr hört oder gar – wie etwa Vince – für »total natürlich« hält.
Gerade warte ich darauf, dass ein Platz an einem der Pokertische im »Aria«-Hotel frei wird. Außen ein 54-Stockwerke-Hochhaus aus Glas, innen mehrere tausend Quadratmeter mit Roulette-, Black-Jack- und Würfeltischen und unzähligen Banditen. Von denen lächeln die Stars aus Filmen wie Sex and the City, Batman oder Frühstück bei Tiffany. Das Pokerangebot: Mehr als 50 Tische, alle voll besetzt. Selbst die mit den Mindesteinsätzen von 2000 Dollar pro Spiel. Als mein Name für einen der Fünf-Dollar-Tische aufgerufen wird, es ist gegen 19 Uhr, habe ich – meine Regeln für diesen Las-Vegas-Trip abermals brechend – tausend Dollar aus dem Automaten gezogen. Das ist deine letzte Chance, nimm irgendein Kentucky Chicken auseinander. Du kannst nicht immer nur Pech haben. Hab Geduld. Warte auf gute Karten. Halte dir immer einen Ausweg offen – fast jede erdenkliche Phrase, die meine Regelverletzung rechtfertigt, bricht als Glückskeksspruch in meinem Kopf auf. Als ich Platz nehme, sehe ich Vince am Nebentisch sitzen. Vor ihm ein großer Stapel bunter Chips. Kein Hallo. Er nickt nur. Ich nicke zurück. Pokerprofis machen das so. Ich beginne sofort meine Mitspieler zu studieren: Die meisten tragen eine Sonnenbrille, vier haben eine Kapuze über den Kopf gezogen. Da ist nicht viel zu holen. Aber mir gegenüber sitzt ein beleibter Amerikaner, der ein bisschen Bill Clinton ähnelt: Gerötete Pausbacken, ein freundliches Gesicht mit vielen Lachfalten um die Augen. Er trägt eine Kappe des Basketballclubs Minnesota Timberwolves, ist Versicherungsmakler, stammt aus einem Ort namens Maple Grove und prahlt damit, dass er zu Hause jede Pokerrunde gewinnt. Endlich, ein Minnesota Fried Chicken.
Punkt Mitternacht habe ich dank Clinton meine tausend Dollar verdreifacht. Er flucht und schimpft, ich aber denke an Vince, schaue mich um, er hat seinen Platz schon verlassen. Einsatz verdreifacht. Aufstehen. Gehen. Das würde Vince jetzt tun. So machen es die Profis. Eigentlich ganz einfach. Aber Clinton macht trotz hoher Verluste keine Anstalten zu gehen – und ich wäre doch dumm, wenn ich mir die Chance entgehen lassen würde, ihn noch mehr auszunehmen, oder?
In Geständnisse eines Pokerspielers schreibt der frühere Pokerprofi Jack King 1940: »So komisch es klingt, nur wenige Spieler wissen noch, dass sie mal einen großen Pot gewonnen haben. Aber an die Rückschläge erinnern sie sich noch bis ins kleinste Detail.« King hat Recht.
Gegen drei Uhr morgens – in den letzten Stunden hat sich nicht viel getan – sitze ich vor meinem Stapel Chips und staune über meine Hand: Pocket Rockets, zwei Asse. In der Tischmitte liegen 90 Dollar und drei bereits aufgedeckte Gemeinschaftskarten: Kreuz König, Herz Sieben, Karo Dame. Zwei Spieler sind noch mit dabei: Clinton und ein braungebrannter Mann mit grauen Locken und einer Nickelbrille auf der Nase, Typ: lässiger Mathematikprofessor aus Berkeley. Ich setze 90 Dollar. Die Nickelbrille geht mit. Clinton fasst sich an die Nase und erhöht auf 200 Dollar. Normalerweise wäre das ein Grund zum Jubeln. Aber irgendetwas stimmt hier nicht. Clinton muss wissen, dass ich ein starkes Blatt in der Hand halte. Warum erhöht er? Und welches Spiel spielt die Nickelbrille? Der würdigt mich keines Blickes, starrt nur auf die Karten. Bisher hat er sehr vorsichtig gesetzt, kein gutes Zeichen. Andererseits habe ich ihn ein paar Hände zuvor bei einem Bluff erwischt und ihm 220 Dollar abgenommen. Auf ihn muss ich aufpassen. Mein Blick schweift weiter zu Clinton, der bei einer Kellnerin gerade eine Cola bestellt. Laufe ich hier geradewegs in eine Falle? Halte dir einen Ausweg offen, höre ich meine innere Stimme sagen, und gehe nur mit. Die Nickelbrille überlegt nicht so lang wie ich, er setzt ebenfalls 200. Der Kartengeber deckt die vierte Karte auf: Pik Ass! Nickelbrille rührt sich nicht. Clinton nimmt seine Kappe ab und kratzt sich am Hinterkopf. Ruhig greife ich in meinen Chipsstapel. In der Tischmitte liegen 700 Dollar. Ich setze 600. Ein deutliches Signal: Jungs, verschwindet hier, ich habe die beste Hand. Der Professor lehnt sich zurück, ich glaube schon zu sehen, wie er seine Karten wegwirft. Aber dann höre ich nur: »All in.« Er hat gerade zusätzlich zu meinen 600 Dollar weitere 1800 ins Spiel gebracht. Und was tut Clinton? Blitzschnell schiebt auch er alle seine Chips in die Mitte, wo nun knapp 6000 Dollar liegen müssten. Ich knete meine Hände und presse meine Augen zu Schlitzen. Auf dem grünen Filz liegen ein König, eine Sieben, eine Dame und ein Ass, alles unterschiedliche Farben. Ich habe drei Asse, aber was haben die beiden anderen, die alle ihre Chips bereits gesetzt haben? Die möglichen Varianten vibrieren in meinem Schädel. Die einzige Hand, die mich im Moment schlägt, ist die Kombination Bube-Zehn, eine Straße.
Es ist meine letzte Nacht in Vegas. Wenn ich mitgehe und gewinne, streiche ich 8000 Dollar ein. Wenn ich verliere, habe ich nichts mehr und verlasse die Stadt als geprügelter Hund. Ist das also die große Chance, auf die ich seit Tagen warte? Alle Blicke am Tisch sind auf mich gerichtet. Am liebsten würde ich schreien, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann, ganz plötzlich, fällt mir mein Vater ein. »Lass dich nie vom Geld verführen«, hatte er mir einst eingebleut. »Vertraue deinen Instinkten. Beim Pokern spielt man nie die Karten auf dem Tisch, sondern nur die Gegner.« Ich schaue also noch mal zur Nickelbrille (immer noch keine Regung) und zu Clinton (angedeutetes Grinsen) – und lege schließlich meine beiden Asse weg. »I’m out«, rufe ich. Enttäuscht, mit hängenden Mundwinkeln, dreht die Nickelbrille einen Buben und eine Zehn um. Richtig entsetzt ist er aber, als auch Clinton Bube-Zehn offenbart. Die beiden müssen sich den Pot am Ende teilen, die letzte Karte ist eine Herz-Zwei. »Ich hatte zwei Asse auf der Hand«, sage ich, aber alle lachen nur. Deshalb bitte ich den Kartengeber meine beiden Asse aufzudecken. »Wie konntest du so ein starkes Blatt nur wegwerfen?!«, ruft die Nickelbrille kopfschüttelnd. Auch Clinton ist außer sich: »Das gibt’s doch nicht!«, johlt er. Obwohl ich eben fast tausend Dollar verloren habe, war das mein bestes Spiel in Vegas. Ich habe mir einen Ausweg offen gehalten und den totalen Bankrott vermieden. Wie hat es Doyle Brunson einmal formuliert: »Die Kunst liegt nicht darin, einen großen Pot zu gewinnen. Die Kunst ist, deine Karten im richtigen Moment abzulegen.«
Der Nickelbrille nehme ich im darauffolgenden Spiel mit zwei Siebenen auf der Hand und einer in der Tischmitte knapp 1400 Dollar ab, er hat nur zwei Damen. Und Clinton setze ich mit einer Fünf und einer Drei schachmatt. Er hält Anna Kurnikowa, trifft nicht, erhöht aber ständig, um mich aus dem Spiel zu bluffen. Ich aber halte zwei Paare. 1600 Dollar. Als ich kurz vor sieben (mein Flug zurück nach München geht um halb zehn) an der Kasse meine Chips einlöse, zählt eine freundliche Frau 43 Hundert-Dollar-Scheine. Ich streiche sie vom Tresen, klappe das dicke Bündel in der Mitte zusammen und stecke es in die Hosentasche.
Man hört in der Regel nicht sehr viel über Typen, die etwas riskiert haben und gescheitert sind. Ich glaube, ich weiß mittlerweile, was aus ihnen wird: Sie schuften ein Leben lang für wenig Geld in Jobs, die sie nicht mögen, und denken ständig daran, wie es dazu kommen konnte. Ich hab sie in den letzten Tagen häufig gesehen, diese Leute. Wie sie am Tisch sitzen, Clinton etwa, den Buckel gekrümmt, vom Pech verfolgt, fast alles verloren – und wie sie dann in ihrem letzten Spiel auf die rettende Karte hoffen. Ich hab mich immer gefragt, wie man nur in solch eine Situation geraten kann. Und wie zum Teufel man da wieder rauskommt. Viele träumen davon, in Las Vegas reich zu werden. Die meisten scheitern. Vielleicht hatte ich nur Glück. Mein Traum endet mit dem Verlust von knapp 1200 Dollar (etwa tausend Euro). Und, unter uns: Ich halte das inzwischen für einen Erfolg.
POKERN
Profis geht man am besten aus dem Weg, wenn man sich für ein Tagesturnier einschreibt, etwa im »Caesars Palace«. Täglich um 15 Uhr. Einsatz 70 US-Dollar, Anmeldung direkt im Hotel.
ESSEN
Das beste Fischlokal der Stadt: »American Fish«. Reservierungen unter: http://www.arialasvegas.com/en/dining/restaurants/american-fish
SCHLAFEN
Das »Aria Resort & Casino« liegt direkt am Strip; www.arialasvegas.com/de, DZ ab 100 Euro.
Foto: Sabina McGrew; Illustration: Daniel Egnéus

