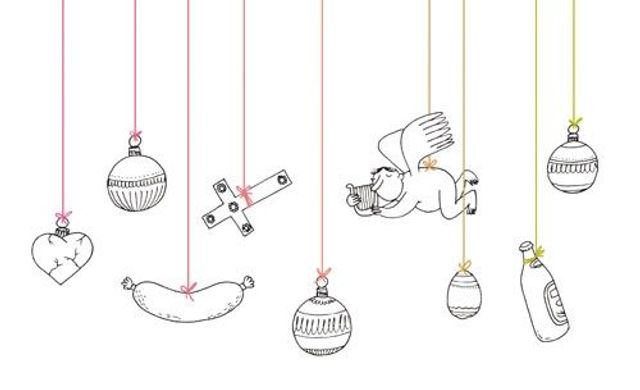Weihnachten ist für die meisten von uns insofern ein seltsames Fest, als sie einerseits nicht so richtig an Gott glauben, andererseits mit großem Aplomb die Geburt seines Sohnes feiern. Das ist ein bisschen irre, aber gerade deshalb passt es gut zu uns. Wir sammeln ja im Frühjahr auch Eier, die ein Hase gebracht hat, halten es für ein gutes Werk, getragene Jacken in Altkleidercontainer zu werfen, von wo sie als Billigware auf afrikanische Märkte gelangen, um so die einheimische Bekleidungsindustrie zu ruinieren, und besichtigen guten Gewissens Weihnachtsgeschenke in Geschäften der Innenstadt, um sie dann für fünfzig Cent weniger beim Versandhändler zu kaufen. Ganz ernst kann man uns also nicht nehmen.
Was aber nun Weihnachten angeht, so gibt es einfach ein Grundbedürfnis des Menschen nach Ritualen, wiederkehrenden Festen und gewissen Höhepunkten im Alltagslauf, dem die Kirche perfekt entspricht, wenn man mal von diesem störenden Dauerhinweis auf Gott absieht: Gäbe es nur die Feste, die sonntäglichen Zusammenkünfte, die Lieder und die guten Werke – das alles wäre großartig auch für jene, die an keinen Gott glauben können, aus verschiedensten Gründen.
Was sollen der Atheist, auch der Agnostiker, denn Weihnachten tun? Auch sonntags? Sie möchten feiern, singen, Leute treffen, Angehörigen Geschenke machen, sie möchten in angemessenem Rahmen heiraten und stilvoll begraben werden. Sie wollen nicht einsam ihrem Unglauben anhängen, sondern so glücklich, optimistisch und tendenziell gesünder sein wie die meisten Kirchgänger es allerhand wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge sind.
Zwei Möglichkeiten: Man macht in der Kirche mit, schlawinert sich durch, betrügt sich selbst und hofft, es merkt keiner, dass man in Wahrheit ein Zweifler ist. Oder man gründet eine neue Kirche, eine Gemeinschaft ohne Gott, die alles bietet, was die richtige Kirche auch hat, Feiertage, alle sieben Tage eine schöne Zusammenkunft, Musik und Geldsammlungen für allerbeste Zwecke. Genau das haben die Briten Pippa Evans und Sanderson Jones getan: Sie haben die Sunday Assembly gegründet, die Sonntagsversammlung, Anfang des Jahres in einer ehemaligen Kirche Nord-Londons – warum? »Um Sorgen zu trösten, zur Güte anzuspornen und dem Alltag etwas mehr Glanz zu geben.«
Der Zulauf ist beträchtlich. Die Hütte ist voll, jeden Sonntag, und zurzeit befinden sich die beiden auf Missionsreise um die Welt; in dreißig, vierzig Städten Englands, Irlands, Kanadas, der USA und Australiens gibt es bald schon Ableger des Londoner Stammhauses. Wen wundert’s? Die Sache liegt im Trend der Zeit, wir haben das Bier ohne Alkohol erfunden und das Essen ohne Fleisch, es gibt Milch ohne Fett und, die größte Sensation!, genfreien Mais, auch Politik ohne Ziel und Idee, die nur noch Management des Alltäglichen ist. Wir entziehen den Dingen, was wir nicht wollen, und nutzen nur, was wir brauchen. Wir sind die größten Pragmatiker der Weltgeschichte, und kommt uns die Sehnsucht nach Übersinnlichem an, nennen wir unser Fitness-Training Yoga und glauben von 18 bis 19 Uhr an die Zügelung aller Begierden.
Natürlich ist die Idee einer Kirche ohne Gott nicht neu. In der Französischen Revolution machten sie aus Notre-Dame den »Tempel der Vernunft«, Auguste Comte, Begründer der Soziologie, glaubte an eine »Religion der Menschlichkeit«, und in der DDR feierte man statt Konfirmation Jugendweihe. Der Mensch entkommt sich selbst und seinen Bedürfnissen nie, und wahrscheinlich ist ja auch der Glaube an Gott eher Ausdruck einer Sehnsucht als einer Wahrheit. Damit muss jeder selbst zurechtkommen heute, so gut er kann und will.
Was die Sunday Assembly angeht, so freuen wir uns ihrer Geburt, warten auf die Ernennung des Oberhaupts als Stellvertreter des Nichts auf Erden und darauf, welches das Buch der Bücher dieser Kirche sein wird. Und feiern jetzt erst einmal ein frohes Fest. Wie auch immer.
Illustration: Dirk Schmidt