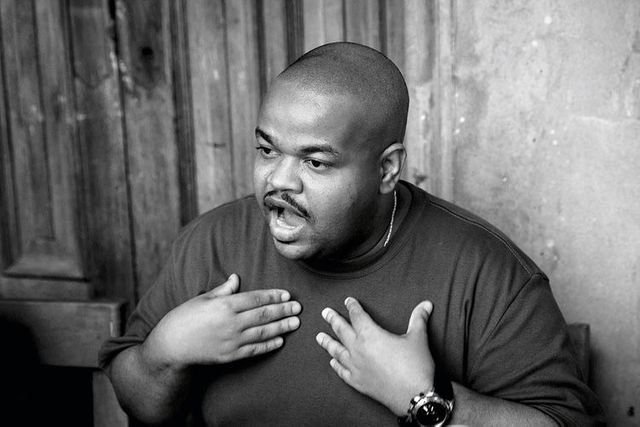Unten am Meer, an den Stränden von Copacabana oder Ipanema, scheint der Atlantik direkt in die sanft geschwungenen Hügel überzugehen. Halbnackte Menschen joggen die Promenade entlang, fliegende Händler bieten Garnelen und gekühlte Getränke an. Doch das schöne Leben ist nur ein paar Blocks von den mehr als tausend Armensiedlungen entfernt, denen man den Namen einer Kletterpflanze gegeben hat: Favelas. Man muss sich als Tourist nur ein bisschen verlaufen, schon liegen am helllichten Tag verwahrloste Menschen auf dem Gehsteig, von denen man nicht weiß, ob sie noch leben. In Rio de Janeiro werden jedes Jahr mehr als 4000 Menschen ermordet. Kurz vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft (und zwei Jahre vor den Olympischen Spielen) hat die Stadt zu kämpfen: In Erwartung der beiden Großereignisse versucht die Militärpolizei, die Drogenkartelle aus einigen Favelas zu vertreiben und Friedenseinheiten zu stationieren. »Rio soll wie München werden«, hatte die Stadtregierung lange vor der Fußball-WM als Losung ausgegeben und eine Vielzahl von Verboten und Verordnungen erlassen. Die Proteste und Demonstrationen während des Confederations Cup 2013 haben gezeigt, dass dies auch privilegierte Teile der Bevölkerung als Kampfansage verstanden haben. Dazu kommt, dass viele Menschen nicht mehr bereit sind, korrupte Beamte, explodierende Preise und das Verkehrschaos zu akzeptieren. Viele Cariocas – so heißen die Einwohner Rio de Janeiros – haben Angst um die Seele ihrer Stadt. Höchste Zeit also für ein Stadtgespräch.
Eingeladen haben wir unsere Gäste in das Café im Parque Lage, in eine alte Villa im Kolonialstil am Rand des Botanischen Gartens. Vor einigen Monaten wurde hier der offizielle Spielball für die Fußball-WM vorgestellt.
14.45 Uhr: Ivo Pitanguy betritt den Innenhof der Villa, im Anzug, mit Krawatte und Einstecktuch. Hinter ihm geht ein Leibwächter, ebenfalls im dunklen Anzug. Die Gespräche an manchen Tischen verstummen, andere Gäste tuscheln. In Brasilien ist der Schönheitschirurg eine Legende.
SZ-Magazin: Guten Tag, Herr Pitanguy, schön, dass Sie gekommen sind, sogar in Anzug und Krawatte – bei der Hitze.
Ivo Pitanguy: Ach, die Krawatte trage ich nur, weil ich nachher in die Academia Nacional de Medicina muss, da bin ich inzwischen das älteste Mitglied. Wissen Sie, für mich ist Rio die schönste Stadt der Welt, aber München ist auch nicht schlecht. Ich kenne die Stadt ganz gut, die Isar, den Englischen Garten, wirklich schön, und fast jeder spricht Englisch.
Ist es hier in Rio denn so anders?
Pitanguy: Allerdings, aber Brasilien ist auch groß, die Menschen reisen viel weniger ins Ausland als ihr Europäer.
Es ist jetzt sechzig Jahre her, dass Sie die ersten Schönheitsoperationen durchgeführt haben. Wie hat sich das brasilianische Schönheitsideal seitdem verändert?
Pitanguy: Früher wollten die Frauen kleinere Brüste, heute wollen sie große. Im Grunde gibt es kein brasilianisches Schönheitsideal. Bald werden alle Menschen auf der Welt gleich aussehen.
Und um welche Operation wurden Sie am häufigsten gebeten?
Pitanguy: Alles, was die Spuren des Alters vertuscht, vor allem Gesichtsstraffungen. In den letzten Jahren hat sich das ein wenig verschoben. Inzwischen wünschen sich viele Fettabsaugungen und Bauchstraffungen. Der globalisierte Lebens- und Ernährungsstil ist in Brasilien angekommen. Und weil Rio eine Stadt ist, die einen fortwährend dazu auffordert, sich zu zeigen, vor allem natürlich am Strand, haben Sie sicher bemerkt, wie viele Menschen hier übergewichtig oder sogar richtig dick sind.
In sechs Wochen beginnt in Brasilien die Fußball-Weltmeisterschaft. Sind Sie Fußballfan?
Pitanguy: Natürlich. Als ich mit 16 aus der Nähe von Belo Horizonte, etwas weiter im Landesinneren, nach Rio gekommen bin, habe ich die legendären Spieler alle noch erlebt, Mané Garrincha, auch den jungen Pelé, leider war ich nur ein einziges Mal im legendären Maracaña-Stadion.
Wissen Sie noch, wann?
Pitanguy: Am 16. Juli 1950. Das war ein historischer Moment.
Sie haben das legendäre WM-Endspiel Brasilien gegen Uruguay im Stadion gesehen?
Pitanguy: Ja, ich war damals Anfang zwanzig und für ein paar Tage in Rio, weil ich gerade eine Ausbildung zum Schönheitschirurgen in den USA gemacht habe. Das Spiel endete 2:1 für Uruguay.
Eine Schmach, die bis heute kein Brasilianer vergessen hat.
Pitanguy: Oh ja, diese Niederlage war unendlich traurig, weil wir besser gespielt haben und den Sieg verdient gehabt hätten. Aber dann macht Ghiggia, dieser Stürmer aus Uruguay, zehn Minuten vor Schluss das 2:1. Sie glauben nicht, wie still 200 000 Menschen sein können.
Wir sind seit drei Tagen in der Stadt und können überhaupt keine Vorfreude auf die Weltmeisterschaft spüren. Woran könnte das liegen?
Pitanguy: Das hat mit den Protesten zu tun, die letztes Jahr während des Confederations Cup in Brasilien stattgefunden haben. Eine merkwürdige Sache, denn eigentlich gibt es in Brasilien gar keine Tradition dafür. Ich verstehe es nicht ganz. Wir haben so hart für dieses Turnier gekämpft, und dann so was. Tut mir leid, aber ich muss langsam los, die Sitzung in der Akademie beginnt gleich.
Können Sie nicht noch ein bisschen bleiben? Es kommen noch interessante Gäste, zum Beispiel Paulo Lins.
Pitanguy: Paulo Lins? Der hat doch Die Stadt Gottes geschrieben.
Ja. Haben Sie den Roman gelesen?
Pitanguy: Nein, nur den Film gesehen, anstrengend, aber großartig.
Er nimmt einen letzten Schluck Wasser, verneigt sich, hakt sich bei seinem Bodyguard ein und geht. Draußen wartet ein schwarzer Jeep mit getönten Scheiben. Zehn Minuten später kommen die nächsten Gäste: die Ökonomin Sandra Quintela und Eduardo Mack. Eine perfekte Kombination, weil sie: eher links, kritisch, intellektuell, und er: bis vor Kurzem tätig für Ernst & Young, einen der Großsponsoren der WM. Beide bestellen Wasser, das in Pappbechern serviert wird.
Schade, jetzt haben Sie Ivo Pitanguy verpasst. Wir haben ihn nach den Protesten im letzten Jahr gefragt. Er meinte, er verstehe die Sache nicht ganz. Was halten Sie von den Demonstrationen?
Sandra Quintela: Also ich weiß schon, warum die Menschen wütend sind. Weil die Gewinne durch die WM in diesem Jahr so hoch wie nie zuvor sein werden, aber die Brasilianer nichts davon haben, im Gegenteil, alles wird teurer und vor allem in Rio werden im Namen dieser WM jeden Tag neue Verbote erlassen, die den Menschen das Leben schwer machen. Warum glauben Sie, finden die nächsten Weltmeisterschaften in Russland und Katar statt? Weil es viel komplizierter ist, so ein Turnier in einem demokratischen Land durchzuführen.
Dafür wurde das Maracaña-Stadion auf den neuesten Stand gebracht.
Quintela: Auf den neuesten Stand nennen Sie das? Die Wahrheit ist, das Stadion hat jegliche Aura verloren. Es ist überhaupt kein Stadion mehr, sondern eine Arena für das Fernsehen, nicht mehr für die Menschen. Früher hatten im Maracaña 200 000 Menschen Platz, heute sind es noch 70 000 und fast alle davon sind blond und blauäugig.
Warum?
Quintela: Weil sich die Schwarzen den Eintritt nicht mehr leisten können. Rio wird Zeuge einer extremen Elitebildung im Fußball. Wie heißt noch mal dieser spanische Superstar? Xavi? Iniesta? Egal, auf jeden Fall stand er letztes Jahr im Finale des Confederations Cup und erzählte anschließend, was für große Erwartungen er an diesen mythischen Ort gehabt habe. Leider habe er nichts gespürt, keinen Mythos, keine Gänsehaut, nichts.
Fünf Minuten später kommt, nein, erscheint Elke Maravilha, außerdem der Künstler Ernesto Neto. Sie hat ihr blondes Haar zu einem riesigen Afro aufgetürmt, er trägt abgeschnittene Jeans und Flipflops.
Eduardo Mack: Aber das Maracaña-Stadion musste umgebaut werden. Es gab kaum Ausgänge und viel zu wenig Toiletten. Es entsprach einfach nicht den Sicherheitsvorschriften. In den letzten fünfzig Jahren fand die Fußball-WM nur in hoch entwickelten Ländern statt, in Italien, in Deutschland, in den USA. Und jetzt sind eben wir dran, Brasilien, mit allen Problemen, die ein Schwellenland mit sich bringt.
Ernesto Neto: Kann ja sein, aber in diesem Stadion gibt es nicht mal mehr Stehplätze. Wir Brasilianer brauchen aber Stehplätze.
Warum?
Neto: Damit wir Samba tanzen können. Ihr könnt euren Rock ’n’ Roll vielleicht im Sitzen tanzen, aber wir brauchen unsere Hüften, wir müssen uns bewegen.
Quintela: Vorher konnte man für zehn Real ins Stadion gehen, das sind drei Euro. Das Stadion war ein Tempel, ein heiliger Ort des Fußballs. Und jetzt wird diese WM
34 Milliarden Real kosten, das sind ungefähr zehn Milliarden Euro, und die Hälfte davon kommt aus den Kassen des Staates, der Bundesländer und der Kommunen. Dieses Geld bräuchten wir aber für unsere Schulen, Straßen und Krankenhäuser.
Mack: In den letzten Jahren haben alle geschwärmt: Brasilien, der erwachende Riese, der nächste Global Player, und heute? Haben wir immer noch die gleichen Probleme. Jetzt können wir der ganzen Welt zeigen, dass wir unsere Probleme wie mündige Bürger anpacken. Brasilien war lang ein Kind, jetzt muss es zeigen, dass es erwachsen geworden ist. Das Problem dabei ist nur, dass wir keine Zeit für die Pubertät haben.
Ihr ehemaliger Arbeitgeber hat im Jahr 2010 eine Studie veröffentlicht, laut der durch die WM 142 Milliarden Real in die brasilianische Wirtschaft fließen und 3,6 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen.
Mack: Diese Studie wurde von Beratern gemacht, nicht von mir.
Elke Maravilha: Aber es ist doch ein Skandal, dass wegen der Bauarbeiten Tausende von Familien ihre Häuser verlassen mussten. Für die Olympischen Spiele sollen ja noch mal 30 000 umgesiedelt werden.
Quintela: Investoren fallen in die Stadt ein und kaufen alles auf.
Das haben wir auch gelesen. Allein in den letzen fünf Jahren haben sich die Mieten verdoppelt und die Immobilienpreise vervierfacht.
Quintela: Ich wohne seit 19 Jahren in dieser Stadt und spüre, wie sie immer mehr ihre Seele verliert, weil die normalen Menschen immer weiter in die Vororte gedrängt werden.
Mack: Das liegt nur daran, dass die Cariocas keinen Bürgersinn haben. Die Menschen hier sind es nicht gewohnt, sich zu Wort zu melden, Entscheidungen in Frage zu stellen, Forderungen zu formulieren. Das ist das Erbe der Militärdiktatur. Ihr habt euch in München gegen die Winterspiele 2018 ausgesprochen. So was wäre in Rio undenkbar.
Quintela: Und warum? Weil es gefährlich ist. Ich kenne etliche Leute, die gegen die Geldverschwendung protestiert haben. Sie wurden beschimpft, verfolgt und angeklagt. In Rio herrscht eine militante Stimmung. Die Stadt hat allein dreißig Millionen Real für Gummigeschosse und Munition ausgegeben, das muss man sich mal vorstellen.
»Die brasilianische Strandkultur führt die Menschen zusammen und wieder auseinander. Alles fließt, alles ist in Bewegung.«
17 Uhr: Rafaela Miranda Rocha kommt an den Tisch, noch etwas außer Atem – sie ist mit dem Rad gefahren – eine zierliche Person, die erst minutenlang zuhört und schweigt. Dann wird sie das erste Bier des Abends bestellen und richtig loslegen. Kurz darauf kommt eine SMS von Alice Autran Garcia, Modechefin bei der Zeitung »O Globo«: »Sorry, stecke im Stau, komme später.«
Quintela: Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass vor ein paar Tagen eine Frau angeschossen und von Polizisten ins Krankenhaus gefahren wurde? Auf dem Weg fiel sie aber aus dem Kofferraum, wurde vom Auto mitgeschleift und starb. Sie war 38 Jahre alt und hatte vier Kinder. Und jetzt berichten seit Tagen sämtliche Zeitungen darüber. Auf einmal sprechen alle nur noch von »der Mitgeschleiften«. Wenn jemandem aus der Mittelschicht so etwas passiert, wird darüber berichtet, dann bekommt das Opfer einen Namen. In Rio passieren aber jeden Tag Dutzende Unfälle und Morde, für die sich kein Mensch interessiert.
Rafaela Miranda Rocha: Und wisst ihr, was ich gehört habe? Dass genau diese Polizisten schon 64 Menschen getötet haben, und zwar offiziell legitimiert, also im Dienst. Ich meine, wie kann man noch Polizist sein, wenn man 64 Menschen auf dem Gewissen hat? Die Polizei in Brasilien ist kriminell und die Medien sind rechtslastig, das ist ein Riesenproblem.
Neto: Also ich lese schon lange nicht mehr, was O Globo schreibt.
Rocha: Aber die Menschen lassen sich davon beeindrucken und rennen weiter ihrem stumpfen Ideal von Luxus und Schönheit hinterher. Sie glauben gar nicht, wie innig sich viele Brasilianer wünschen, europäisch zu sein, es ist absurd.
Neto: Stimmt. In den Schulen bringen sie es sogar unseren Kindern bei. Dabei liegen unsere Wurzeln in Afrika. Ich weiß nicht, warum das keiner wahrhaben will. Ihr kennt doch diese Typen, die am Strand riesige Sandburgen bauen.
Haben wir gesehen. Sieht toll aus.
Neto: Finde ich auch. Und wissen Sie, was? Genau das wollen die Stadtbehörden verbieten.
Warum?
Neto: Weil sie Angst haben, dass dadurch Touristen abgeschreckt werden. Nur weil diese Männer aus den Favelas kommen, ein bisschen riechen und nicht ganz so schick aussehen.
17.30 Uhr: Ein schlanke, große Frau kommt in den Innenhof: Alice Autran Garcia, früher Model, jetzt Modechefin des Magazins der Tageszeitung »O Globo«. Auch sie trägt Flipflops: »Sorry«, sagt sie, »ich stand ungelogen neunzig Minuten im Stau.«
Neto: Hey, Alice, du bist auch hier. Schön, dich zu sehen.
Wie, Sie beide kennen sich?
Alice Garcia: Ja, ich war mal mit einem Freund von Ernesto zusammen. Wir haben uns am Strand kennengelernt.
Sind Sie noch zusammen?
Garcia: Nein, nicht mehr.
Neto: Sehen Sie, das ist brasilianische Strandkultur. Sie führt die Menschen zusammen und wieder auseinander. Alles fließt, alles ist in Bewegung. So mag ich es.
Frau Garcia, Sie arbeiten bei O Globo. Was sagen Sie dazu, dass Ernesto Neto Ihren Arbeitgeber ablehnt?
Garcia: Hey, ich bin die Modechefin, ich bin nicht für die Schlagzeilen verantwortlich.
Rocha: Aber du musst doch zugeben, dass die Zeitungen die Proteste letztes Jahr komplett verzerrt und vereinfacht dargestellt haben.
Inwiefern?
Rocha: Die Demonstranten hatten eine Agenda, eine Liste mit klar definierten Forderungen, zum Beispiel, dass die Buspreise reduziert werden müssen. Aber die Journalisten haben diese Forderungen überhaupt nicht thematisiert. Sie haben auch nicht recherchiert, ob sie zu Recht aufgestellt wurden. Alle haben nur über den Vandalismus berichtet, weil das Auflage bringt. Ich habe drei Jahre in London studiert und bin letztes Jahr nach Rio zurückgekommen. Ich kann euch sagen, ich erkenne meine Stadt nicht wieder.
Was hat sich in Rio verändert?
Rocha: Ich weiß aus meiner Zeit in London, was Gentrifizierung bedeutet, aber hier läuft alles viel brutaler ab. Die Leute werden ja mit Bulldozern aus ihren Häusern vertrieben. Ich komme aus einer bürgerlichen Familie, ich kann mich nicht beklagen, aber ich erkenne die Logik und lehne sie ab. Ich gehe zum Beispiel in keinen Club mehr, wo ich Eintritt bezahlen muss, sondern feiere am Strand. Ich fahre auch nicht mehr mit dem Bus, sondern mit dem Rad. Ich bin durch die hohen Preise und die Stimmung in der Stadt stark politisiert worden und spüre, dass es Tausenden von jungen Menschen genauso geht.
Herr Neto, wie hat sich das Strandleben im Zuge der WM-Vorbereitungen verändert?
Neto: Vor zwei Jahren hat mich eine deutsche Journalistin genau das Gleiche gefragt. Damals habe ich mich beschwert, weil gerade Dutzende absurder Verbote unser Strandleben kaputtzumachen drohten. Die Stadtverwaltung hatte die Operação Choque de Ordem ausgerufen, die »Operation Ordnungsschock«, vor allem für den Strand.
Mit welchen Konsequenzen?
Neto: Sie haben verboten, dass Kinder Drachen steigen lassen. Sie haben verboten, dass wir laut Musik hören. Sie haben verboten, dass Kleinhändler ihren queijo coalho verkaufen, den Käse am Stiel, der in Handöfchen gegrillt wird, nur weil sich mal ein Typ den Magen verdorben hat. Sie haben verboten, dass wir bunte Sonnenschirme aufstellen, erlaubt waren nur noch rote, blaue und gelbe. Inzwischen haben wir den Strand zurückerobert. Die können vielleicht das Maracaña-Stadion, aber nicht unsere Seele kaputtmachen.
Welche Rolle spielt der Bürgermeister der Stadt?
Neto: Der steckt mit Coca-Cola und Heineken unter einer Decke. Vor zwei Jahren hat er offiziell verboten, am Strand Kokoswasser zu trinken, weil das ja das Geschäft der großen Getränkekonzerne kaputtmacht. Inzwischen trinken wir wieder unser Kokoswasser, dürfen die Nüsse aber nicht mehr mit der Machete aufmachen. Zu gefährlich, sagen die Behörden, also müssen die Verkäufer mit einer Bohrmaschine ein Loch in die Nuss bohren, damit man einen Strohhalm reinstecken kann. Es ist lächerlich. Glauben Sie mir, die würden am liebsten verpackte Kokosnüsse von Heineken verkaufen.
Gestern wurden wir am Strand von zwei Verkäufern auf Englisch angesprochen. Wie haben sie erkannt, dass wir keine Cariocas sind?
Garcia: Sicher habt ihr eine Zeitung oder ein Buch gelesen.
Nein.
Neto: Lagt ihr auf Handtüchern?
Auch nicht.
Garcia: Gut, denn normalerweise erkennen wir euch Gringos an Zeitungen oder Handtüchern, das machen wir Brasilianer nämlich nicht.
Rocha: Es ist die Körpersprache. Ihr bewegt euch anders.
Garcia: Rucksäcke sind auch ein Erkennungszeichen. Oder wenn Frauen abseits des Strandes im Bikini durch die Stadt laufen, das machen nur Touristen, auch brasilianische, aber keine Menschen aus Rio.
Warum lesen die Menschen nicht am Strand?
Rocha: Also ich lese schon.
Garcia: Aber da bist du echt eine Ausnahme.
Rocha: Stimmt schon, die Brasilianer lesen generell kaum. Sie reden lieber miteinander.
Garcia: Deswegen sind hier ja alle so süchtig nach Telenovelas. Weil die Handlung einfach und klischeehaft ist. Bücher sind den meisten Menschen zu komplex.
Rocha: Und wer ist wieder mal schuld? Dein Arbeitgeber Globo. Dieser Konzern ist machiavellistisch organisiert, ein Oktopus mit hundert Armen, der die Menschen auf allen Kanälen verdummt und dem man nicht entkommen kann. Mit achtzig Millionen Zuschauern betreibt er das drittgrößte Fernsehnetzwerk weltweit. Aber jetzt mal was anderes: Ich bin heute morgen von Leblon aus Richtung Ipanema am Strand entlanggeradelt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Polizisten da am Strand
waren.
Garcia: Manchmal kommt man sich in dieser Stadt vor, als wäre man im Krieg. Also ich kriege Angst, wenn die Stoßtrupps anrücken, ich meine, deren Logo sind zwei gekreuzte Revolver und ein Totenkopf, das sagt doch alles.
Neto: Dabei braucht sie kein Mensch. Früher haben sich die Kioskbesitzer um ihren Strandabschnitt gekümmert. Sie haben den Müll aufgesammelt und Streitereien geschlichtet.
Garcia: Ganz so einfach ist es auch nicht, Ernesto. Erst heute morgen habe ich wieder mitbekommen, wie eine Frau ausgeraubt wurde.
Neto: Na und? So ist das Leben, ab und zu wird man eben bestohlen.
Rocha: Ich bin inzwischen sicher, dass die Regierung kleinere Verbrechen wie Diebstahl absichtlich durchgehen lässt, damit die Menschen sich unsicher fühlen und nach der Polizei rufen. Die Reichen und die Touristen sollen sich bedroht fühlen, nur so lässt sich diese Polizeipräsenz legitimieren.
Wie kommen Sie auf diese Theorie?
Rocha: In Rio gibt es einen riesigen Park namens Parque do Flamengo. Früher bin ich da oft joggen gegangen, aber inzwischen traut sich fast keiner mehr hin, weil dort Hunderte von Gangs und kriminellen Jugendlichen abhängen, die Passanten vom Rad stoßen, ausrauben und bedrohen. Trotzdem ist weit und breit kein Polizist zu sehen.
Verstehen Sie?
Nicht ganz.
Rocha: Na, die überlassen manche Gegenden sich selbst. Die kümmern sich nur um die schicken Stadtteile. Zum Glück hat heute fast jeder ein Smartphone mit Kamera. Für einen Polizisten kann eine Kamera gefährlicher sein als eine Waffe. Sie glauben gar nicht, was am Strand so den ganzen Tag passiert, wie willkürlich es da zugeht. Alle behaupten immer, der Strand in Rio sei ein demokratischer Ort, aber das ist ein Mythos. Wo sind die Strände denn? In Ipanema, in Leblon, in Copacabana, immer nur da, wo die Reichen wohnen.
Neto: Jetzt übertreibst du, in Rio kann jeder zum Strand gehen. Es gibt in Brasilien keine Privatstrände.
Rocha: Schon, aber wer aus dem Norden kommt, muss erst mal eine Stunde im Stau stehen. Und wenn er da ist, wird er anders angesehen, anders behandelt, anders wahrgenommen. Wenn am Strand auf einmal viele Schwarze sind, spürt man richtig, wie manche Menschen panisch werden.
Neto: In Rio gibt es ein Sprichwort: »Ein weißer Mann, der den Strand entlangläuft, ist ein Exzentriker. Ein schwarzer ist ein Dieb.« Trotzdem ist der Strand immer noch liberaler als andere Orte. Es gibt Restaurants, da lassen sie Schwarze nicht mal rein.
Rocha: Kann alles sein, ich will ja nur sagen, dass die Südzone mit ihren schicken Vierteln eine Blase ist, und dass ich immer mehr das Bedürfnis habe, mit Leuten aus dem Norden in Kontakt zu kommen. Die haben Probleme, von denen haben wir hier noch nie was gehört.
Der Strand ist in verschiedene Bereiche unterteilt, als Markierungen dienen sogenannte Postos. Wo gehen Sie am liebsten hin?
Neto: Über diese Frage könnte man einen zweistündigen Dokumentarfilm drehen. Die Soziologie des Strandes ist eine Wissenschaft für sich, weil der Strand in viele Abschnitte untergliedert ist, die ihrerseits wieder unterteilt sind.
Garcia: Die Atmosphäre ändert sich alle fünfzig Meter. Auf einmal sehen die Menschen anders aus, bewegen sich anders, tragen andere Klamotten.
Neto: Es gibt den Strand für die Linken, für die Schwulen, für die Schönen, für die Familien, für die Rentner, für die Kiffer …
Garcia: … für die Paulistas.
Die Menschen aus São Paulo?
Garcia: Ja, die wohnen fast alle in den schicken Hotels in Ipanema. Wer aus São Paulo kommt und ein paar Tage in der Stadt ist, legt Wert darauf, sich am Strand einen Longdrink servieren lassen zu können. Sie glauben gar nicht, wie anders die Menschen dort sind.
In einem Stadtporträt haben wir gelesen: »Rio ist Kreativität, São Paulo Eleganz, Rio ist Karneval, São Paulo Kunstmesse, Rio ist Eitelkeit, São Paulo Effizienz.«
Garcia: Das kommt ungefähr hin. In São Paulo wird man als Erstes gefragt, was für einen Job man hat. In Brasilia, welches Sternzeichen man ist. Und in Rio, an welchen Strandabschnitt man geht.
Quintela: War ja klar, dass wir früher oder später über den Strand reden. Jetzt denken wieder alle, Rio besteht nur aus guter Laune. Dabei gibt es hier Tausende von Menschen, die den Strand noch nie zu Gesicht bekommen haben.
Keine Sorge, Frau Quintela, wir erwarten noch den Schriftsteller Paulo Lins und den ehemaligen Drogenhändler Feijão, da werden sicher auch andere Themen zur Sprache kommen. Wie ist das überhaupt, haben Sie mit Menschen aus Favelas zu tun?
Neto: Natürlich, ich wohne sogar direkt gegenüber von einer. Und wissen Sie, was das Problem ist? Die Favelas werden immer mehr zu einer Location, einer folkloristischen Szenerie, mit der sich die Menschen schmücken, ohne dass die Bewohner was davon haben. Es gibt zum Beispiel einen französischen Typen, der hat mitten in einer Favela ein Hotel eröffnet, wo er eine Party nach der anderen schmeißt. Und die Leute kommen in Scharen, weil sie es cool finden, in einer so brutalen und gewalttätigen Gegend abzufeiern.
Rocha: Und im Gegenzug werden die Baile-Funk-Partys verboten.
Baile Funk? Was ist das?
Rocha: Das ist Hip-Hop aus Brasilien mit Texten, die sich um Drogen, Sex und Gewalt drehen. Klar mögen die das in den Favelas. Das ist ihre Kultur, ihr Leben.
Neto: Ich weiß noch, wie ich am 24. Dezember gegen zwei Uhr vor die Tür gegangen bin. Sie können sich nicht vorstellen, was in der Favela los war. Die Menschen haben getanzt und gesungen, die haben Weihnachten gefeiert, wie ihr es in Deutschland gar nicht mehr kennt. Glaubt mir, euer Land ist zu organisiert, ihr braucht mehr Leben und weniger Kontrolle.
Quintela: Kapitalismus ist Kontrolle. Das hat Karl Marx schon vor 200 Jahren gesagt.
Neto: Und jetzt seid mir bitte nicht böse, aber ich muss los, meine Kinder warten zu Hause.
»Die brasilianische Strandkultur führt die Menschen zusammen und wieder auseinander. Alles fließt, alles ist in Bewegung.«
Neto nimmt einen letzten Schluck Bier, steht auf, umarmt alle, die noch hier sind, und schlurft in den Abend. Es ist dunkel geworden, auch milder.
Haben Sie Angst, nachts durch Rio de Janeiro zu laufen?
Garcia: Ich schon.
Rocha: Wenn du einmal ausgeraubt worden bist, verändert es dich, egal wie cool du bist.
Wurden Sie schon ausgeraubt?
Rocha: Einer hat es mal versucht. Er wollte mein Handy und meine Tasche. Ich habe ihm einfach Geld hingeworfen, damit hat er sich zufrieden gegeben.
Garcia: Hatte er eine Pistole?
Rocha: Ich glaube ja, aber er hat sie nicht gezogen.
Garcia: Man fühlt es, stimmts? Man fühlt, wie weit der andere geht.
Kommt es vor, dass Passanten einspringen, um zu helfen?
Garcia: Ausgeschlossen.
Warum?
Garcia: Weil keiner wegen jemandem erschossen werden möchte, den er noch nie im Leben gesehen hat.
18.30 Uhr: Es kommt Paulo Lins, eine Stunde später als vereinbart – der Verkehr, was sonst? Er ist extra aus São Paulo gekommen, wo er inzwischen lebt, und verlässt alle paar Minuten den Tisch, um zu rauchen, Tabak umhüllt von getrockneten Maisblättern. »Nicht industriell hergestellt«, sagt er, »wirkt fast wie Dope.«
Herr Lins, am 20. Juni 2013 sind in Brasilien eine Million Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Wohnungsnot, niedrige Löhne, Korruption und die Preiserhöhung im Nahverkehr zu protestieren. Verstehen Sie diese Menschen?
Paulo Lins: Ja, aber dazu muss man die Geschichte Brasiliens kennen; wir haben hier einiges hinter uns: 400 Jahre Kolonialisierung, 300 Jahre Sklaverei und von 1964 bis 1985 eine grausame Militärdiktatur, die von den USA und Europa unterstützt wurde. Als Brasilien Mitte der Achtziger demokratisch wurde, dachten alle, dass es jetzt bergauf geht, mit der Infrastruktur, der Qualität der Schulen, dem Gesundheitssystem, aber bis heute ist nichts passiert. Und jetzt müssen die Menschen zuschauen, wie Milliarden in diese WM investiert werden, ohne dass irgendjemand nach ihren Bedürfnissen fragt.
Sind Sie deswegen nach São Paulo gezogen?
Lins: Nein, für meinen achtjährigen Sohn. Der lebt dort mit seiner Mutter. Ich vermisse Rio, ganz klar, aber São Paulo ist auch eine faszinierende Stadt, mit unglaublich vielen Einwanderern, Japanern, Peruanern, Italienern, das macht die Stadt kulturell und kulinarisch aufregend. In São Paulo leben noch mal acht Millionen Menschen mehr, dagegen wirkt Rio fast beschaulich.
19 Uhr: Feijão (dt. Bohne), ehemaliger Drogenhändler, betritt den Innenhof. Er trägt ein T-Shirt von Tommy Hilfiger und eine Sonnenbrille. Er wohnt weit im Norden der Stadt. Als Elke Maravilha ihn sieht, ruft sie aus: »Oh, Bohnen vernasche ich für mein Leben gern.« Darauf Feijão: »Sind ja auch nahrhaft …«
Feijão, Paulo Lins, dürfen wir vorstellen?
Feijão: Danke, danke, nicht nötig, ich kenne diesen Mann, jeder in Brasilien kennt ihn.
In Rio leben 1,2 Millionen Menschen in Favelas. Auch Sie beide sind in einer groß geworden. Wie hat sich die Situation in Rios Armenvierteln seit Ihrer Jugend verändert?
Lins: Früher liefen die Drogendealer mit Maschinengewehren durch die Gassen, heute nicht mehr, zumindest nicht in den befriedeten Favelas.
Aber von den 1000 Favelas, die es in Rio de Janeiro gibt, stehen doch nur vierzig unter Polizeischutz.
Feijão: Stimmt, in vielen Favelas vor allem im Norden der Stadt leisten die Drogenkartelle heftigen Widerstand. Erst neulich wurden wieder sieben Polizisten erschossen.
Lins: Diese Befriedung funktioniert ja auch nicht richtig.
Inwiefern?
Lins: Weil das bewaffnete Übernahmen sind. Es hat doch nichts mit Frieden zu tun, wenn in einem Viertel bewaffnete Militärpolizisten stationiert sein müssen, um die Lage einigermaßen im Griff zu haben. Das ist doch eher ein Kriegs- oder Belagerungszustand. Und am Ende geht es doch nur darum, die Gegenden für Investoren interessant zu machen.
Feijão: Aber irgendwie muss der Staat doch versuchen, die Drogenbanden zu entmachten. Leider zeigt sich mehr und mehr, dass die Polizisten selbst korrupt sind. Glauben Sie mir, ich weiß, wie das läuft, ich bin selbst mit 13 Jahren zum Drogenhändler geworden.
Wie kam es dazu?
Feijão: Ganz einfach, meine Nachbarn waren Drogenhändler und meine Freunde waren auch Drogenhändler, wir sagen traficantes dazu. Diese Favela war mein Universum, ich kannte nichts anderes, also habe ich Kokain, Crack und Marihuana verkauft. Und irgendwann gibt es eben nur noch zwei Sorten von Menschen: gute Kriminelle und böse Kriminelle. Ende der Achtzigerjahre wurden die Drogenbosse in Rio idealisiert. Die Menschen haben Lieder über sie gesungen, weil sie sich von ihnen beschützt gefühlt haben. Für uns waren die eine Art Robin Hood.
Wie sah Ihr Alltag damals aus?
Feijão: Ich bin bei meiner Großmutter und meiner Mutter groß geworden, aber die war nie da, weil sie arbeiten musste. Ich bin zwar zur Schule gegangen, trotzdem hatte mein Tag überhaupt keine Struktur. Ich weiß noch, wie sehr ich mir damals ein Fahrrad gewünscht habe, aber daran war nicht mal zu denken. Und dann habe ich mitbekommen, was sich die Drogendealer alles leisten können, Autos, coole Klamotten, und was für ein Ansehen sie bei den Leuten genießen. Ist doch klar, dass man da auch einer werden möchte. Ich meine, die hatten Maschinengewehre, wie ich sie vorher nur in Rambo gesehen hatte.
Seit 1993 sind in Rio 25 000 Personen verschwunden, jedes Jahr werden mehr als 4000 Menschen ermordet, die Aufklärungsrate liegt bei einem Prozent. Ein Reporter von TV Globo, der mit versteckter Kamera in einer Favela filmen wollte, wurde gefoltert, zerstückelt und verbrannt. Hat Sie diese Gewalt nicht abgeschreckt?
Feijão: Nein, denn für mich waren das ja Wohltäter. Die haben Feste organisiert und Essen verteilt. Die Bösen, das waren die Polizisten, die wahllos auf uns geschossen haben. Lins: Bevor eine Favela befriedet werden kann, muss sie ja erst mal erobert werden. Man nennt das reconquista. Dazu kommen tausend Militärpolizisten mit Panzerfahrzeugen und Hubschraubern und schießen erst mal, ohne Fragen zu stellen. Die sehen brutal aus, mit Kampfanzügen und Maschinengewehren. Ich habe mindestens dreißig Freunde verloren, die bei so einer reconquista unschuldig umgebracht worden sind.
Feijão: Ich 300.
Lins: Trotzdem gibt es einen Unterschied zwischen der Situation heute und damals: Vor dreißig Jahren war die Kriminalität bei Weitem nicht so organisiert wie heute. Die Gangs agierten eher lokal. Die organisierten Banden haben sich erst Ende der Achtzigerjahre in den Gefängnissen gebildet, zusammengesetzt aus ehemaligen Gefangenen der Militärdiktatur. Die professionellen Drogenkommandos von heute haben alle als politische Gruppierungen gegen schlechte Haftbedingungen begonnen. So wurde aus der Roten Phalanx das Comando Vermelho, das Rote Kommando, die größte Drogenorganisation in ganz Brasilien, mit 5000 schwer bewaffneten Kriminellen.
In den vergangenen Monaten wurde die Militärpolizei UPP auf mehr als 12 000 Mitglieder aufgestockt.
Lins: Die Regierung glaubt, dass sie die Lage so unter Kontrolle bringen kann, aber das macht sie nur aus Imagegründen, weil die WM bald anfängt. Man müsste viel weiter vorne ansetzen, bei den Kindern und Jugendlichen. Es wird doch niemand mit 25 plötzlich zum Verbrecher.
Wir haben uns gestern die befriedete Favela Santa Marta angeschaut, in der Michael Jackson 1996 sein Video zu They Don’t Care About Us gedreht hat. Ist so ein Ort noch repräsentativ?
Lins: Bestimmt nicht.
Feijão: Santa Marta? Das ist ein Zoo! Eine Vorzeige-Favela für Touristen, die eine Safari durch den Alltag der armen Leute machen wollen.
»Die brasilianische Strandkultur führt die Menschen zusammen und wieder auseinander. Alles fließt, alles ist in Bewegung.«

Karen Roberta Andrade, 33, kommt. Sie ist Mitglied der UPP, also der Militärpolizei, die in den Favelas stationiert ist. Sie hat sich schick gemacht: viel Goldschmuck, lackierte Fingernägel.
Frau Andrade, wir sprechen gerade darüber, ob die Befriedung der Favelas funktioniert.
Karen Roberta Andrade: Also ich finde schon. Im Moment arbeite ich in einer Einheit, die für die psychologische Betreuung der Bewohner zuständig ist. Denn wir sind ja nicht nur in den Favelas, um abzuschrecken, wir kümmern uns auch um die Bewohner, gehen mit Kindern zum Einkaufen, verteilen Spielsachen und Essensspenden.
Wie lange machen Sie das schon?
Andrade: Seit drei Jahren, eigentlich wollte ich gar nicht Polizistin werden.
Lins: Sondern?
Andrade: Ich hatte Pädagogik studiert, aber mein Vater hat mich nach dem Studium dazu gedrängt, zur Polizei zu gehen. Jetzt bin ich in der Favela Chatuba im Complexo da Penha stationiert, die ganz im Norden von Rio auf dem Weg zum Flughafen liegt. Für mich ist das eine vollkommen neue Welt, weil ich eher behütet groß geworden bin. Und jetzt sitze ich da in einer Art Container ohne Klimaanlage und mit Toiletten, die praktisch nicht benutzbar sind. Im Grunde haben wir Polizisten genau die gleichen Probleme wie die 7000 Bewohner.
Lins: Haben Sie Angst, wenn Sie in Ihrem Container sitzen?
Andrade: Am Anfang hatte ich unglaubliche Angst, damals musste ich noch nachts arbeiten, von sechs Uhr abends bis sechs Uhr morgens. Das war kurz nach der Eroberung der Favela, es gab jeden Tag Gerüchte von Überfällen und Anschlägen. Inzwischen arbeite ich tagsüber und will gar nicht mehr weg.
Lins: Trotzdem werden Sie von Menschen, die einen Angehörigen durch einen Polizisten verloren haben, niemals als Friedensstifter anerkannt werden.
Wie viel verdienen Sie?
Andrade: 2500 Real im Monat, das sind ungefähr 850 Euro, nicht viel für das Risiko, ich weiß.
Lins: Also ich finde, dass so eine Befriedung nichts bringt, weil die Drogenbanden und die Probleme doch nur ins nächste Viertel wandern.
Andrade: Da ist schon was dran, aber wir müssen Geduld haben und langfristig denken. Außerdem muss die Polizeiausbildung verbessert werden. Im Moment ist es so, dass man als Polizist in Rio keinerlei psychologische Schulung bekommt. Die jungen Polizisten kommen nach einer kurzen Ausbildung sofort zu einer UPP-Einheit und sehen sich mit den krassesten Problemen konfrontiert.
Feijão: Hast du nie mitgekriegt, wie willkürlich die Polizisten in den Favelas vorgehen?
Andrade: Ich glaube dir das, weil ich selbst Freunde in Favelas verloren habe, aber selbst erlebt habe ich solche Einsätze nicht.
Feijão: Ich kann dir erzählen, wie so was abläuft. Da kommen 200 schwer bewaffnete Polizisten, sperren alle Ausgänge ab, stürmen ohne Vorwarnung und Durchsuchungsbefehl in die Häuser rein und eröffnen das Feuer. Ist doch klar, dass sich die Leute wehren.
Und dann?
Feijão: Wird geschossen, und wer muss drunter leiden? Die normalen Leute, die nichts mit Drogen zu tun haben, aber zwischen die Fronten geraten. Denn man darf ja nicht vergessen, dass es auch Hunderttausende von Menschen gibt, die versuchen, sich mit Fleiß und Ehrlichkeit aus der Armut rauszuarbeiten. Die stehen auf, haben nichts zu essen, fahren morgens zwei Stunden in einem überfüllten Bus zur Arbeit, kommen spät abends nach Hause, kriegen unterwegs, wenn sie Pech haben, auch noch von der Polizei auf den Deckel und haben am Ende des Tages immer noch nicht genug Geld, um ein einigermaßen anständiges Leben zu führen.
Lins: Vor fünf Jahren war ich wieder mal in der Cidade de Deus, der Stadt Gottes, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe ein paar alte Freunde besucht, wir haben gegrillt und Bier getrunken. Natürlich waren auch ein paar Drogenhändler da, ich meine, ich bin dort groß geworden. Plötzlich kamen Hunderte von Polizisten angerannt und fingen zu schießen an. Ein paar Minuten später lagen zwanzig Menschen tot am Boden.
Wie haben Sie reagiert?
Lins: Ich bin abgehauen, mit dem Taxi in meine Wohnung gefahren und habe mir das Ganze am Abend in den Nachrichten angesehen.
Frau Andrade, haben Sie schon mal auf jemanden geschossen?
Andrade: Nein.
Und wurde schon mal auf Sie geschossen?
Andrade: Gott sei Dank auch nicht. In der Favela, in der ich stationiert bin, wurde noch niemand getötet.
Feijão: Auf mich wurde schon geschossen, die Kugel hat mich fast umgebracht.
Heute setzen Sie sich gegen Gewalt und Drogen ein. Was hat diesen Wandel ausgelöst?
Feijão: Wissen Sie, als dieser Schuss mich traf, war meine Frau gerade schwanger. Es war unglaublich, die Bullen hatten mich umzingelt wie einen Fuchs im Bau.
Lins: Hey, pass auf, du fällst in den Gangsterslang.
Feijão: Okay, jedenfalls, als mich dieser Schuss oberhalb der Hüfte traf, habe ich nur gedacht: Oh mein Gott, jetzt sterbe ich, ohne meinen Sohn gesehen zu haben. Damals
ist mir bewusst geworden, wie normal das tägliche Sterben für mich geworden war, und ich beschloss, dass ich nicht so schnell sterben möchte.
Wie ging es weiter?
Feijão: Ich habe einen Priester aufgesucht, der mir den Rat gab, ein neues Leben anzufangen, weil Gott etwas mit mir vorhabe. Also habe ich mich der NGO AfroReggae angeschlossen, die in der Favela Vigário Geral tätig ist, ironischerweise genau zu der Zeit, als sie von der Drogenbande besetzt wurde, zu der ich früher gehört hatte. Eine absurde Situation, weil ich es hinkriegen musste, die Menschen dort zu schützen, die Sicherheit Unschuldiger zu garantieren, indem ich mir den Respekt und die Beziehungen aus meinem ersten Leben zunutze machte.
Und heute?
Feijão: Ist mein Sohn Lukas zehn Jahre alt und ich führe ein neues Leben. Ich war schon dreimal Gastredner beim lateinamerikanischen Wirtschaftsforum, einmal habe ich auch auf Einladung der UNESCO in der London School of Economics gesprochen.
21 Uhr: Unser letzter Gast erscheint: Caio Rangel, 18 Jahre alt, Jugendspieler bei Flamengo Rio de Janeiro und der Nationalmannschaft. Er wird begleitet von seinem Vater und seinem Pressesprecher Gabriel Badaró. Rangel trägt eine goldene Uhr, in jedem Ohr steckt einen Brillantohrring. Er wirkt schüchtern.
Schön, dass Sie es noch geschafft haben!
Gabriel Badaró: Verzeihen Sie, wir wollten viel früher kommen. Caio hat morgen Training und muss früh raus.
Gleich kommen wir zu Ihnen, ja? Herr Lins, Sie haben neulich in einem Interview gesagt, Rio sei ein Sehnsuchtsort für hüftsteife Europäer.
Lins: Ja, das war in einem Interview zu meinem neuen Buch über den Samba. Maravilha: Und er hat ja recht. Die Weißen, die nach Brasilien gekommen sind, sind alles Menschen, die gescheitert sind, bei denen irgendwas nicht geklappt hat. Der Adel, das sind die Schwarzen, die gegen ihren Willen aus Afrika gekommen sind.
Lins: Wissen Sie, der Samba ist eine wichtige Angelegenheit für uns Brasilianer. Und es waren die Schwarzen, die ihn uns geschenkt haben.
Maravilha: Vergessen Sie nicht, dass Brasilien erst 1888 die Sklaverei abgeschafft hat, als letzte Nation Amerikas.
Lins: Noch Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Samba-Musiker verfolgt und eingesperrt. Man musste nur ein Tamburin dabeihaben, schon wurde man schikaniert. Samba ist so viel mehr als Musik oder Tanz, Samba ist eine Sache des Herzens, Samba ist Liebe, und man kann über ihn mit seinen Vorfahren in Verbindung treten. Es gibt Leute, die verschwinden aus Rio, wenn Karneval ist, das verstehe ich nicht. Ich komme jedes Jahr wieder, weil ich Karneval so liebe.
Maravilha: Weißt du, was mir Sorgen macht, Paulo? Die vielen evangelikalen Sekten, die Neupfingstler, die sich bei uns breitmachen. Diese Leute sind extrem autoritär und spaßfeindlich. Die sagen, Jesus mag keinen Samba, und die Leute glauben es. Wenn das so weitergeht, gibt es bald niemanden mehr, der singt und tanzt. Die verbieten schwarzen Frauen ja sogar, das Haar lang und kraus zu tragen. Inzwischen drehen sich schwarze Frauen auf der Straße nach mir um, weil ich die Haare so trage, wie sie ihre früher getragen haben. Wir leben in einer verkehrten Welt.
Feijão: Die Evangelikalen werden echt zu einem Problem. Im Amazonasgebiet rotten sie ganze Stammeskulturen aus.
Ende des 19. Jahrhunderts waren noch 99,7 Prozent der Brasilianer katholisch, jetzt sind es nur noch 64 Prozent. Gleichzeitig werden die Evangelikalen jedes Jahr mehr, inzwischen machen sie rund dreißig Prozent aus.
Feijão: Im Grunde finde ich es ja in Ordnung, wenn jeder Gott da sucht, wo er möchte, aber die übertreiben es wirklich, die halten die Menschen absichtlich fern von Bildung, versprechen ihnen das Himmelreich und ziehen ihnen gleichzeitig das Geld aus der Tasche.
Feijão muss los. Er wohnt in einer Favela ganz im Norden der Stadt. Zum Abschied umarmt er die anderen Gäste, besonders lange Elke Maravilha. »Mensch, Elke«, sagt er, »als Kind habe ich dich immer im Fernsehen gesehen.«
Caio, Sie leben den Traum jedes brasilianischen Jungen, Sie spielen bei Flamengo, dem bekanntesten Verein der Stadt. Wir haben gehört, dort werden jedes Jahr nur drei von 800 Bewerbern genommen. Wie haben Sie das geschafft?
Caio Rangel: Ach, ich bin ein einfacher Junge. Früher habe ich mit meinen Eltern im Complexo do Alemão gelebt, aber das war unpraktisch, weil ich jeden Tag sechs Stunden mit dem Bus fahren musste, um auf das Trainingsgelände zu kommen, drei Stunden hin, drei Stunden zurück.
Die Favela Complexo do Alemão war vor der Befriedung fest in der Hand von Drogengangs. Jede Woche gab es Schießereien und Tote. Wie kommt man da raus?
Rangel: Ein paar meiner Freunde sind Drogenhändler geworden, das ist dort ganz normal, aber ich komme aus einer geordneten Familie. Flamengo hat mich zu einem Probetraining eingeladen und genommen. Ich war damals elf.
Garcia: Schon lustig. In Brasilien wollen alle Jungs Fußballspieler werden und alle Mädchen Model. Die Modewelt kann ein ganz schön hässlicher Wettbewerb sein. Models streiten wie Katzen.
Sind Sie fest angestellt?
Rangel: Ja, ich kriege jeden Monat mein Gehalt. Und ich habe eine Wohnung bekommen, mit Hilfe meines Managers und eines Unternehmens.
Heißt das, ein Unternehmen hat in Sie investiert?
Badaró: Kann man so sagen, ja. Das ist eine Firma, die sich an talentierten Spielern beteiligt. Die nehmen nicht jeden. Caio ist seit seinem 14. Lebensjahr in der brasilianischen Jugend-Nationalmannschaft. Natürlich hat er einen Manager, mich als Pressesprecher und Sponsoren.
Sind Sie es, der die Familie unterhält?
Rangel: Auch, aber nicht nur. Mein Vater arbeitet als Lkw-Fahrer, meine Schwester studiert Verwaltung, meine Mutter ist Hausfrau.
Müssen Sie nicht zur Schule?
Rangel: Doch, aber ich will im Juli meinen Abschluss machen, sechs Prüfungen fehlen mir noch. Es ist halt so, dass ich seit Jahren viel unterwegs bin und oft den Unterricht verpasst habe, Gott sei Dank ist meine Mutter eingesprungen.
Wie meinen Sie das?
Rangel: Sie ist statt mir in den Unterricht gegangen und hat mir die Sachen anschließend zu Hause beigebracht. Das war ganz praktisch, weil sie jetzt mit 42 endlich auch einen Schulabschluss in der Tasche hat.
Garcia: Wie sieht ein typischer Tag in deinem Leben aus?
Rangel: Aufstehen um halb sieben, Training von neun bis zwölf, dann Essen, Erholung oder Prüfungen, abends früh ins Bett. Meine Tage sind so voll, ich war neulich zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder mal am Strand. Auch beim Essen muss ich vorsichtig sein, meine Mutter, ja selbst meine Schwester passen auf, dass ich unter der Woche nur Nudeln, Gemüse und Salat esse. Nur am Wochenende gibts auch mal Pommes Frites.
Badaró: Caio ist eben ein Profi. Und natürlich wird er auch beobachtet. Laut Presse interessieren sich Manchester United und der FC Porto für ihn, aber das ist nichts Offizielles. Manchmal werden Gerüchte gestreut, um den Wert zu testen.
Wem gehören eigentlich die Rechte an Caio Rangel?
Badaró: 75 Prozent besitzt Flamengo und 25 Prozent die Familie. Von diesen 25 Prozent gehören 12,5 Prozent seinem Manager Bastos und diesem Unternehmen, von dem wir gesprochen haben.
Was glauben Sie, Caio: Wer wird Weltmeister?
Rangel: Brasilien, Spanien oder Deutschland.
Schauen Sie sich das Endspiel im Maracaña an?
Rangel: Glaube ich kaum. Eher sitze ich zu Hause vor dem Fernseher.
Unsere anderen Gäste waren sich einig, dass das Stadion an Atmosphäre verloren hat. Wie gefällt es Ihnen?
Rangel: Wirklich? Ich finde es viel schöner als das alte.
»Die Favela war mein Universum, ich kannte nichts anderes, also habe ich Kokain, Crack und Marihuana verkauft.«

DER STRAND
in Rio de Janeiro ist mehr als ein Badeort. Er ist ein Identifikationssymbol und vor allem seelisches Zuhause der Cariocas. Hier treffen sie sich, zum Reden, Feiern, Grillen und Fußballspielen. Der Strand ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, von denen jeder knapp einen Kilometer lang ist und unterschiedliche soziologische Gruppen beheimatet. Als Grenzmarkierungen dienen sogenannte Postos (nummerierte Strandkioske). Legendär sind die Strände von Ipanema, Copacabana und Leblon, an denen Tausende von Kleinhändlern Getränke, gegrillten Käse und bunt bedruckte Badetücher aus dünnem Stoff verkaufen, denn eines würde ein Carioca nie machen: ein Handtuch mit zum Strand nehmen.
DIE PROTESTE
Im Juni 2013 fanden in Rio de Janeiro, aber auch in anderen Städten Brasiliens, die heftigsten Bürgerproteste seit dem Ende der Militärdiktatur im Jahr 1985 statt. Aus- gelöst wurden die Unruhen durch eine Erhöhung der Bustarife, die Hunderttausende zum Anlass nahmen, gegen Korruption, Preiswucher und soziale Missstände zu demonstrieren. Am Abend des 20. Juni gingen in ganz Brasilien insgesamt eine Million Menschen auf die Straße.
DIE FAVELAS
Von den sechs Millionen Einwohnern Rios leben 1,2 Millionen in einer Favela - so heißen die rund 1000 improvisierten Armensiedlungen, die meist von Drogenkartellen oder rechten Milizen kontrolliert werden. Seit 2008 versucht die Regierung, die Favelas gewaltsam zurückzuerobern; bis heute gelten vierzig als »befriedet«, das bedeutet, sie sind dauerhaft von bewaffneten Polizeieinheiten besetzt.
DIE FUßBALL-WM
Laut einer Umfrage freuen sich 63 Prozent der Brasilianer auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist nicht viel für ein Volk, das sich als fußballverrückt bezeichnet. Grund für die Skepsis sind die gut zehn Milliarden Euro, die das Turnier kostet - Geld, das viele lieber für Schulen, Krankenhäuser und Straßen ausgeben würden. Das WM-Finale findet am 13. Juli im Maracaña-Stadion in Rio de Janeiro statt.
Fotos: Vincent Rosenblatt / Agentur Focus (Titelbild, Porträts und Gesprächfotos); dpa picture alliance / Felipe Dana; dpa;