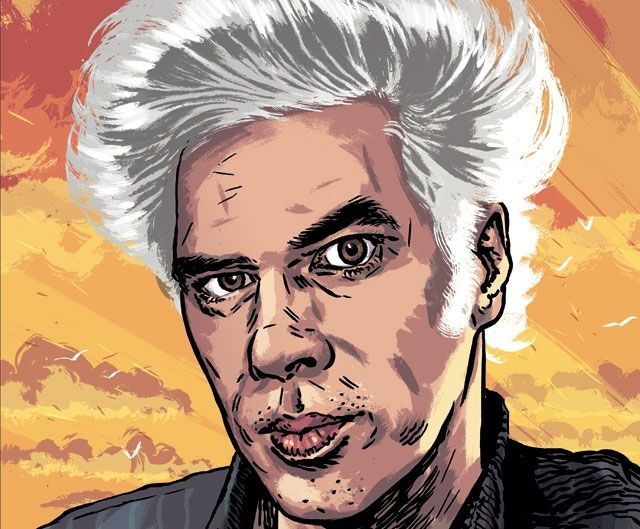SZ-Magazin: Die New York Times bezeichnet Sie als »Botschafter der Coolness«. Der Guardian nennt Sie den »King of cinematic cool«. Schmeichelt Ihnen das?
Jim Jarmusch: Wenn ich jetzt Ja sage, habe ich schon verloren, oder? Das sind ja nur Etiketten.
Aber Ihnen ist klar, dass Sie für eine ganze Generation von Kinobesuchern tatsächlich ein Mann sind, der »cool« definiert – in Ihren Filmen, durch die Figuren, die Sie sich ausgedacht haben, aber auch durch Ihr Auftreten.
Mein Auftreten, na ja … Ich sag Ihnen was: Gestern hat mich eine japanische Journalistin gefragt, wann ich angefangen hätte, meine Haare zu färben. Das war ihr voller Ernst. Ich habe ihr gesagt: Gute Frau, ich bin mit 15 Jahren weiß geworden, wie auch meine Mutter, wie schon meine Großmutter. Das war keine Mode, das war Biologie.
Ihr Freund Tom Waits hat über Sie gesagt, wer mit 15 schon weiße Haare habe, sei zum Außenseiter geboren, und das merke man all Ihren Filmen an.
Da hat er recht. Diese Haare waren von Anfang an ein Thema. In einem der ersten Artikel über mich stand: Der Typ trägt schwarze Klamotten, färbt sich die Haare weiß und dreht Schwarz-Weiß-Filme, was für ein affektierter Socken. Hahaha.
Was macht für Sie Coolness aus?
Ich bin nicht gut in Definitionen. Wir können mal zusammen versuchen, uns dem Begriff zu nähern. Miles Davis hat ein berühmtes Album aufgenommen, Birth of the Cool. In dem Sinne würde »cool« den Übergang vom Bebop zum modalen Jazz bedeuten, also weg von den wilden Gefühlsausbrüchen hin zu einer eher kühlen, gefassten Art von Musik. Das trifft es ganz gut, oder?
New York galt immer als extrem cool. Ist es das heute noch?
Im Gegenteil. Ich lebe da schon lange, aber eigentlich bin ich aus dem mittleren Westen. Wir Midwesterners nehmen uns nicht besonders ernst, wir brüllen auch einfach mal raus, hey, das ist toll, jenes ist scheiße. Für New Yorker bedeutet Coolsein: erst mal abwarten, was die anderen sagen, bloß nicht negativ auffallen. Wenn Sie in New York auf ein Konzert gehen, stehen alle da und schauen links, rechts, wie der Rest des Publikums reagiert, bevor sie sich zur einer Regung hinreißen lassen. Das ist nicht cool, das ist fake.
Was war das Erste in Ihrem Leben, was Sie cool fanden?
Ich war als kleiner Junge mit meiner Mutter und meiner Schwester unterwegs, wir besuchten ein Autokino in Florida und sahen Thunder Road mit Robert Mitchum. Ein Film über Alkoholschmuggler und schnelle Autos. Da dachte ich zum ersten Mal, wow, sind die cool! Das waren Kriminelle, aber gute Kerle. Stark, mit schnellen Autos. Alles drin. Und natürlich Mitchum. Cooler gehts kaum.
Mit Robert Mitchum haben Sie später dann selbst einen Film gedreht.
Dead Man, ja. Sein letzter.
Da war er fast achtzig – und immer noch cool?
Oh ja. Ich war am Set ständig versucht, den anderen zuzuflüstern: Pssst, Leute, das ist wirklich Robert Mitchum! Wenn wir hier nach einer Definition von cool suchen, ist er ein gutes Beispiel: Er war in seinen Filmen immer das wandelnde Understatement. Kein Ton zu laut, keine Geste zu viel. Er hat sich auf seine Wirkung verlassen. Absolut cool. Und – noch ein guter Punkt – er machte in seinen Szenen immer den Eindruck, dass er schlauer ist als alle anderen, einer, der nichts beweisen muss. Wenn einem jemand das Gefühl vermittelt, da ist noch mehr, er lässt nur nicht alles raus: Das ist cool.
In den Achtzigerjahren, als Sie berühmt wurden, wollte jeder cool sein. Was bedeutete das damals?
Da bedeutete es in erster Linie, nonkonformistisch zu sein. Nicht mit dem Strom zu schwimmen. Sich abzugrenzen.
Rauchen war damals noch cool.
Stimmt. Sehr cool. Überall Rauchwolken.
Warum heute nicht mehr?
Weil es ganz offensichtlich ein Irrtum war. Vor fünf Jahren habe ich damit aufgehört. Ich habe wahnsinnig gern geraucht. Aber irgendwann dachte ich, hey, du hast genug geraucht für drei Leben, es reicht.
Wie haben Sie es diesmal geschafft? Sie hatten doch schon öfter versucht aufzuhören.
Erstens habe ich dieses Allen-Carr-Buch gelesen, Endlich Nichtraucher! Zweitens habe ich mich selbst für zehn Tage völlig isoliert – und mir dabei, ganz entscheidend, täglich zweimal den Film The Sword of Doom angeschaut. Das ist der nihilistischste, krasseste Film, den Sie sich vorstellen können. Handelt von einem psychopathischen Samurai. Ein Schlachtfest. Das hat geholfen. Wer mit dem Rauchen aufhört, wird unruhig und wütend, der Samurai hat all diese Gefühle für mich ausgelebt. Dieses Buch mit diesem Film – vielleicht sollte ich das als Jim-Jarmusch-Stop-Smoking-Paket verkaufen. Übrigens hat sogar Allen Carr eine ganz gute Anmerkung zum Thema Coolness. Er schreibt sinngemäß, wenn du mit dem Rauchen aufhörst, dann tu das, aber predige nicht anderen, dass sie auch aufhören sollen. Genau das ist cool: Mach dein Ding und lass die anderen in Ruhe.
Vor dreißig Jahren haben Sie schon mal mit allem auf einen Schlag aufgehört. Alkohol, Drogen, Zigaretten, Kaffee, Tee, Fleisch, Zucker – mit allem, was irgendwie als ungesund gilt. Warum?
Ein Experiment. Angeregt durch William S. Burroughs. Der hat in kalten, klaren Worten über sich und seinen Körper geschrieben. Was all die Substanzen mit ihm anstellen. Wie stark zum Beispiel Marihuana ist, merkt man erst, wenn man mal damit aufhört. Koffein genauso. Sogar Zucker. Also wollte ich das damals ausprobieren.
Und wie ging es Ihnen dabei?
Ich war ein Wrack. Ich konnte nicht schlafen, kaum reden, ich war aggressiv und hilflos. Ein Albtraum. Kann ich niemandem empfehlen.
Stimmt es, dass Sie Tom Waits und Iggy Pop mit ihren Rollen in Coffee and Cigarettes wieder zum Rauchen gebracht haben?
Ja, aber das war keine Absicht! Tut mir heute noch leid. Ich wusste nicht, dass sie beide kurz zuvor aufgehört hatten. Dann rauchten sie für den Film ein paar Zigaretten, und schon waren sie wieder Kettenraucher. Und sauer auf mich. Aber heute rauchen beide nicht mehr. Alles gut.
Ihre Filme, vor allem die frühen, gelten als cool.
Na ja. Finden Sie? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich als Gewährsmann für dieses Thema so wohl fühle. Wir können uns gern mit Coolness beschäftigen, aber ich will, dass Sie wissen: Ich sehe mich selbst nicht als den coolsten Typen der Welt oder so.
In Ihren Filmen sind es diese endlosen Einstellungen, in denen wenig passiert, die lässigen Großstädter, die irgendwo abhängen. Paul Auster hat Ihre Figuren beschrieben als »lakonische, zurückgezogene, traurige Murmler«.
Aber sie taumeln oft auch etwas. Ich glaube, mich interessieren Figuren am meisten, wenn sie genau dazwischen liegen, wenn sie cool sind, aber auch ein bisschen hilflos.
In Ihren früheren Filmen sind die Charaktere immer auf der Suche nach irgendetwas. Paterson, die Hauptfigur Ihres neuen Films, ist der Erste, der einfach völlig zufrieden ist. Er arbeitet als Busfahrer, schreibt Gedichte, geht abends ein Bier trinken. Wie kommt’s?
Weiß ich nicht genau. Vielleicht eine Frage des Alters. In den vergangenen zehn Jahren habe ich mich viel mit asiatischer Kampfkunst befasst. Tai Chi, Qigong. Ich habe dabei gelernt, dass es im Leben vielleicht doch nicht so sehr darum geht, gegen den Strom zu schwimmen, sondern eher den Strom zu nutzen. Früher war ich so: (haut Faust gegen flache Hand), heute eher so: (bewegt Faust auf Hand zu, lässt dann beide zusammen in einer fließenden Bewegung weitergleiten). Haha, das klingt jetzt als Antwort ziemlich affektiert, was?
Denken Sie manchmal an Figuren aus Ihren früheren Filmen zurück? Fragen Sie sich, was würde Ghost Dog jetzt tun?
Nein. Die Figuren sind da draußen in der Welt, die wollen nichts mehr von mir wissen. Sie haben ihr eigenes Leben. Obwohl doch, eine Figur ist noch mal zurückgekommen. In Dead Man gab es einen »Nobody«, gespielt von Gary Farmer, der wurde getötet. Und das tat mir irgendwie schrecklich leid. Als ich dann Ghost Dog drehte, habe ich dieselbe Figur noch mal zurückgebracht, in einem anderen Jahrhundert, auf einem Hochhausdach in der Großstadt. Da wäre er fast wieder erschossen worden. Aber diesmal hat er es geschafft. Und das beruhigt mich. Ich wollte ihn nicht als Toten in meinem Unterbewusstsein rumschwirren haben. Jetzt lebt er. Vielleicht geht es ihm gut.
Paterson nun dichtet den ganzen Tag, aber er ist rätselhafterweise nicht daran interessiert, seine Gedichte zu veröffentlichen.
Er will sich in der Gesellschaft nicht durch seine Gedichte definieren. Er beschäftigt sich einfach nur gern mit der Form des Gedichts. Diese Art von Ehrgeizverweigerung ist mir sehr sympathisch. Und ich glaube, das verbindet praktisch alle großen Künstler: Sie lieben zuallererst die Arbeit an sich, die Arbeit mit der Form, also dem Gedicht oder dem Bild oder dem Song. Das Öffentlichmachen der Kunst ist ihnen viel weniger wichtig.
Aber Künstler wollen doch gehört werden.
Viele auch nicht. Nehmen Sie Emily Dickinson. Eine der bedeutendsten Dichterinnen der amerikanischen Geschichte. Ihre Gedichte wurden in einer Truhe gefunden, als sie schon tot war! Oder der Portugiese Fernando Pessoa. Der hat so viel geschrieben, aber nichts davon zu Lebzeiten veröffentlicht, das haben sie alles erst nach seinem Tod 1935 ausgegraben.
Jetzt idealisieren Sie aber ziemlich. Der Künstler als einsamer Schaffender, der sich selbst genügt – das sind doch Ausnahmen.
Klar gibt es auch viele andere Fälle. Das sind eben zwei grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen. Gutes Beispiel: Es gibt in New York die Ghetto Film School, da lernen junge Leute aus der Bronx, wie man Filme dreht. Ich gebe da ab und zu Kurse. Vor einiger Zeit habe ich dann mal einen Kurs an der Princeton University gegeben, also Oberklasse, Elite, reiche Kids. Und die fragten ständig nur: Wo kriege ich einen Agenten her? Wie komme ich nach Hollywood? Wie lernt man die richtigen Leute kennen? Die Kids an der Ghetto Film School dagegen kamen, mein völliger Ernst, mit Fragen wie: Wenn Sie eine Farbe im Film einsetzen, denken Sie dann darüber nach, ob sie ein bestimmtes Gefühl vermittelt? Die einen wollen wissen, wie mache ich einen Film – die anderen wollen wissen, wie mache ich Kohle. Paterson interessiert sich null für Kohle.
Für den Film haben Sie sich viel mit Poesie beschäftigt.
Ja, so ist der Film überhaupt erst entstanden. Paterson ist ein Epos in Gedichtform von William Carlos Williams, erschienen in mehreren Bänden Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Darin beschreibt er den Ort Paterson wie einen Menschen. Das hat mich fasziniert. Ich schrieb mir irgendwann mal nur kurz in mein Notizbuch: Ein Mann namens Paterson lebt in Paterson. Working-Class-Typ, fährt einen Bus durch die Stadt, ist außerdem ein Dichter. Mehr war es nicht. Diese Notiz habe ich ewig in meinem Notizbuch mit mir herumgetragen. Ist mir erst Jahre später wieder aufgefallen.
Sie haben sich viel mit Filmgeschichte befasst, viel mit Rockmusik – wie kamen Sie denn jetzt, mit Anfang sechzig, auf Dichtung?
Fasziniert hat sie mich immer schon, sie spielte nur in meinen Filmen keine große Rolle. Poesie ist großartig, weil sie manchmal so reduziert ist, manchmal fast mysteriös. Ein Dichter, ich glaube, es war Lawrence Ferlinghetti, hat mal gesagt: Du kannst ein Gedicht verstehen, ohne zu wissen, was es bedeutet. Das finde ich großartig. Außerdem lässt das Gedicht mehr Raum als der durchgeschriebene Text. Die Leerstellen erhalten einen Wert. Da sind wir wieder bei Miles Davis. Der hat gesagt: Die Töne, die ich nicht spiele, sind genauso wichtig wie die Töne, die ich spiele.
Haben Sie selbst auch mal Gedichte geschrieben?
Ich habe es versucht. In New York lebte früher Kenneth Koch, wichtiger Mann, gehörte zur New York School, das ist so eine Gruppe von zeitgenössischen Dichtern und Avantgarde-Künstlern. Er ist leider schon vor 15 Jahren gestorben. Von ihm habe ich mir ein bisschen was beibringen lassen.
Wie geht das: sich Dichten beibringen lassen?
Er hat mir zum Beispiel ein Rilke-Gedicht gegeben. Auf Deutsch. Und er hat gesagt: Jim, bis übermorgen machst du eine Übersetzung. Ich meinte, äh, ich kann kein Deutsch. Er darauf nur: Genau. Er wollte, dass ich mich an allem orientiere außer am Naheliegendstem, dem Inhalt. Ich sollte mir ansehen, wie lang die Zeilen sind, wie Rilke zwischen langen und kurzen Wörtern wechselt, wo er Pausen lässt. Koch wollte, dass ich Rilkes Gedicht als Ausgangspunkt nehme, um etwas Neues zu schaffen.
Warum haben Sie dann die Gedichte für Paterson nicht selbst geschrieben?
Weil ich nicht gut genug bin. Das habe ich dem Dichter Ron Padgett überlassen, auch einer aus der New York School. Der ist super. Zum Teil habe ich Szenen extra um seine Gedichte herumgebaut. Aber im Film kommt das Gedicht eines kleinen Mädchens vor – immerhin das habe ich geschrieben. Eigentlich hatte ich Ron gebeten, es umzuschreiben, aber er meinte, Jim, du klingst wie ein kleines Mädchen, das können wir so lassen.
Paterson schreibt seine Gedichte ganz altmodisch in ein Notizbuch. Man darf Sie schon für einen Nostalgiker halten, oder?
Ach was! Ich habe ein iPhone, ein iPad, ich schneide meine Filme seit 1996 auf digitalem Equipment – aber ich schreibe auch immer noch mit einem Stift. Und mein nächster Film wird wahrscheinlich wieder in Schwarz-Weiß sein. Man kann es sich aussuchen, das ist doch der Witz. Ich mag den Gedanken nicht, dass nur, weil etwas Neues existiert, das Alte sofort obsolet sein soll. Als die Fotografie erfunden wurde, hat doch auch niemand gesagt, ab sofort bitte nie mehr zeichnen.
Es hätte sich natürlich auch nicht so hübsch gemacht, wenn Paterson seine Gedichte an der Bushaltestelle in ein iPhone tippt.
Vor allem ist es schön, all die verschiedenen Techniken parallel zu verwenden. Die eine Art von Notiz ist vielleicht auf einem iPad genau richtig aufgehoben, eine andere gehört eher in ein vergilbtes Notizbuch und muss da auf ihren Moment warten, so wie meine Paterson-Idee.
Das Smartphone hat den Vorteil, dass man auch andere Dinge damit machen kann, nicht nur Notizen.
Das ist eher ein Nachteil. Jetzt starren die Leute ständig auf ihr Handy. Die Phone-Zombies auf der Straße machen mich aggressiv. Ich würde sie manchmal am liebsten umschubsen. Nur um sie aufzuwecken. Ich wohne in New York, richtig mittendrin, im fünften Stock, und wenn ich abends aus dem Fenster schaue, sehe ich unten lauter Köpfe vorbeischweben, die von unten beleuchtet sind. Es schaut richtig unheimlich aus!
Ihre Filme haben alle ein sehr eigentümliches Tempo. Ob Permanent Vacation, Ihr erster Film, oder jetzt Paterson, da ist alles immer wahnsinnig langsam. Warum?
Das kommt Ihnen nur so vor, weil um uns herum alles immer hektischer wird.
Und wie schaffen Sie es dann, Ihr Tempo zu halten?
Ich höre auf den Film. Ich lasse ihn auf mich wirken und warte ab, was er von mir verlangt.
Klingt ziemlich esoterisch.
Nein, das ist, wie wenn andere Musik machen. Man jammt ein bisschen, schaut, wie sich der Groove entwickelt, probiert ein paar Töne hier aus, eine Gitarre da. Man schaut einfach, was passt und wie viel der Song verträgt.
Und dann fällt es Ihnen ganz leicht?
Nein, manchmal ist es schwierig. Bei Mystery Train damals gab es eine Szene, für die ich einen Kran gemietet hattte. Wahnsinnig teuer. Die Kamera fuhr also rauf und folgte einem Zug, wunderschöne Einstellung. Aber beim Schnitt habe ich gemerkt, der Film will das nicht, das passt da nicht rein. Ich habs reingeschnitten, wieder rausgenommen, wieder eingebaut … Ich bin furchtbar wütend geworden, ich habe im Schneideraum getobt: Ich will das da drin haben! Das muss da rein! Aber der Film sagte nur schulterzuckend: Pff, mir doch egal, ich wills nicht.
Trotzdem, wie ertragen Sie die viele Stille? Viele werden schon nervös, wenn sie mit anderen Leuten schweigend in einem Aufzug stehen.
Ich mag genau solche Situationen. Haben Sie Night on Earth gesehen?
Ja.
Da wollte ich mich mit den Momenten beschäftigen, die sonst jeder Film weglässt: den Taxifahrten. Mich fasziniert besonders das, was wir normalerweise für nicht dramatisch, für nicht essenziell, nicht aussagekräftig halten. Ich werde nervös, wenn es irgendwo zu viel Aussage gibt. Bei zu viel Handlung ist es dasselbe – macht mich nervös. Wie Musik mit zu vielen Noten. Es gibt Gitarristen, die eine Million Töne pro Minute spielen können, technisch unglaublich professionell, aber es sagt mir rein gar nichts. Ich nehme lieber einen guten Akkord und lasse den schön im Raum stehen.
Musik hat in Ihrer Arbeit immer eine große Rolle gespielt. Was war die erste Musik, die Sie cool fanden?
Ich hatte als Teenager ein kleines Transistorradio – jeder in meiner Generation wird Ihnen ungefähr diese Geschichte erzählen –, und nachts, wenn ich schlafen sollte, lag ich unter meiner Decke und habe Radio gehört. In Akron, Ohio, wo ich aufgewachsen bin, gab es zwei Sender, ich weiß ihre Namen heute noch, WHLO und WAKR. Nachts haben die R’n’B gespielt, Black Music, ein bisschen Rock’n’Roll. Ich lag da mit weit geöffneten Augen und dachte: Das ist alles so aufregend und mysteriös. Und so cool!
Was genau war daran cool?
Vor allem, dass es nicht die Musik meiner Eltern war. Da ging es los mit dem Nonkonformismus. Ich mochte Motown, Smokey Robinson, das wurde mir aber schnell zu nett, dann entdeckte ich das rauhere Zeug, Screamin Jay Hawkins und so. Manches davon wirkte so … gefährlich. Ich hatte den Eindruck, ich kriege da als kleiner Junge schon ein bisschen was vom späteren Leben mit, von den Abenteuern der Großen. Später kam der Punkrock dazu.
Sie haben mal gesagt, ohne die Ramones hätten Sie keinen einzigen Film gemacht.
Ja, aber ob es stimmt, weiß ich nicht. Es klingt zumindest gut, oder? Die Ramones waren so reduziert, so schnell, so lustig. Ich habe mich oft mit Iggy Pop darüber unterhalten: Rock’n’Roll braucht immer ein bisschen was von dem, was wir den stupid factor nennen. Sonst wär es nicht interessant. Und die Ramones hatten weiß Gott viel stupid factor. Wer hat denn sonst Songs über Cheeseburger geschrieben? Und nur mal ein Gegenbeispiel – ich will nichts Böses über U2 sagen, echt nicht, aber an denen ist alles immer so ernst, so bedeutungsvoll. Da fehlt der stupid factor. Und deshalb sagt mir U2 rein gar nichts.
Das heißt, ab einer gewissen Breitenwirkung können Sie mit Kunst nichts mehr anfangen?
Mich interessieren nun mal eher die Nischen, in der Musik wie im Film. Ich höre mir Ty Braxton an, nicht Justin Timberlake. Ich schaue mir Heaven Knows What von den Safdie Brothers an, eher nicht Star Wars. Aber das klingt jetzt schrecklich versnobbt. Manchmal ist auch der Mainstream aufregend. Ich liebe Kendrick Lamar. Ich mochte Nirvana. Und ich stand total auf Terminator. Finden Sie mich jetzt noch cool?
Illustration: Benjamin Güdel