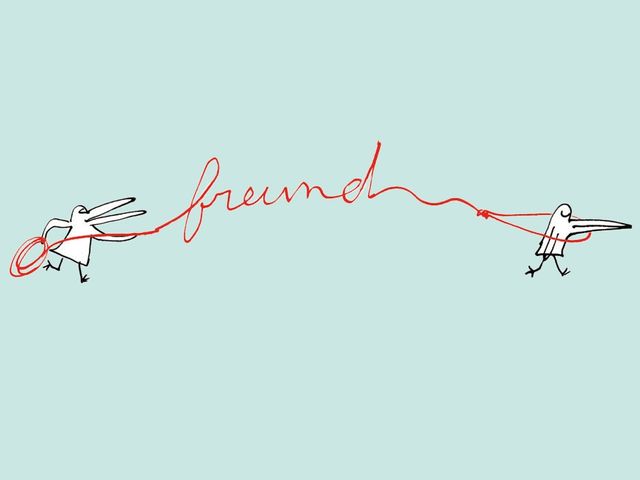16 Bundestagswahlen fanden in Deutschland nach dem Ende des Nazi-Regimes statt. Zehn Mal durften die Christdemokraten das wichtigste Amt im Staat, das Kanzleramt, besetzen. Die Sozialdemokraten konnten nur sechs Mal den Kanzler stellen. Bei der nächsten Bundestagswahl kann die Union die amtierende Kanzlerin Angela Merkel erneut ins Rennen schicken. Die SPD muss hingegen wieder mit einem neuen, ihrem zehnten Kandidaten antreten. Kurt Beck als Parteivorsitzender wäre an sich der geborene Kandidat. Doch hätte Beck irgendeine Chance, Kanzler zu werden?
Rein machtpolitisch betrachtet ist nach der nächsten Bundestagswahl durchaus eine Konstellation denkbar, bei der die SPD auch als zweitstärkste Partei durch Bildung einer Ampelkoalition mit der FDP und den Grünen oder in einer Linksregierung mit den Grünen und der Linkspartei den Kanzler stellen könnte. Doch um wirklich legitimiert zu sein, den Kanzler in welcher Koalition auch immer stellen zu können, müsste die SPD stärkste Partei werden. Das aber ist aus heutiger Sicht schwer vorstellbar. Seit Monaten dümpelt die SPD an oder unter der 30-Prozent-Marke und liegt somit nicht nur klar hinter der Union, sondern auch deutlich unter dem ja schon schlechten Ergebnis bei der Neuwahl des Bundestags 2005. Im Augenblick wollen mehr als 40 Prozent der SPD-Wähler von 2005 ihre Stimme nicht mehr der SPD geben. Politische Stimmungen können sich zwar bis zum Zeitpunkt der nächsten Bundestagswahl noch ändern. Doch nicht nur die aktuellen schlechten Umfragewerte, sondern auch die Ergebnisse der Landtagswahlen seit 2005 zeigen, dass der Auszehrungsprozess der SPD weiter voranschreitet (der ja schon lange vor der Regierungszeit Gerhard Schröders begann und bei den Bundestagswahlen 1998 und 2002 nur unterbrochen wurde). In der Summe der sechs Landtagswahlen 2006/2007 (Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen) verlor die SPD im Vergleich zu den letzten Landtagswahlen ein Viertel, im Vergleich zur letzten Bundestagswahl sogar ein Drittel ihrer Wähler.
Anders als es Kurt Beck darzustellen versucht, setzt sich der Vertrauensschwund der SPD auch nach 2005 und nach seiner Übernahme des Parteivorsitzes auf allen Ebenen der Politik fort. Selbst in Rheinland-Pfalz erreichte die SPD die absolute Mehrheit der Mandate im Landtag nur deshalb, weil ein Drittel der potenziellen CDU-Wähler wegen der Schwäche ihres Kandidaten nicht zur Wahl ging.
Kurt Beck ist nun nicht verantwortlich für den seit Jahren andauernden Wählerschwund der SPD. Aber er hat diesen fortschreitenden Vertrauensverlust auch nicht aufhalten können. Dazu entfaltet er zu wenig Bindekraft. So würden sich im Sommer 2007 nur noch 16 Prozent aller Wahlberechtigten (unter Einschluss der Nichtwähler) für ihn entscheiden, wenn sie den Kanzler direkt wählen könnten.
Dabei wurde Kurt Beck nach der Übernahme des Parteivorsitzes zunächst eher wohlwollend und freundlich beurteilt. Er besaß zwar außerhalb seines Landes Rheinland-Pfalz keine politischen Konturen, wurde aber als sympathischer Kumpeltyp eingeschätzt, von dem man erhoffte, er würde auch ein Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen und – anders als Angela Merkel – auch für die der »kleinen Leute« haben. Entsprechend stiegen Becks Werte bei der Kanzlerfrage von 26 Prozent im April 2006 auf 31 Prozent Ende Oktober/Anfang November. Von den SPD-Mitgliedern erwarteten im April 2006 93 Prozent, dass Kurt Beck seine Arbeit als SPD-Vorsitzender gut machen werde, 90 Prozent meinten, er sei eine gute Wahl.

Doch ein Jahr nach seinem Amtsantritt hat sich Ernüchterung bei den Bürgern und vor allem den SPD-Anhängern und Parteimitgliedern eingestellt. Vor allem aber hat Kurt Beck den Rückhalt bei den eigenen Anhängern in dramatischer Weise verloren. Von den SPD-Wählern der Bundestagswahl 2005 würden sich Mitte 2007 noch nicht einmal 30 Prozent für Beck entscheiden, 44 Prozent dagegen für Merkel. Merkel verfügt somit nicht nur bei allen Wahlberechtigten über einen großen Vorsprung (plus 40 Prozentpunkte!) vor Beck, sondern liegt auch bei den SPD-Wählern vor dem SPD-Vorsitzenden.
Nach einem Jahr ist von den hohen Erwartungen der SPD- Mitglieder wenig geblieben, tiefer Frust und große Hoffnungslosigkeit haben sich breitgemacht: Nur noch eine Minderheit von 48 Prozent meint, Beck habe seine Arbeit gut gemacht. Während im April 2006 noch 73 Prozent der SPD-Mitglieder erwarteten, die Chancen der SPD seien mit Kurt Beck gestiegen, glauben dies ein Jahr später nur noch 33 Prozent. Folge-richtig glaubt auch eine Mehr-heit von 56 Prozent der SPD-Mitglieder nicht daran, dass Kurt Beck die SPD aus ihrem jetzigen Stimmungstief herausführen könnte, und nur eine Minderheit der potenziellen SPD-Wähler (29 Prozent) hält Kurt Beck für den richtigen zehnten SPD-Kanzlerkandidat.
Das hat wenig mit von Beck unterstellten Kampagnen der Medien oder einiger Meinungsforscher, viel aber mit der Person Kurt Beck und seiner Wahrnehmung durch die Bürger zu tun. Nachdem die Menschen Kurt Beck ein Jahr beobachtet haben, hat er Profil bekommen – allerdings ein weit-gehend negatives. So hielten Beck im April 2006, als er noch keinerlei Konturen aufwies, 19 Prozent für vertrauenswürdig. Nach einem Jahr als SPD-Vorsitzender ist der Anteil auf 13 Prozent gefallen. Dass er »auf der Seite der kleinen Leute stehe«, glaubten im Frühjahr 2006 14 Prozent, ein Jahr später tun dies nur noch neun. Als »modern« schätzten ihn 2006 12 Prozent ein; 2007 finden dies noch sieben. Bei den SPD-Anhängern gehen auch diese Werte jeweils überdurchschnittlich stark zurück.
Für das schwache Erscheinungsbild Kurt Becks im Sommer 2007 ist er selbst verantwortlich: Zu unglücklich wirken inzwischen seine Auftritte. So war zum Beispiel sein Auftritt am Abend der Bürgerschaftswahl in Bremen in der Pose eines Wahlsiegers alles andere als geeignet, ein Signal der Hoffnung an die verunsicher-ten und frustrierten SPD-Anhänger zu senden. Gestützt auf zu positive SPD-Zahlen der ARD (die die SPD in Bremen bei 42 Prozent verortet hatte; das Wahlergebnis lag dann nur bei 36,8) hatte Beck gehofft, der SPD-Basis mit der Verkündung eines Wahlsieges wieder Mut zu machen. Die Siegerpose behielt er auch bei, als sich abzeichnete, dass die SPD an der Weser bei einer Bürgerschaftswahl noch nie so wenig Wähler mobilisiert hatte und sich der Wählerschwund der Partei auch in Bremen fortsetzte. Vor dem Hintergrund des Stimmenrückgangs der SPD wirkte Becks Auftritt ebenso wirklichkeitsfremd wie viele andere.

Er glaubt zudem, die schlechten Umfragewerte seien »weit weg von der Wirklichkeit«. Doch wer der Realität so weit entrückt ist wie Kurt Beck und sich wie in einer Scheinwelt bewegt, dürfte kaum die Probleme der Welt bewältigen können. Immer mehr Menschen zumindest sehen dies inzwischen so – anders als Kurt Beck –, zumal da der SPD-Chef auch im Umgang mit der erstarkenden Linken weder Strategien noch Impulse erkennen lässt.
Zunehmend werden zudem auch Erinnerungen an seinen glücklosen Vorgänger im Vorsitz der SPD, den ebenfalls aus Rheinland-Pfalz stammenden Rudolf Scharping wach. Auch Scharping hatte nach seiner Wahl zum SPD-Vorsitzenden im Sommer 1993 und seiner Kür zum Kanzlerkandidaten Schwierigkeiten, sich außerhalb seiner gewohnten Umgebung in Rheinland-Pfalz souverän und für die Menschen nachvollziehbar und angemessen zu verhalten. Weil er zunehmend die Realität nicht mehr wahrnehmen wollte oder konnte, bescherte er nicht nur der SPD ein Stimmungstief, sondern lähmte nach seiner Wahlniederlage 1994 die gesamte deutsche Politik. Es bedurfte damals des Sturzes durch Oskar Lafontaine auf dem Mannheimer Parteitag 1995, um die Politik aus dieser Erstarrung zu befreien. Übrigens hatte Scharping bei der Frage, wen die Deutschen als Kanzler wollen, bessere Werte als Beck heute.
Während Rudolf Scharping in seiner bundespolitischen Rolle kläglich einbrach, brachte es ein dritter Rheinland-Pfälzer, Helmut Kohl, nicht nur zum Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten seiner Partei, sondern auch zum Kanzler mit der bisher längsten Amtsdauer. Doch auch Kohl hatte lange Schwierigkeiten, sich außer-halb seines Heimatlandes souverän zu bewegen. Pannen und Peinlichkeiten begleiteten Kohl bis in die ersten Jahre seiner Kanzlerschaft hinein. Kohl aber übernahm den CDU-Vorsitz mit 42 Jahren; Kanzler wurde er mit 52. Wollte man Kurt Beck eine ähnlich lange Lernphase zubilligen, wäre er 66 Jahre alt. Überdies ist fraglich, ob Beck aufgrund seiner bisherigen Biografie in der Berliner Republik überhaupt Chancen hätte, in die Rolle eines Kanzlerkandidaten hineinzuwachsen. Beck, in die beginnende Phase des Wirtschaftswunderlandes hineingeboren, wuchs trotz seiner Herkunft aus »kleinen« Verhältnissen letztendlich in einem behüteten Biotop auf – regional verwurzelt und sehr früh in einem von der Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung geprägten Milieu verankert. Beck wurde seit seinem 23. Lebensjahr, als er freigestellter Personalratsvorsitzender wurde, von der alten, damals noch funktionierenden »Klassenerhöhungsmaschine« der SPD und der Gewerkschaft von Funktion zu Funktion getragen. Kämpfe, auch gegen seine Partei wie etwa Gerhard Schröder, musste er dabei nie austragen.
Vielleicht hindert Kurt Beck heute die Begrenztheit dieses Milieus daran, die Wirklichkeit außerhalb seiner bisherigen »heilen« Welt richtig einzuschätzen.
Foto: ddp