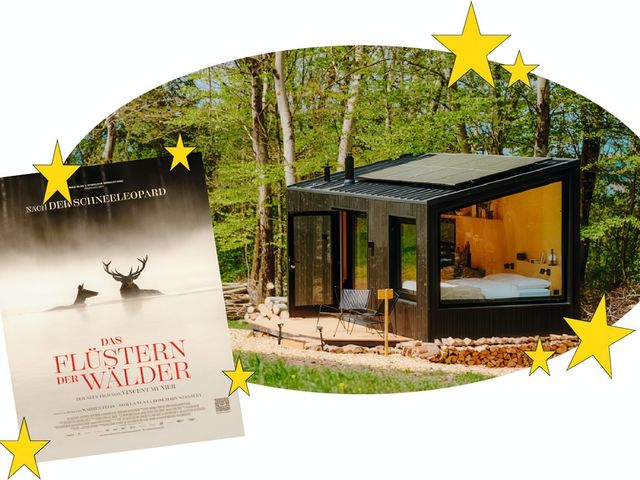Grandios war die Abschiedsgala Zinédine Zidanes. Ohne den Kopfstoß im Endspiel gegen den Italiener Materazzi hätte er Frankreich wohl zum zweiten WM-Titel nach 1998 geführt und sich selbst auf die höchste Stufe, neben Pelé und Maradona. Aber auch so war die Energieleistung des 34-Jährigen bei der WM 2006 sensationell.
Obwohl er in den Gruppenspielen noch wie ein Seniorenkicker agiert hatte, gegen Südkorea sogar entkräftet vom Rasen musste und angeblich voller Frust eine Kabinentür im Leipziger Stadion eintrat. Aber Frankreich blieb im Rennen, und plötzlich drehte Zidane auf. So wie Ronaldo, sein moppeliger Kollege von Real Madrid, der trotz jäh ansteigender Formkurve mit Brasilien im Viertelfinale scheiterte – an den Franzosen um den furiosen Zidane. Heute werden solche Leistungssprünge im Kraft- und Ausdauerbereich misstrauisch beäugt, überall. Nur nicht in der vornehmsten aller Sportarten: König Fußball verbittet sich jeden Verdacht. Hier gilt, was schon der Doyen der berüchtigten deutschen Sportmedizin, der Freiburger Olympia-Arzt Joseph Keul selig, formulierte: Doping bringt nichts. Ja, es stört die koordinativen Fähigkeiten, die so ein komplexer Sport dem Spieler abverlangt. Großes Indianerehrenwort: Fußballer dopen nicht.
Das Totschlagargument von vorgestern gilt noch heute. Erst im Mai beteuerte DFB-Internist Tim Meyer, im Fußball seien »die komplexen leistungsbestimmenden Faktoren der beste Schutz« vorm Pharmabetrug. Und fügte das zweite Mantra der Kickermedizin an: »Es gibt keine Erkenntnisse, dass im Fußball Doping in systematischer Weise betrieben wird.«
Eine kühne Behauptung. Im Fußball gilt wie überall, dass Ärzte und Aktive, die Betrug treiben, diesen öffentlich immer abstreiten werden. Umgekehrt werden Ärzte, die gegen Doping sind, nie ins Zentrum von Betrugspraktiken vorstoßen. Die einen werden immer lügen, die anderen niemals drin sein in der Materie. Dabei scheut just der schwerreiche Fußball, der nie um staatliche Fördermittel bangen musste, unabhängige Kontrollen. Trainingstests gibt es praktisch nicht: 87 in der Saison 2006/07, für erste und zweite Bundesliga und die Regionalligen. Dass sich selbst da noch Sünder finden, spricht Bände.
Gerade im Fußball steigt die athletische Anforderung ständig und rasant. Eine dänische Studie zeigte Ende der Neunzigerjahre, dass Kicker früher sieben, acht Prozent der 90-minütigen Spielzeit volles Tempo gingen – heute sind es gut 15 Prozent. Wurden einst fünf Kilometer pro Spiel zurückgelegt, sind es heute bis zu zwölf. Zugleich nimmt die Zahl der Pflichtspiele zu, die Erholungszeit wird kürzer. Schon 1999 klagte Frankreichs Weltmeister Emmanuel Petit: »Es kommt so weit, dass wir alle Doping brauchen. Einige tun es schon jetzt.«

Viele sagen das. Und bekommen damit kein Problem: Sie wissen, sie haben nichts zu befürchten, solange sie keine Namen nennen. Wer will schon ein Judas sein? Diesen stillen Deal kennt man auch aus dem Radsport. Die Verbände bleiben untätig – und können triumphieren: Es hat ja wieder keiner Ross und Reiter genannt. Doppelpässe im Schweigekartell.
Es steht außer Frage, dass Anabolika in der Regeneration den Muskelaufbau fördern, Testosteron die Erholungsphase verkürzt und das Blutdopingmittel Epo die Ausdauer im Spiel stark verbessert. Testosterone oder Epo können im Training sorglos konsumiert werden, sie sind, wenn überhaupt, nur 48 Stunden nachweisbar, wirken aber noch tagelang intensiv. Auch an Spieltagen, an denen es kaum Blutkontrollen gibt. So wenig, wie bei den 228 Tests während der WM 2006 oder den 256 bei der WM 2002. Es ist also Unfug, die WM als sauber zu bezeichnen: Ein überhöhter Hämatokritwert (ein wichtiges Indiz für Blutmanipulationen) fällt nicht auf, wenn ihn niemand misst.
Es wurde immer gedopt, was das Zeug hält, heute läuft es weitflächig ab. Das Gerede vom komplexen Spielsport ist ein Bauerntrick, den einer wie Otto Rehhagel aus dem Fußgelenk beherrscht: »Wer mit links nicht schießen kann, trifft den Ball auch nicht, wenn er 100 Tabletten schluckt.« Klar, Pharmazie fördert weder Balltalent noch Spielverständnis. Aber Epo hilft jedem Kicker, dem nach einer
Stunde die Beine schwer werden. Der formidabelste Techniker taugt nichts, wenn ihm die Zehntelsekunde fehlt, die den Ballbesitz ermöglicht, der halbe Schritt, der ihn in Schussposition bringt, die Zentimeter, um dem Gegner das Spielgerät abzujagen. Frag nach bei Kraftpaket und Dopingsünder Maradona, bei Zidane oder im Fußballarchiv. Fußball und Doping, diese Verbindung reicht bis zum Berner Wunder zurück.
Bis heute ist ungeklärt, ob Sepp Herbergers Recken den 0:2-Rückstand im WM-
Finale 1954 gegen spielerisch dominante Ungarn nur mit Traubenzucker im Blut umbogen oder was sonst in den Spritzen in der Weltmeister-Kabine war. Ungarns Kapitän Ferenc Puskas vermutete Doping. Franz Loogen, damals DFB-Teamarzt, schwört, er habe nur Placebos gesetzt. Sporthistoriker haben indes massive Argumente dafür gesammelt, dass die Wunder-Elf mit Pervitin hantiert hat. Pervitin ist ein stimulierender Stoff, der schon 1954 laut einer Studie des Freiburger Doktoranden Oskar Wegener als »stärkste und anhaltendste« Droge galt: Das Mittel vertreibe »jedes Müdigkeitsgefühl und durch seine euphorische Komponente das Startfieber, da hier der Drang zum Sieg jedes Bedenken überwiegt«. Bei Athleten steige die Leistungsfähigkeit bis zu 25 Prozent.
Tatsächlich wurde Pervitin im Krieg massenhaft benutzt, um deutschen Soldaten die Angst zu nehmen und ihre Aggressivität zu steigern. Unter den Medizinstudenten in Kriegszeiten, zu denen auch Loogen zählte, galt es als wunderwirkende Fliegerdroge; es wurde über Traubenzucker verabreicht. Und schau an: Herberger, so gestand Loogen dem Sporthistoriker Erik Eggers, habe vor der WM »den Doping-Einsatz« gefordert. Herberger war in Kriegszeiten mit der Soldatenmannschaft der Fliegergruppe »Rote Jäger« verbandelt, wo er auch Fritz Walter und weitere Nationalspieler unterbrachte. Dies ist für den Dopinghistoriker Giselher Spitzer die Nahtstelle, an der das Wissen um die Fliegerdroge in den Fußball kam. Nachweislich wurde in Bern viel gespritzt; warum Injektionen riskiert wurden, wenn es doch nur um Glukose ging, kann bis heute niemand erklären. Obwohl die Frage dramatisch ist: Viele Berner Helden erkrankten an Gelbsucht, einige starben sogar an Leberzirrhose.
Übergehen wir die Dopinghistorie der ostdeutschen Klubs; dass vor deren Europacup-Spielen Amphetamine eingesetzt wurden, ist durch Stasi-Akten verbürgt. Dieselben Stoffe wie im Westen, wo das Aufputschmittel Captagon in den Siebziger- und Achtzigerjahren Dauerbrenner unter Profis war. Dies berichtete der frühere Dortmunder Stürmer Peter Geyer (»Ich nahm zwei Tabletten, andere sieben oder acht«), 13 Jahre bevor es der Trainer Peter Neururer (»bis zu 50 Prozent nahmen es«) in diesem Jahr wieder aufgriff.

Doch solche Zeugen werden schnell mundtot gemacht, nicht mal die Branchenhelden konnten sich Gehör verschaffen: Franz Beckenbauer berichtete 1977 im Stern über seine Eigenblut-Praktiken, die unbedenklich seien, verglichen mit dem, was sonst ablaufe: »Medizinisch ist heute in der Bundesliga praktisch noch alles erlaubt, was den Spieler zu Höchst- und Dauerleistung treibt. Es wird gespritzt und geschluckt … Natürlich wäre es unsinnig, vor jedem Spiel zu dopen. Der folgende Leistungsabfall ist viel zu groß. Aber was machen Trainer und Manager vor entscheidenden Spielen, etwa im Europacup, wo es um Millionen geht – wenn man glaubt, dass die anderen nicht nur Vitaminpillen schlucken? … Es ist längst an der Zeit, dass sich der Internationale Fußballbund nicht nur bei der Weltmeisterschaft um das Problem Doping kümmert .«
Später bezeichnete FC-Bayern-Klubarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt Captagon-Einsatz im Fußballsport generell als »fast harmlos im Vergleich zu dem, was heute genommen wird«. Sein Vorgänger Erich Spannbauer wurde sogar selbst auffällig, als er in den Achtzigerjahren die Nordisch-Athleten versorgte. Auch Spannbauers Kollege Heinz Liesen geriet unter Beschuss. Dem langjährigen DFB-Verbandsarzt hielt Nationaltorhüter Toni Schumacher in seinem Buch Anpfiff vor, die deutsche Elf mit »Hormönchen« präpariert zu haben. Doch nicht Hormondoping im Nationalteam wurde zum Thema, sondern der Enthüller – die Nationalmannschaftskarriere Schumachers war beendet.
Bei den Bayern geriet auch Dettmar Cramer ins Visier, der den Verein in den Siebzigerjahren trainierte. Sepp Maier behauptete in einem Buch, dass »der Cramer kleine weiße Tabletten verteilt hat, mir aber keine geben wollte, weil ich sie nicht brauchte. Ich sei schon aufgedreht genug. Auf meine Frage, was das für Tabletten seien, antwortete er augenzwinkernd: ›Salztabletten. Die sollen bloß meinen, es wäre Doping.‹ Ein bisschen habe ich mich gewundert, warum ich dann keine bekommen habe.«
Nettes Anekdötchen? Es gibt, wenn man nur beim Übungsleiterpersonal des Branchenführers bleibt, Kontinuität bis heute. Trainer Felix Magath plädierte nach seinem Rauswurf in München für Anabolika-Einsatz in der Regeneration. Auch Kollege Rehhagel war einst bei Arminia Bielefeld von Dopingfahnder Manfred Donike attackiert worden. Später, bei Rehhagels EM-Titelgewinn mit Griechenland 2004, wurde viel über das eiserne Stehvermögen der Hellas-Elf geraunt, an dem die spielerisch überlegenen Gegner einfach zerschellten.
Der DFB und sein globales Pendant FIFA machten stets, was sie wollten. Die FIFA schickt nach Ende einer WM ihre Leute in die Dopinglabore, um alle negativen Proben zu vernichten, statt sie, wie bei Olympia, acht Jahre aufzubewahren, um später mit besseren Methoden fahnden zu können. DFB und DFL verließen sich bisher lieber auf eigene »Vertrauensärzte« statt auf unabhängige Instanzen. Ihre Sachwalter sind so gutgläubig, dass es wehtut. Zum Bundesliga-Start beklagte der frühere Liga-Chef Wolfgang Holzhäuser, »dass man derzeit händeringend darauf wartet, dass es auch im Fußball einen echten Dopingsünder gibt«. Für ihn ist klar, was auch der Verband stets betont: »dass der DFB in Sachen Dopingkontrollen vorbildlich arbeitet und weit mehr macht als viele andere Verbände«.
Seit 1988 betreibt die Branche Tests. Die lassen sich allerdings schnell als Mogelpackung entlarven. Vergangene Saison gab es 964 – oft angekündigte – Wettkampfproben bei 241 Partien der Bundes- und Regionalligen, bei Spielen der A-Junioren, der beiden Frauen-Bundesligen sowie im DFB-Pokal. Dazu besagte 87 Trainingstests. Im selben Zeitraum fanden allein in der Leichtathletik 1020 Trainingskontrollen statt. »Die Fußballtests sind lächerlich«, sagt der Heidelberger Dopingexperte Werner Franke. Dazu passt ein Befund der Nationalen Antidopingagentur NADA: Unter 100 auffälligen Testosteronwerten in der Jahresbilanz 2006 rangiert der DFB mit neun Fällen auf Platz zwei – hinter der Leichtathletik (21 Fälle). Dort aber gab es zwölfmal so viele Trainingstests.
Für NADA-Vorstandschef Armin Baumert gilt daher »knallhart: Fußball ist keine dopingfreie Zone«. Dick Pound, kanadischer Chef der Welt-Antidopingagentur, sagt: »Selbstverständlich macht Doping für Fußballer Sinn.« Und selbst Paul Breitner sagt: »Ich würde nicht mit dem Finger auf die Radfahrer zeigen.«

Wie ist das also mit dem unbändigen deutschen Kampfgeist, der so legendär ist wie die italienische Dominanz im Europacup der Neunzigerjahre? Letztere wurde von der Justiz als Pharmabetrug entlarvt: Zwischen 1994 und 1998 holte Juventus Turin drei Meistertitel, den Weltpokal und drei Finalteilnahmen in der Champions League – eine eindrucksvolle Bilanz, die laut Strafurteil durch mit »kriminellem Plan« verabreichte Dopingstoffe zustande kam. Im Prozess gegen Juve-Manager Giraudo und Klubarzt Agricola sagte Gutachterin Lanterno: »Es gab Abnormalitäten, wie bei Didier Deschamps, der im Juni 1996 einen Hämatokritwert von 51 Prozent aufwies, zwölf Prozent mehr als ein Jahr zuvor!«
Systematisch gedopt wurde in den Neunzigern auch bei Olympique Marseille, Ex-Profi Tony Cascarino berichtete in Buchform darüber. Kollege Jean-Jacques Eydelie beschrieb Blutdoping beim FC Sion von 1997 bis 1999. Im Jahr 2004 wunderte sich Arsène Wenger, der Coach von Arsenal London: »Einige Spieler, die zu uns wechselten, wiesen eine abnorm hohe Anzahl roter Blutkörperchen auf« – weshalb er glaube, »dass manche Klubs Spieler ohne ihr Wissen dopen«. Auf Nichtwissen haben sich auch überführte Weltklasse-Doper wie Stam, Davids oder Guardiola stets berufen. Für andere gilt, was der Bruder eines französischen Erstligaklub-Chefs dem Sportsoziologen Gerhard Treutlein verriet: »Weißt du, warum französische Fußballer in der zweiten Halbzeit besser spielen als in der ersten? Weil die Dopingtests in der Halbzeit stattfinden!«
Deutschland. Frankreich. Italien. England. Und Spanien? Als Zidane von Turin nach Madrid wechselte, freute er sich, dass Juves »Kreatin-Kuren« vorbei seien. Doch offenbar blühten ihm bei Real neue Anwendungen. All das, was der berüchtigte Dopingdoktor Eufemiano Fuentes für den Königsverein angeblich aufgelistet und die französische Zeitung Le Monde publiziert hat: In exakten Dosen und Zyklen, identisch mit den Medikationsplänen, die er für Dutzende Radprofis um Jan Ullrich erstellt hatte. Doch während die Radsportdokumente bei Razzien in Fuentes’ Madrider Wohnungen sichergestellt wurden, sorgten mysteriöse Kräfte hoch über Spaniens Ermittlungsbehörden dafür, dass die Fußballakten in Fuentes’ Stammdomizil in Gran Canaria unberührt blieben. Selbst das Madrider Material wurde bis heute nicht richtig untersucht: Fünf sichergestellte Laptops warten noch auf die Auswertung.
Dabei sagt Fuentes selbst, dass er Fußballstars betreute – »teils direkt, teils über die Klubärzte« – und dass ihn Klubs wie der FC Barcelona umgarnt hätten. Der Radprofi Jesús Manzano bezeugt, er habe Real-Stars bei Fuentes ein- und ausgehen sehen. Der Hexer gibt zwar kein Doping zu. Aber warum sonst sollte sich die Creme der iberischen Fußballklubs, neben Real angeblich der FC Barcelona, Betis Sevilla und Valencia, um einen Gynäkologen reißen? Auf Druck von Spielerfrauen?
Die Klubs bestreiten alle vehement, mit dem Blutexperten kooperiert zu haben. Barcelona hat Le Monde deshalb auf Rufschädigung verklagt. Autor Stéphane Mandard nimmt es gelassen. Beim Anwalt, sagt er, liegen Fuentes’ Dopingpläne für den Fußball, und falls es zum Prozess kommt, werden eben erstmals auch spanische Richter die Dokumente zu Gesicht kriegen. Sie weisen laut Le Monde dieselbe Handschrift und Zeichensprache auf wie die Papiere, die der kanarische Medico für das verseuchte Radteam Liberty Seguros und andere erstellte; vom Kreis, der anabole Steroide symbolisierte, bis zum Kürzel IG für Insulin-Wachstumshormone. Glaubt man den Papieren, hat Fuentes in der Saison 2005/06 für Barcelonas Champions-League-Programm gearbeitet. Barca triumphierte.
Als Le Monde Fuentes zum Fußball befragte, wich der aus: »Man hat mich dreimal mit dem Tode bedroht, wenn ich konkrete Dinge erzähle. Es wird kein viertes Mal geben.« Umso schlimmer, dass bisher kein spanischer Ermittler die Papiere sehen wollte. Was übrigens Fuentes nicht verwundert: »Es gibt Sportarten, gegen die kommt man nicht an, weil sie eine enorme Justizmaschine aufbauen können. Die kann sogar jene um den Job bringen, die den Sport regieren.« So scheint in der größten Dopingaffäre des Spitzensports die abstruse Macht des Fußballs auf. Seit Monaten rätseln Justiz und Sportwelt, warum der Madrider Staatsanwalt plötzlich Ermittlungen einstellte, die weit gediehen waren – zu weit? Die Todesangst des Doktor Fuentes, die Ignoranz des Staatsanwaltes gegenüber Zeugen und Arzneiplänen: Der Verdacht, dass manches von oben gesteuert wird, liegt nahe in einer fußballverrückten Nation, deren Vereine das Prädikat »Königlich« im Namen tragen.
Und Zidane? Geriet er, der viele Jahre im Dopingprogramm von Juve zubrachte, auch in Fuentes’ Finger? Das lässt sich anhand der Papiere spekulieren. In Frankreich wurde bekannt, wie er zu Blutpraktiken generell steht. Die nationale Rocklegende Johnny Hallyday verriet 2003, er suche zur Regeneration gern eine Schweizer Klinik auf, wo ihm Blut entnommen, mit Sauerstoff geladen und reinjiziert werde. Der Tipp stamme von einem Freund, der sich das selbst zweimal im Jahr gönne: Zinédine Zidane.
Eine spannende Spur aus dem Fuentes-Komplex führt zur WM nach Deutschland. In ein Frankfurter Hotel, wo ein Statthalter von Fuentes eine mobile Dependance für die internationale Kundschaft betrieben haben soll. Der geständige Doping-Kron-zeuge aus dem Radfahrerlager, Jörg Jaksche, beurteilt dies so: »Für Radfahrer war diese Einrichtung nicht bestimmt – schon gar nicht zu der Zeit, als in Deutschland WM war.«
Fachleute und Fans sind stutzig geworden. Sport Bild ließ jüngst ermitteln, dass nur 16,6 Prozent an eine saubere Bundesliga glauben – 15,9 Prozent glauben an flächendeckendes Doping, 61 Prozent an vereinzelten Betrug. Der aufgeschreckte DFB veranstaltete kurz vor Saisonbeginn ein Dopingseminar, das erste überhaupt. Stolz verkündete Wilfried Kindermann, langjähriger DFB-Teamarzt, den Ertrag: »Zielkontrollen in Dopingsensiblen Phasen«, etwa nach Sommer- und Winterpausen, sollen eingeführt werden. Wirklich? Liga-Interimschef Holzhäuser gab Entwarnung: »Ich war schon überrascht, in der Zeitung lesen zu müssen, dass ein gewisser Herr Kindermann erklärte, dass es künftig Trainingskontrollen geben soll.« Da irre sich der Doktor: »Auf der Versammlung ist über Trainingskontrollen konkret nicht gesprochen worden, und eine Beschlussfassung zwischen DFB und DFL ist mir nicht bekannt.«
Dann weiter so. Kann ja nichts passieren.