»Tut wirklich gut, die Sonne im Gesicht!« »Ja, meine ist auch wasserdicht.« »Sag ich doch seit Jahren, der Typ ist ein Wicht.« (Foto: Ricardo Cases)
Aus eigenem Antrieb hätte sie nichts getan. Es waren ja die anderen, die Probleme mit ihr hatten. Ihre Tochter zum Beispiel, die eines Tages sagte: »Du hörst schlecht!« Also ging Ilse Weiß vor drei Jahren dann doch zum Ohrenarzt, der eine Einschränkung des Frequenzgangs vor allem auf dem linken Ohr feststellte. Der Hörakustiker bestätigte diesen Eindruck, legte ihr ein Audiogramm vor, das ihre Unzulänglichkeit sozusagen amtlich bewies, und dann hatte Ilse Weiß auf einmal zwei Hörgeräte zu Hause, die sie in der Schatulle eigentlich schöner fand als in ihren Ohren. Der Hörakustiker hatte gesagt, sie solle sie möglichst dauernd tragen. Ilse Weiß, 79 Jahre, sagt: »Bis heute mache ich sie zu Hause nicht dran. Und wenn ich rausgehe meist auch nicht.«
Natürlich kann ein Hörgerät seine Wirkung nur begrenzt entfalten, wenn es in einer Schublade liegt, das weiß sie selbst. Aber wenn sie es benutzt, macht es ihr Leben oft auch nicht leichter: »Ein einziges Ärgernis!« Als sie einmal damit im Theater war, hatte sie den Eindruck, im Inneren einer Blechdose zu sitzen, so schepperte es. »Stört mich wahnsinnig«, sagt Ilse Weiß. Vielleicht hätte sie sich mehr Zeit nehmen sollen, sich nicht gleich für das zweite Gerät festlegen, aber sie wollte die Sache erledigt haben. »Ein schöner Mist«, sagt sie. Alle paar Monate geht sie zum Akustiker, der freundlich-bemüht daran herumstellt und betont, man sei jetzt auf einem guten Wege. Am Ende spürt sie jedes Mal: keine Verbesserung.
Ilse Weiß ist ein Einzelfall. Sagen die Hörgeräteverbände und Hersteller. Sie reden von der großen Zufriedenheit ihrer Kunden und führen Statistiken an, die belegen sollen, dass die meisten Hörgeräte auch tatsächlich täglich getragen werden. Aber kennt nicht jeder in der Familie oder bei Freunden mindestens einen Senior, der ein teures Hörgerät hat, das er aus unterschiedlichsten Gründen eben nicht trägt? Das in einer Schublade vermodert, möglichst ganz hinten, damit man nicht unangenehm an das viele Geld erinnert wird, das es einmal gekostet hat?
Laut einer Umfrage des europäischen Hörgeräteverbandes sind 73 Prozent der Hörgeräteträger mit ihrem Hörgerät »überwiegend zufrieden«. Wenn aber nun, etwas zugespitzt, 27 Prozent der Hörgeräte eher nicht getragen werden, hieße das übersetzt für den deutschen Markt: Fast 1,5 Millionen Hörgeräte liegen in der Schublade. Legt man einen eher moderaten durchschnittlichen Preis von 1000 Euro zugrunde (ein Hörgerät kann pro Seite durchaus 3000 Euro und mehr kosten), ergibt das ein totes Kapital von rund 1,5 Milliarden Euro.
Als im engeren Sinne schwerhörig gilt laut Weltgesundheitsorganisation, wer eine Hörminderung von mehr als 25 Dezibel hat, also zum Beispiel das Ticken einer Armbanduhr nicht mehr hören kann. Natürlich gibt es einen Grad von Schwerhörigkeit, ab dem man keine Wahl mehr hat, will man nicht außerhalb jeder Kommunikation stehen. Ab dem ein Hörgerät also unbedingt notwendig ist. Aber gerade im Bereich der leichten Schwerhörigkeit scheint es aus Sicht der Betroffenen, die sie oft anders und weniger gravierend empfinden als ihre Angehörigen, durchaus Argumente zu geben, die gegen das Tragen eines Hörgerätes sprechen.
Davon ist auf der 1. Hörmesse im Münchner Alten Rathaus eher weniger die Rede. Der Andrang der Schwerhörigen ist so gewaltig, dass das Haupttor bereits nach einer guten Stunde vorübergehend geschlossen werden muss. Das führende bayerische Hör-akustik-Unternehmen Seifert hat zum »InfOHRmationstag« geladen. Auf dem Rednerpult unter holzgetäfeltem Gewölbe Seifert-Geschäftsführer Wolfgang Luber, der sich zunächst für die schlechte Akustik entschuldigt. »Sie können auf Induktionsspule stellen« – eine Einstellung, die das Hören in großen Hallen erleichtert. Luber sagt, er verspreche, es gehe heute nicht um die Firma Seifert. Was nicht ganz stimmt. Aber zu einem 50. Firmenjubiläum darf und muss man als Geschäftsführer schon ein paar Worte verlieren dürfen. Erst recht, wenn man der Veranstalter ist.
Luber hat also gerade ein bisschen über seine 70 Filialen und die guten Aussichten der Branche gesprochen, als sich in der mittleren Reihe »spontan« eine Mutter erhebt, die der Firma Seifert im Namen ihrer Tochter danken möchte, weil ihr neues Hörgerät sie wieder mit dem Leben verbunden habe. Sie übergibt einen Strauß »Esperanza-Rosen«, »weil Hörgeräte doch Hoffnung machen«, und lobt die netten Akustiker bei Seifert. Weil das jetzt ein bisschen wie auf einem Parteitag ist, beeilt sich Herr Luber zu sagen, dies sei nicht geplant gewesen. Auch wenn es ja ganz gut passt.
Im Folgenden reden Wissenschaftler, Ärzte, Akustiker und ein paar Mitarbeiter der Firma Seifert. Fast alle folgen dabei einem ähnlichen Schema. Erst zeichnen sie auf, wie sich der Schwerhörige in die Isolation begibt. Dann bieten sie den Ausweg an. Professor Hamann von der HNO-Klinik Bogenhausen folgt dieser Redetechnik am konsequentesten: Soeben also hat er erzählt, dass zwar 88 Prozent der Risikogruppen einen Sehtest machen, aber nur 44 Prozent einen Hörtest. Dass Schwerhörige häufiger stürzen, wovor man sich in Winter ja sowieso fürchtet. Er hat die Deutschland-Zahl – 14 Millionen Schwerhörige – in großen Buchstaben an die Wand projiziert, »eine traurige Zahl«, wie er sagt und dabei besonders traurig guckt, um dann überzuleiten zu dem, was er »Nachholbedarf« nennt: In leuchtendem Rot unterlegt erscheint an der Wand: »7 Millionen unterversorgte Schwerhörige. Einzig sinnvolle Therapie: Hörgeräteversorgung.«
»Man muss es wollen«
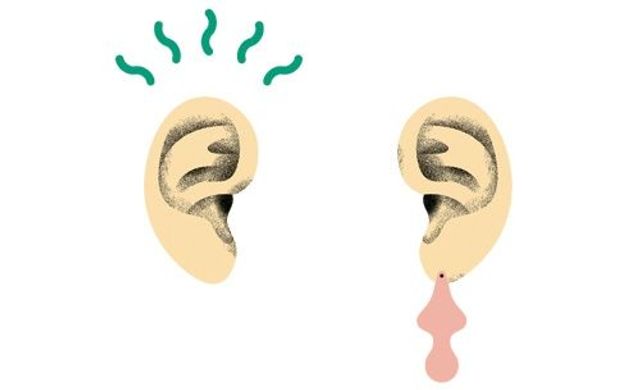
Beim gesunden Menschen wird der Schall von der Ohrmuschel in den Gehörgang gelenkt. An dessen Ende beginnt das Trommelfell zu schwingen. Eine dahinterliegende Kette von Gehörknöchelchen verstärkt die Bewegung, das letzte Knöchelchen drückt wie ein Stempel auf die Flüssigkeit in der Gehörschnecke des Innenohrs. Dieser Impuls wird über mehrere Reihen von Haarsinneszellen registriert und schließlich als Nervenimpuls weitergegeben in Richtung Hörzentrum des Gehirns. Die meisten Schwerhörigkeiten gehen auf eine Schädigung jener Haarzellen zurück. Für eine ganze Industrie bedeutet das: Innenohr minus Haarzellen mal Patienten gleich Umsatz. Die Gewinnsteigerungen der Hörgerätebranche sind seit Jahren zweistellig. Die 14 auf dem deutschen Markt tätigen Firmen setzten 2011 etwa 890 000 Geräte ab, macht rund 1,3 Milliarden Euro Umsatz durch Geräteverkauf und Anpassung. Weltweit gibt es rund 800 Millionen Schwerhörige, das entspricht 16 Prozent der Weltbevölkerung. Und es werden ständig mehr: Wunderbare Zeiten für alle, die ihr Geld mit den Schwächen des Alterns verdienen.
Die vermutlich erste Hörhilfe in der Geschichte der Menschheit war es, die hohle Hand hinter das Ohr zu legen. Die Produktion technischer Hilfen begann gegen Ende des 18. Jahrhunderts: Schalltrichter mit einem Schlauch, den man ins Ohr steckte.
1895 entwickelte der New Yorker Ingenieur Miller Reese Hutchinson das erste elektrische Hörgerät. Ein großes Batterie-Gehäuse, das aussah wie ein tragbares Rundfunkgerät, mit einem telefonähnlichen Empfänger, der ans Ohr gehalten werden musste. Das Grundprinzip ist bis heute das gleiche: Ein Mikrofon am Höreingang wandelt die eingehenden Schwingungen in elektrische Signale um, die, verstärkt über einen Mini-Lautsprecher, wieder als akustische Signale abgegeben werden. 1958 produzierte Philips das erste Hinterohrgerät, Anfang der Siebzigerjahre kamen die noch kleineren Innenohrgeräte auf den Markt. Mit der Digitalisierung erhöhte sich auch die Rechenleistung: Verbarg ein Hörgerät 2002 in seinem Inneren 50 000 Transistoren, sind es heute bis zu 16 Millionen – auf einem kaum fingernagelgroßen Chip. Spätestens alle zwei Jahre kommen verbesserte Platinen auf den Markt. Moderne Geräte können Details herausarbeiten, Frequenzen selektiv verstärken, Hintergrundgeräusche unterdrücken, auf die Richtung des Gesprächspartners fokussieren und lassen sich via Bluetooth mit Telefon oder Fernseher verbinden.
Hörakustik-Läden gleichen heute eher Designshops als biederen Sanitätshäusern. Die Einrichtung suggeriert Modernität, die Branche tut alles, um das Image des Hörgerätes aufzuwerten. Ein modisches Accessoire soll es sein, wie es die Brille schon lange ist. Opas klobiger fleischfarbener Hinterohr-Bolzen hat ausgedient: Die neue »Audéo Yes«-Linie des Weltmarktführers Phonak, stolze 2380 Euro pro Ohr, gibt es in den Trendfarben »Roter Burgunder«, »Nuss Nougat« oder »Grün vor Neid«. Natürlich ist es kein Hörgerät mehr, sondern ein »Hörsystem«. Laut Prospekt besticht es neben brillantem Design mit einem Hightech-Innenleben, das sich hinter einer
Reihe von schmissigen Begriffen verbirgt: SoundRecover, ZoomControl mit Direct Touch, SoundFlow Automatic, WhistleBlock-Technologie und Real Ear Sound. Das kann zwar nicht jeder aussprechen, aber es klingt verheißungsvoll und dicht an der Zeit. Auch wenn man sie schon lange nicht mehr ganz versteht.
Wieso also bleiben trotz allen technischen Fortschritts so viele teuer gekaufte Hörgeräte mehr oder weniger ungenutzt? Jan-Christian Fross, Deutschland-Sprecher des Weltmarktführers Phonak, antwortet indirekt: »Man muss das Hören völlig neu erlernen.« Insbesondere deshalb, weil im Schnitt sieben bis zwölf Jahre vergehen, bevor sich der Betroffene für eine Hörhilfe entscheidet. In dieser Zeit aber habe sich das Gehirn bereits umgewöhnt, der Körper habe sich mit der Situation arrangiert. Das Hörzentrum im Gehirn speichert Laute und Geräusche auch nach einer auftretenden Hörminderung noch bis zu drei Jahre. Dann aber, spätestens jedoch nach sieben Jahren, wird der Speicher gelöscht. Eingehende Signale können nicht mehr dekodiert und in Informationen umgewandelt werden. Wenn nun längst vergessene Geräusche, wie zum Beispiel Autolärm, wieder in den Alltag treten, fühlt sich der Betreffende mitunter gestört. Eine Flut von Impulsen strömt auf den Hörgeräteträger ein, die das Gehirn erst einmal verarbeiten muss.
Auch Seifert-Chef Wolfgang Luber macht im Wesentlichen die Hörentwöhnung für die Schwierigkeiten mancher Hörgeräteträger verantwortlich. »Hören bedeutet eben auch ständige Denkleistung.« Eine gewisse geistige Flexibilität sei dabei durchaus hilfreich. Es ist ja nicht wie bei einer neuen Brille, wo einfach umgeschaltet wird von unscharf auf scharf, es bedarf auch eines gewissen Durchhaltevermögens: Bis zu einem Dreivierteljahr könne die Anpassung des Gerätes dauern, »mindestens 50 Prozent des guten Hörens bestehen in der Dienstleistung des Hörgeräteakustikers«. Deshalb sei es auch eine denkbar schlechte Motivation, ein Hörgerät zu kaufen, um anderen damit einen Gefallen zu tun. »Man muss es wollen«, sagt Luber, »sonst geht es nicht!«
Kommt ihm jemand blöd, nimmt er einfach das Gerät raus.

Diese Einschätzung teilt Renate Welter, Vizepräsidentin des Deutschen Schwerhörigenbundes, auch aus ihrer eigenen Erfahrung. Sie bekam 1980 die ersten Hörgeräte und trug diese zunächst, wenn überhaupt, nur wenn es berufsbedingt nötig war, zum Beispiel in Besprechungen. Aber auch bei ihr vergingen Jahre vom ersten Hörverlust bis zum Hörgerätekauf. »Wenn man die Geräte bekommt, sind durch die Hörentwöhnung Töne, Geräusche, aber auch Sprache oft sehr unangenehm, sodass einen das ständige Tragen von morgens bis abends überfordert.« Allerdings sieht sie nicht nur die Patienten in der Verantwortung, sondern nimmt auch Akustiker, die deutlich mehr Feinanpassungen in den Festbeträgen einberechnen müssten, sowie die gesetzlichen Krankenkassen in die Pflicht: »Aus unserer Sicht müsste die Audiotherapie eine als Reha-Maßnahme anerkannte Leistung der gesetzlichen Krankenkassen werden.« Dazu sollten ein spezielles Hör- sowie ein Desensibilisierungstraining bei Geräuschüberempfindlichkeit gehören.
Wenn man in die anthroposophische HNO-Praxis von Bernd Oelmüller in Berlin-Zehlendorf kommt, muss man damit leben, dass man vieles von dem, was er sagt, nicht verstehen kann. Das macht insofern nichts, als die Medizin, die er verschreibt, erstens nebenwirkungsfrei ist. Und zweitens, wie seine Patienten versichern, fast immer hilft. Was Oelmüller sagt, klingt – auch wenn er die schulmedizinische Wissenschaft nicht auf seiner Seite hat – in sich logisch, und selbst, wenn er in metaphysische Grenzbereiche vordringt, ist man als Patient stets überzeugt, dass es genau so sein müsse. Aber nie wäre man in der Lage, später wiederzugeben, was er einem gerade so plausibel erklärt hat. Oelmüller, einer ganzheitlichen Betrachtung von Mensch und Krankheit in der Tradition von Rudolf Steiner zugetan, hat ein Hightech-Hörgerät der neuesten Generation vor sich auf dem Tisch und sagt: »Ein Hörgerät zwingt in den Stress«, man werde in ein aufgeregtes Leben hineingeworfen, dem man bereits entwöhnt sei. Oelmüller, der selbst unter einem Hochtonabfall leidet, sagt, dass er nach zweistündigem Tragen des Hörgerätes an sich feststellt: »Ich bin nervös geworden!« Akustiker verweisen stets auf die Notwendigkeit des Übens. Auf den Arbeitscharakter des Gerätes. Aber wer will außerhalb seiner Arbeit noch arbeiten müssen?
Der ältere Mensch verliert laut Oelmüller durch eine Zunahme von Entzündungen im Kopfbereich – anthroposophisch gesprochen »verdichteter Lebenstätigkeit« – nach und nach die Fähigkeit, hohe Töne zu hören. Insbesondere gelte dies für Leute, die dazu neigen, sich aufzuregen, die kopflastig leben und die er deshalb »Kulturträger« nennt. Gewissermaßen der Antityp zum schwerhörigen »Kulturträger« sei derjenige, der durch Erschlaffung ertaubt, Dickleibige und Menschen mit Stoffwechselstörungen etwa. »Diabetes Typ 2«, sagt Oelmüller. Der Stoffwechsel schlage zu stark in den Kopf hinein, doziert Oelmüller, die Dumpfheit des Bauches wandere nach oben: »Die haben sozusagen Leber in den Ohren.« Wenn auch das Ohr dumpf wird, sackt die Hörkurve auf allen Frequenzen ab. »Der Mensch verplumpt.« Und wird oft auch feinmotorisch ungeschickt. Selbst der Gehörgang werde »zu stoffwechselig«, sodass die Siebe des Hörgerätes schnell verstopfen; die Patienten verfluchen die Geräte, weil sie mit der Reinigung überfordert sind.
Oft stellt aber schon die reine Handhabung ein Problem dar, für Karl Werner zum Beispiel. Er ist 86 und trägt sein Hörgerät gegen den Rat des Akustikers nur, wenn ihm danach ist. Oder wenn ihn seine Frau dazu drängt, weil er sie wieder mal nicht verstanden hat. Vielleicht ist das eine akustische Frage, vielleicht auch nicht. Neulich ist ihm beim Batteriewechsel so ein kleines Plastik-teil abgebrochen, was für sein Dafürhalten zwar keine Funktion hatte, aber in der Folge zu einer gewissen Scharfkantigkeit im Ohr führte. Was für Herrn Werner insofern inakzeptabel war, weil er sowieso oft ein Fremdkörpergefühl verspüre. Einen ganz unerträglichen Juckreiz, der ihn zuweilen regelrecht zwinge, sein Ohr von der Hörhilfe zu befreien. Oft trägt er es aus Bequemlichkeit nicht. Weil er es als Fremdkörper empfindet. Und manchmal, weil sich sein Hörgerät bestimmten Gesprächssituationen nicht gewachsen zeigt. Auf der Weihnachtsfeier hat er sich früh verabschiedet, von allen Seiten hatten Stimmen nach ihm gehackt oder ihn der Umgebungslärm in dumpfe Watte fallen lassen. Ein ungeordnetes Einströmen, ein akustisches Inferno, noch dazu mit Hintergrundmusik unterlegt. Einen Moment hatte Werner geglaubt, er werde verrückt.
Neulich hat er sein Hörgerät nach dem Besuch beim Akustiker versehentlich mit dem Schlüssel aus der Innentasche des Jacketts gezogen. Der Schlüssel riss das Gerät auf, 3200 Euro für eine falsche Handbewegung. Nun hat er ein neues. Aber er verspürt nicht die Notwendigkeit, es einzusetzen. Meistens genügt es ihm zu hören, was er auch ohne Gerät hören kann. Es ist die Stille jener Welt des Übergangs, die ihm ganz neue Räume für seine Gedanken gibt. Er höre lieber ein bisschen angestrengt zu, sagt er, und verstehe eben ab und zu etwas nicht. Und manchmal empfindet er das Hörgerät auch als regelrecht störend. Er fährt immer noch Auto, Frau und Sohn haben versucht, es ihm auszureden, aber in diesem Punkt lässt er nicht mit sich verhandeln. Die Geräusche von überholenden Motorrädern, das Hupen, wenn die anderen sich über ihn beschweren, weil er wieder zu langsam fährt oder in der falschen Spur: Lästig ist ihm das. Sollen sie schimpfen, werden auch mal alt. Kommt ihm jemand blöd, nimmt er einfach das Gerät raus.

