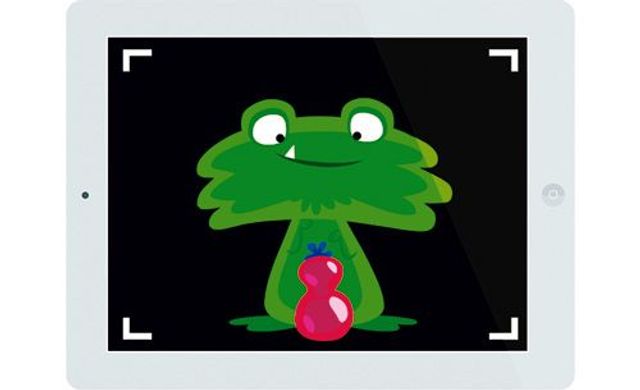Das Baby ist verwirrt. Immer wieder greift es in die Zeitschrift und versucht die Fotos auf dem Papier mit dem Finger zur Seite zu wischen, aber, seltsam, die Bilder bewegen sich nicht. Das kleine Mädchen mit der Windel blickt erstaunt hoch zu seiner Mutter. Es kann noch nicht mal reden, aber man ahnt, was es fragen möchte: »Ist das kaputt?« Die Mutter hat das Ganze gefilmt und auf Youtube gestellt, dazu schrieb sie: »Für meine Tochter wird ein Magazin immer nur ein defektes iPad sein.« Vier Millionen Menschen haben sich den Film angesehen, einer der letzten Kommentare darunter lautet: »Steve Jobs killed this generation.«
Zumindest hat der Apple-Gründer mit dem iPad den Computer noch viel früher in ihr Leben geholt, wie unzählige Internetvideos belegen: Stolze Eltern filmen, wie geschickt selbst neun Monate alte Babys schon Tablets und Smartphones bedienen. Das freut die Industrie: Zehntausende Apps für Kinder gibt es bereits für Android, Apple iOS oder Windows, die beliebtesten Spiele und Lernprogramme werden pro Titel mehrere Millionen Mal gekauft. Klassische Kinderbuchverlage drängen in den Markt, Ravensburger bietet bereits 43 Apps an, es gibt Wimmelbuch- und Pixi- und Conni- und Lego- und Memory-Apps, das ganze alte Kinderzimmer trifft sich auf dem Tablet. Apple schaltete kürzlich doppelseitige Anzeigen, auch in der SZ, auf denen man ein Mädchen sieht, das abends im Kinderbett liegt und im Dunkeln fasziniert auf sein leuchtendes iPad schaut. Zielgruppe Kind. »In Deutschland wird so eine Werbung ganz anders gesehen als in der Türkei, Brasilien oder den USA«, sagt Verena Delius, Geschäftsführerin der Kinder-App-Entwicklerfirma Fox & Sheep. »Eltern in New York, Istanbul oder Rio freuen sich, wenn Einjährige ihr Tablet bedienen können, wir Deutsche sorgen uns viel mehr, dass die Geräte Kindern schaden.«
Zu Recht? Noch sind keine großen Studien dazu veröffentlicht worden, »die Wissenschaft hinkt immer drei bis fünf Jahre hinterher«, sagt Susanne Grassmann, Entwicklungspsychologin an der Universität Zürich. Entsprechend uneins sind die Experten. Grassmann rät: »Bevor ein Kind zwei ist, machen Apps wenig Sinn.« Kristin Langer, Pädagogin beim Medienratgeber "Schau hin!" des Familienministeriums, findet, »Kinder unter drei brauchen keine Apps«. Und der Autor und Hirnforscher Manfred Spitzer, der radikalste Gegner von Kinder-Apps, mahnt, erst »zwischen 15 und 18 Jahren« dem Kind das erste Tablet zu geben, »ich weiß, das hört sich weltfremd an«. Denn es gibt inzwischen in den allermeisten deutschen Familien wenigstens ein Smartphone oder ein Tablet. Doch wie gut oder schlecht sind die darauf verfügbaren Apps für Kinder? Zigtausende dieser Spiele hat der britische Journalist Stuart Dredge getestet, an die tausend davon in den letzten drei Jahren auf der Webseite des Guardian empfohlen. Dredge, selbst Vater von zwei Kindern, vier und sechs, mag etwa die App »Kleiner Fuchs«. Das Besondere an dem digitalen Liederbuch ist die Karaokefunktion: Eltern und Kind können mitsingen und das aufgenommene Lied per E-Mail den Großeltern schicken. Dredges Kinder spielen gern mit der App »Sneak«, bei der sie sich im Wohnzimmer verstecken und ganz still sein müssen, nur dann erscheint auf der App ein Comic-Monster. Per Knopfdruck kann ein Foto vom Monster und den Kindern gemacht werden, die sich dann leise wieder angeschlichen haben. Kann eine App, die Vater und Söhne zum klassischen Versteckspiel animiert, einem Kleinkind überhaupt schaden?
Die Kritiker haben es beim Tablet tatsächlich schwerer als beim Fernseher. »Zombie-Effekt« nennen Medienpädagogen das reglose Verstummen von Kindern, die vor Bildschirmen sitzen und die direkte Ansprache kaum mehr erreicht. Aber das Problem gab es schon zu Zeiten des Schwarz-Weiß-Fernsehers. Und vor einem Tablet-Computer sitzen Kinder nicht mehr regungslos: Der Bildschirm lässt sich berühren, drehen, schütteln.
Entscheidend ist, wie beim Fernsehen auch, dass Eltern das iPad nicht als Babysitter benutzen, sondern gemeinsam mit dem Kind spielen, etwa die animierten Bücher vorlesen, sie erklären. »Ich glaube, dass Tablet-Computer für Kinder nicht das Buch, sondern den Fernseher ersetzen – und das wäre doch ein Fortschritt«, sagt der Journalist Stuart Dredge. In der Schweiz und Kanada wurden iPads von Pädagogen in Kindergärten getestet, das Fazit der Erzieher: in Maßen kein Anlass zur Sorge. Deutlich suchtgefährdeter sind erst die Älteren, Teenager etwa, die ganze Tage vor einem Ballerspiel verbringen können. Vorschulkinder verlieren relativ schnell das Interesse an Apps und spielen am liebsten draußen. Und so bleibt den Kinder-App-Kritikern nur das Kleinstkind.
Fragt man Verena Delius, warum ihre Firma schon Apps für Eineinhalbjährige anbietet, antwortet sie: »Das heißt natürlich nicht, dass man seinem Kind ein iPad so früh geben muss. Aber die Nachfrage ist da, etwa in der Türkei, wo es viele junge Eltern gibt, die sich diese Geräte jetzt leisten können. Und wenn es den Markt gibt, sollten die Apps gut gemacht sein, oder?« Die erfolgreichste App von Delius Unternehmen heißt »Schlaf gut« und wurde bisher 2,8 Millionen Mal verkauft, in zwölf Sprachen, zuletzt auf Arabisch. Die Aufgabe: die Tiere auf einem Bauernhof ins Bett zu bringen. So steht im Stall etwa eine niedliche, müde dreinblickende Kuh. Ein Klick auf den Lichtschalter und es wird dunkel im Stall, die Kuh legt sich hin ins Heubett. »Gute Nacht, liebe Kuh«, sagt ein Erzähler. Bis alle Tiere im Bett sind, dauert es keine fünf Minuten, dann sagt der Sprecher: »Moment, da ist doch noch jemand wach: Du!« Er sagt »Schlaf gut« zum Kind vor dem Tablet und der Bildschirm wird schwarz. Das Spiel hat ein natürliches Ende. Einen Sonnenuntergang, der es Eltern erleichtern soll, das Kind ohne Streit vom Tablet wieder wegzubekommen, gibt es bei »Toca House«, einer App der schwedischen Entwicklerfirma Toca Boca. Deren Spiele für Zwei- bis Sechsjährige gelten als die derzeit besten Kinder-Apps, mehrfach ausgezeichnet wurden sie in 150 Ländern über 40 Millionen Mal heruntergeladen, bei einem Preis von 89 Cent bis 2,69 Euro.
Die erfolgreichste App heißt »Toca Hair Salon«, also Friseur. Das Kind kann lustigen Spielfiguren die Haare schneiden, fönen, färben, zerzausen, glattkämmen und neu wachsen lassen. Gelungene Frisuren können als Foto abgespeichert werden. »Bei ›Hair Salon‹ geht es nicht darum, zu gewinnen, es gibt keine falsche Art, eine Frisur zu machen, und keinen Druck, ein nächsthöheres Level zu schaffen«, sagt der Firmenchef Björn Jeffery. »Man kann sich unmöglich in Dreijährige reindenken«, darum haben sich die Gründer von Toca Boca Spielzeugkataloge aus den Fünfzigerjahren angesehen und sich gefragt, was früher gern gespielt wurde: Weil Kinder oft mit Spielgeschirr den Tisch decken, für ihre Teddys, gibt es die »Toca Tea Party«. Drei Kinder können sich um den Tablet-Computer setzten, jedes sucht sich virtuelle Teller, Tassen und Kuchen aus. »Der Sohn eines Kollegen hat die App getestet und gefragt, warum man den Tee nicht verschütten kann – also haben wir das programmiert, und die Kinder lieben es.« An einer App arbeiten bei Toca Boca vier Leute bis zu einem halben Jahr. »Viele Firmen glauben, sie müssten in Apps für Kinder weniger Zeit stecken als in Apps für Erwachsene«, so Jeffery. »Oder sie kopieren einfach dreist.«
Weil der »Hair Salon« weit oben in den Download-Charts steht, gibt es jetzt mehrere »Friseursalon«-Apps. Dass Jeffery diese Kopien wie überhaupt den Großteil der Kinder-Apps auf dem Markt »richtig schlecht« findet, könnte man als Eigen-PR abtun, aber so sieht es etwa auch die Spieletesterin Johanna Rosenfeld: »Viele Entwickler versuchen, über schnell gemachte Billig-Apps Geld zu verdienen, das macht es für Eltern schwierig, die guten Apps zu finden.« Rosenfeld, die Kinderbücher schreibt, hat mit ihrem Vater selber eine App entwickelt, »und gemerkt, wie kompliziert das ist«. Die Erfahrung machte auch Christoph Niemann. Der weltweit erfolgreiche Illustrator aus Berlin hatte Lust, »eine Zeichnung zum Leben zu erwecken, sie berührbar zu machen«, dafür fertigte er 12 000 Einzelbilder an. Seine »Streichelzoo«-App, in die er »absurd viel Zeit« investiert hat, verkaufte sich 60 000 Mal. Klingt lukrativ, »aber an der App waren einige Leute auf Prozentbasis beteiligt, etwa der Komponist«. Niemanns leicht psychedelisch anmutender Zoo erinnert an Walt Disneys Fantasia-Film. Viele Kinder-Apps kann man kostenlos herunterladen, aber im Spiel gibt es Zusatzfunktionen, für die man zahlen muss – etwa für neue Charaktere. Verbraucherschützer nennen das Abzocke. Niemanns App kostet 89 Cent und verzichtet auf sogenannte In-App-Verkäufe. Er sagt, er wollte nicht, dass ihn Eltern nach dem Kontoauszug hassen.
In seinem Haus in Berlin liegen in den Kinderzimmern hohe Stapel von Papier, die Söhne zeichnen trotz iPads im Haus am liebsten auf die alte Art, mit Stiften. Das freut ihn. Es gibt zwei interessante Parallelen in dieser Geschichte, die alle App-Experten gemeinsam haben: Ob Christoph Niemann, Stuart Dredge, Verena Delius oder Johanna Rosenfeld, alle haben feste Zeiten vereinbart, in denen ihre Kinder mit Apps spielen dürfen, bei Delius Söhnen sind es sogar nur 15 Minuten täglich, obwohl die Mutter mit Kinder-Apps ihr Geld verdient. Und sie alle wissen, dass sie selbst viel zu viel Zeit mit ihren Smartphones verbringen: »Ich habe mich schon dabei erwischt, wie ich auf dem Handy E-Mails checke, während das Kind zum dritten Mal ›Mama, schubs mich an!‹ ruft«, sagt Verena Delius. So ähnlich kann man es auf jedem Spielplatz in Deutschland beobachten: Die Mütter und Väter mit ihren Smartphones, manche mit Tablets und Funk-WLAN, sitzen rund um den Spielplatz mit dem guten Gefühl, den Kindern zu zeigen, dass die echte Welt viel schöner ist als die virtuelle. Für den Gegenbeweis müssen die Kinder nur vom Sandkasten aufsehen: auf den sie umgebenden Kreis der Internetsüchtigen. Ja, in Deutschlands Familien gibt es ein Problem mit den neuen mobilen Medien. Aber die kleinen Kinder gehen noch am vernünftigsten damit um. Die Eltern sind das größere Problem.
Foto: Marek Vogel