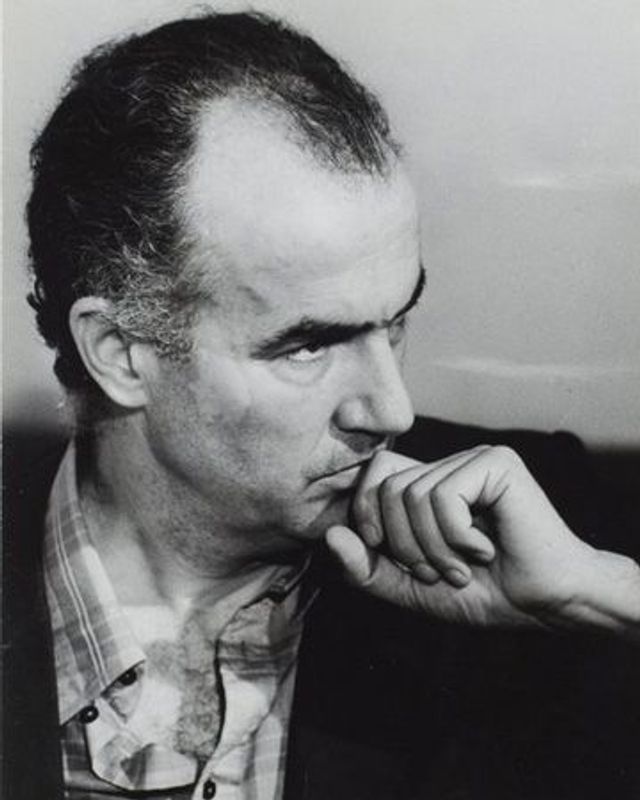SZ-Magazin: Frau Schoenberg Nono, fürchten Sie sich vor der Zahl 13?
Nuria Schoenberg Nono: Ich? Nein.
Aber Ihr Vater. Und seine Angst hat sogar einen Namen: Triskaidekaphobie. Haben Sie eine Ahnung, warum bei ihm der Aberglaube so tief saß?
Mein Vater hat gesagt, das sei kein Aberglaube, sondern Glaube. Schließlich ist er am Freitag, den 13. geboren und am Freitag, den 13. gestorben.
Dass er an einem Freitag, den 13. sterben würde, konnte er ja nicht wissen, oder?
Na, da bin ich mir nicht so sicher. Gut, in Europa war es schon Samstag, der 14., aber in Los Angeles, wo er gestorben ist, noch Freitag, der 13. Und wenn man daran glaubt, kann einen das beeinflussen. Ich aber habe damit nichts am Hut.
Sie sind die Tochter Arnold Schönbergs, dem Erfinder der Zwölftonmusik und einem der wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Und Sie sind die Witwe des Venezianers Luigi Nono, einem der wichtigsten Komponisten moderner Musik der Nachkriegszeit. Über Sie selbst ist wenig bekannt. Stört Sie das, vor allem über zwei andere Menschen definiert zu werden?
Nein, ich finde das ganz natürlich. Es interessiert mich nicht zu erfahren, ob Leute mich googeln. Wichtiger ist mir, dass ich die Nachlässe meines Vaters und meines Mannes gut und sinnvoll verwalte. Ich habe eigentlich Biologie studiert, diesen Beruf jedoch nie ausgeübt. Würde ich aber in einem Labor arbeiten, hätte ich dazu nicht halb so viel Bezug wie zu der Arbeit für meinen Mann und meinen Vater.
Würden Sie einen anderen Weg einschlagen, wenn Sie noch mal zwanzig wären?
In Interviews stellen mir besonders Frauen häufig die Frage: Hätten Sie nicht lieber ein eigenes Leben gehabt? Früher wollte ich immer erklären: Ich mache es aus Liebe und weil ich es interessant finde. Doch so zu antworten hat nie funktioniert. Jetzt mache ich ein böses Gesicht und sage: Beleidigen Sie mich etwa? Ich tue das ja professionell. Das ist kein Hobby von mir. Das, was ich tue, ist das Schönste für mich. Ich habe das Glück, dass ich mit zwei Männern wie Schönberg und Nono gelebt habe.
Ihr Mann ist 1990 gestorben. Sie haben seit 20 Jahren das Archiv Luigi Nonos aufgebaut, das jetzt hier in einem Teil eines venezianischen Klosters untergebracht ist. Wer sind Ihre Besucher?
Das Archiv steht allen offen, nicht nur Musikwissenschaftlern. Wobei sicher inzwischen 20 Dissertationen und Magisterarbeiten mithilfe der Partituren, Bücher, Skizzen und Manuskripte meines Mannes angefertigt wurden. Außerdem kommen Dirigenten und Klangregisseure, wenn irgendwo ein Werk Nonos aufgeführt wird, um sich über die Partitur hinaus in den Stoff einzuarbeiten und seine Überlegungen zu diesem Werk zu verstehen.
Woher konnten Sie das? Ein Archiv aufbauen und leiten?
Ich hatte ja große Erfahrung, weil ich im Schoenberg Institute in Los Angeles vier Jahre die große Schönberg-Biografie zusammengestellt habe. Aber hier in Venedig gibt es ein anderes Problem: das Geld. Wie man das beschafft, das habe ich nicht gelernt. Und seit Italien in der Krise ist, werden überall Gelder gestrichen. Darum schieße ich eigenes Geld dazu und bin auf Spenden angewiesen.
Wie viel kostet der Unterhalt dieses Archivs?
100 000 Euro im Jahr. Und ich glaube, viele Leute würden uns gern etwas spenden, wenn Sie wüssten, dass es uns gibt. Viele Besucher sind verblüfft, weil sie sich ein Archiv anders vorgestellt haben, mit viel Staub, nicht so licht und offen wie unseres.
Sind Sie musikalisch?
Ich liebe die Musik, ich habe ein Gefühl dafür, ich habe als Studentin viel gesungen. Aber ich spiele kein Instrument. Mein Vater hat gesagt: Wir drei Kinder waren Wunderkinder, weil wir so früh aufgegeben haben. Ich sollte Geige spielen, aber ich war untalentiert und faul.
Konnten Sie Luigi Nono auch deshalb heiraten, weil Sie als Tochter von Arnold Schönberg ihn und seine moderne Musik besser verstanden haben als fast alle anderen?
Ich glaube schon. Speziell in Italien hat man in den Fünfzigerjahren die Musik von Nono nicht verstanden – in Westdeutschland wurde er viel öfter aufgeführt. Aber ich will es nicht auf die Musik reduzieren: Wenn Sie sich die Bilder hier im Archiv anschauen, auf denen wir beide zu sehen sind, dann merken Sie schnell, dass wir uns auch sehr gefallen haben.
Umgekehrt: Wusste auch er, Sie würden ihn besser verstehen, als fast alle anderen Frauen es je könnten?
Sicher, ich war für ihn nicht nur Nuria, sondern auch Schönbergs Tochter. Und schon als Kind wusste ich: Wenn jemand komponiert, muss man ihn in Ruhe lassen. Das ist vielleicht das Wichtigste – und sehr wenige Frauen verstehen das.
Automatisch denkt man: Ob Sie auch so eine Kindheit hatten wie die Kinder Thomas Manns, dem sich alle unterordnen mussten?
Ach, überhaupt nicht! Mein Vater hat viel mit uns gespielt, hat Spiele erfunden, war ungeheuer liebenswürdig. Nur wenn er gearbeitet hat, war sein Zimmer verschlossen und man durfte keinen Lärm machen. Einmal waren wir in Los Angeles bei den Manns eingeladen, so Anfang der Vierzigerjahre, da musste ich draußen im Garten bleiben, während sich die Erwachsenen drinnen unterhielten.
Ihr Vater hatte ja auch einen kleinen Disput mit Thomas Mann.
Einen großen.
Einen großen?
Das ist wirklich eine scheußliche Geschichte, die passierte, als mein Vater schon alt und krank war. Als er 1933 von Wien in die USA emigriert ist, hat er alles zurücklassen müssen, seine Schüler, Freunde. Er fühlte sich einsam. Aber ich glaube, hätte er sich nicht so über Thomas Mann ärgern müssen, hätte er länger gelebt.
Sie spielen auf den Roman Doktor Faustus an, in dem Adrian Leverkühn die Zwölftonmusik erfindet, die in Wahrheit Ihr Vater erfunden hat?
Mann hat sich in den USA hinter seinem Rücken von Theodor Adorno die Methode der Zwölftonkomposition erklären lassen für seinen Doktor Faustus, Adorno war ja nicht nur Philosoph, sondern auch Musiktheoretiker. Leider war Leverkühn das komplette Gegenteil meines Vaters. Er hat sie für sich selbst erfunden, aber nicht, weil er wie Leverkühn etwa Syphilis hatte oder verrückt war oder das Ende der deutschen Kultur repräsentierte.
Soll ein Schriftsteller nicht die Freiheit haben, eine Figur nach seiner Fantasie auszuschmücken?
Mein Vater und Thomas Mann haben sich in den Vierzigerjahren öfter in L. A. gesehen, aber Mann hat ihm nie gesagt, dass er gerade an diesem Roman schreibt. Und seit der Briefwechsel zwischen Mann und Adorno veröffentlicht wurde, weiß man, die beiden haben es meinem Vater bewusst verschwiegen, weil sie fürchteten, er wäre dagegen, so charakterisiert zu werden. Wie alle Deutschen hatte er einen großen Respekt vor Thomas Mann. Früher hatten sie einander ihre Bücher gewidmet und dann hintergeht der eine den anderen so.
»Am Ende fast all seiner Werke steht die Hoffnung auf eine bessere Welt.«
Jetzt, fast 70 Jahre nach Erscheinen von Doktor Faustus, denken Sie, es sind Ihrem Vater Nachteile dadurch entstanden?
Oh ja. Immer noch sagen Leute zu mir: Ich weiß alles über Ihren Vater, ich habe Doktor Faustus gelesen. Genau das hat er befürchtet und es hat ihn so gekränkt.
Wissen Sie, warum Ihr Vater die Zwölftonmusik erfunden hat? Dieses System war ja gar nicht dringend notwendig, oder doch?
Mein Vater nannte es nie System, sondern Methode, und er hat nie gedacht, dass diese Methode auch für andere in Frage käme. Wie alle großen Komponisten hat er die Regeln erweitert, er hat Stücke geschrieben ohne Tonalitäten, völlig frei, dann hat er die Notwendigkeit gesehen, diese Methode zu organisieren. Aber er hat auch tonale Musik komponiert, wenn er etwas so besser ausdrücken konnte. Er wollte ein Zwölftonkomponist sein mit Betonung auf Komponist, nicht auf Zwölfton.
Wie kommt es, dass Sie 1932 in Barcelona geboren wurden, wo Ihr Vater doch zu der Zeit die Meisterklasse für Komposition an der Akademie der Künste in Berlin geleitet hat?
Die damals die wichtigste Lehreinrichtung für Komposition der Welt war. In Berlin verdiente er endlich die Anerkennung, die ihm in Wien immer fehlte. Sein Vertrag sah vor, dass er sechs Monate Unterricht geben musste und sechs Monate frei war, um zu komponieren. Da er starkes Asthma hatte, verbrachten meine Eltern die kalten Winter an der französischen Riviera oder eben in Barcelona.
Ist Nuria ein katalanischer Vorname?
Diesen Vornamen gibt es dort praktisch in jeder Familie. Und darum heiße ich auch mit Nachnamen Schoenberg mit »oe«, weil man in Spanien kein Ö kennt.
Sie sprechen perfekt Englisch, Italienisch und Deutsch. In welcher Sprache träumen Sie?
In allen dreien. Und es hängt stark davon ab, welche Sprache ich tagsüber gesprochen habe.
Sind Sie gläubig?
Nein, gar nicht.
Ihr Vater war Jude, dann Protestant, dann kehrte er wieder zum Judentum zurück. Und Ihre Mutter?
Die war katholisch. Meine beiden Brüder und ich sind in Los Angeles als Katholiken aufgewachsen, solange ich ein Kind war, habe ich an Gott geglaubt, später nicht mehr.
Sie haben Luigi Nono 1954 in Hamburg bei der konzertanten Uraufführung von Moses und Aron kennengelernt, einer unvollendeten Oper Ihres Vaters. Nono war Kommunist. War das für eine Amerikanerin wie Sie eher attraktiv oder abschreckend?
Es war komisch. Vor allem, weil er sehr viel mehr über Amerika wusste als ich. In der Unitá las er alles darüber. Ein Jahr lang hat er mir nach Amerika Briefe und Postkarten geschrieben, oft mit roter Tinte. Und Leute, die das sahen, riefen entsetzt: Oh, das ist ja ein Kommunist! Nur deswegen!
Für Sie war das kein Problem?
Nein, zum einen haben wir auf der Giudecca gewohnt, der Insel vor Venedig, auf der es zu 90 Prozent Sozialisten und Kommunisten gab. Zum anderen hatten meine Eltern im Gegensatz zu vielen Amerikanern keine hysterische Abneigung gegen den Kommunismus. Sie glaubten einfach nicht daran. Und was meinen Mann betrifft: Seine Fähigkeit menschliches Leiden intensiv zu spüren und es in seinen Werken zum Ausdruck zu bringen, spielte eine viel größere Rolle als der Umstand, dass er Kommunist war. Immerhin, am Ende fast all seiner Werke steht die Hoffnung auf eine bessere Welt.
Viele Münchner erinnern sich noch gut an Luigi Nono, weil er für die Münchner Philharmoniker ein Werk zur Eröffnung des Konzertsaals im Gasteig komponierte, das Sergiu Celibidache bei ihm in Auftrag gegeben hat. Es wurde ja speziell für diesen Raum geschrieben. Ist diese Musik überhaupt anderswo aufführbar?
Ja, aber sie muss für jeden Raum neu angepasst werden, denn jeder Raum spielt und schwingt mit. Für meinen Mann war Musik im Raum immer sehr wichtig. Als Kind ging er in Venedig in die Basilica di San Marco zur Messe, es wurde mehrstimmige venezianische Musik aus dem 16. Jahrhundert gesungen, die Musik kam von allen Seiten. Das hat ihn geprägt. Sein Prometeo zum Beispiel ist ein Werk, das in einem Raum von allen Seiten und von oben und unten klingt. Für die Uraufführung 1984 in Venedig hat der berühmte Architekt Renzo Piano eine fünf Meter hohe hölzerne Bühnenkonstruktion geschaffen, die »Arche«, die nur auf die Kirche San Lorenzo zugeschnitten war. Trotzdem wurde der Prometeo ohne die »Arche« in vielen Konzertsälen und Opernhäusern der Welt aufgeführt. Es ist also durchaus möglich.
2011 hat der Dirigent Ingo Metzmacher diesen Prometeo bei den Salzburger Festspielen mit ungeheurem Erfolg aufgeführt, die Kritiker jubelten, das Publikum auch, alle Aufführungen waren ausverkauft, obwohl das Werk verkürzt gesagt als »furchterregend komplex« beschrieben wird.
Ingo Metzmacher war zuvor zwei Wochen hier im Archiv und hat alle Manuskripte, Interviews und Unterlagen studiert, die mein Mann dazu angefertigt hat. Wissen Sie, warum es für mich eine ganz besondere Freude ist, wenn ein Werk Nonos gut aufgeführt wird?
Nein.
Wenn ein Mozart schlecht aufgeführt wird, gibt man dem Dirigenten die Schuld – denn alle kennen das Stück und wissen, wie es eigentlich klingen müsste. Wenn aber ein Nono schlecht aufgeführt wird, halten die meisten den Komponisten für schlecht.
Luigi Nono verstand auch seine Musik politisch. In den Sechzigerjahren, aber nicht nur da, schrieb er Stücke über Intoleranz und Gewalt gegenüber Flüchtlingen oder die Folgen eines Atomkrieges in Hiroshima.
Alles war nach dem Krieg in Italien politisch und das hieß meistens links. Und links war auch die Kunst. Es gab eine große Freiheit für Musiker, Regisseure, Schriftsteller.
Obwohl er Kommunist war, wurde er mehr in Westdeutschland als in der DDR gespielt. Warum?
Weil man in Westdeutschland seine Musik besser verstand. Interessanterweise war er sowohl Mitglied der Akademie der Künste in Westdeutschland als auch in der DDR. Doch das Verhältnis mit Ostberlin blieb nicht ungetrübt: Einmal nur schrieb mein Mann ein Werk im Auftrag der DDR zur Eröffnung eines Musiksaals. Dafür hat er einen Text verwendet, der nicht sehr moskaufreundlich war. Als das die Verantwortlichen merkten, wollten sie das nicht mehr aufführen, und nannten offiziell als Begründung, dass Nono in Dollar bezahlt werden wollte. Das war unverschämt. Andererseits haben wir wunderbare Freunde dort gehabt, wir waren ja oft in der DDR, Paul Dessau, der Komponist, war einer von ihnen, Heiner Müller oder die Theaterfrauen Helene Weigel und Ruth Berghaus.
Sowohl die Musik Ihres Vaters als auch die Ihres Mannes klingt bis heute ungeheuer modern, dabei sind die Kompositionen oft über hundert beziehungsweise über sechzig Jahre alt. Früher gab es vor allem Anfeindungen, heute vor allem Jubel. Macht Sie das stolz?
Manchmal, wenn ich ein besonders schönes Konzert meines Vaters oder meines Mannes höre, und die Leute sind begeistert und klatschen, würde ich gern zu beiden sagen: Ihr hattet recht, als ihr prophezeit habt, dass die Leute eure Musik eines Tages lieben werden.
(Fotos: Imagno/ÖNB, dpa)
Fotos: Julian Baumann