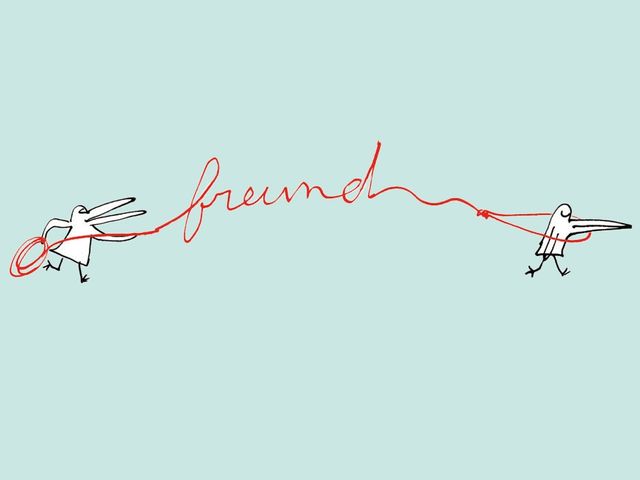Fast hätte München mal etwas wirklich Großes gewagt. Aber dann doch nur fast. Und weil der Plan so faszinierend war, so umwerfend, so ganz anders als alle anderen Bauprojekte, die wir der Städtischen Bauordnung verdanken, muss sein Scheitern hier noch einmal in Ruhe erzählt werden. Im Getöse des Kommunalwahlkampfs 2007 haben die meisten Münchner gar nicht richtig mitgekriegt, was für eine große Idee vorzeitig begraben wurde. Erinnern wir uns also noch einmal der Geschichte eines großen Wurfs, der keiner sein durfte – und reden wir darüber, warum es große Würfe in München oft so schwer haben.
Sind wir ehrlich: In dieser Stadt gibt es nicht viel schöne moderne Architektur. Ja – eine großartige Synagoge, die BMW-Welt, die Allianz Arena, ein paar verstreute »Towers« am Stadtrand. Aber das sind exotische Blüten, während die Neubaugebiete meist eher an das Abstandsgrün kommunaler Parkplätze erinnern. Doch für einen kurzen Moment sah es mal so aus, als seien sich alle einig, dass da etwas passieren müsste. Vor ein paar Jahren merkten Architekten und Stadträte, dass die Stadt neue Architektur braucht, die richtungsweisend ist, die Epoche macht. Ein Platz, auf dem so etwas funktionieren könnte, war auch schnell gefunden: am Rande Schwabings, auf dem frei gewordenen Gelände der ehemaligen Luitpoldkaserne an der Infanteriestraße.
Und weil nicht nur die Stadtverwaltung fand, es dürfe ruhig mal was vorwärtsgehen, sondern auch verschiedene Bauunternehmer, wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben. In diesem Fall von der neu gegründeten Arbeitsgemeinschaft Werkbundsiedlung München.
Noch mal kurz zur Erklärung: Der Deutsche Werkbund ist eine Vereinigung, zu der sich im Jahre 1907 bedeutende Künstler, Architekten und zwölf Firmen in München zusammenschlossen. Zielsetzung war es, die gesamte industrialisierte Lebenswelt »vom Sofakissen bis zum Städtebau« nach künstlerischen Gesichtspunkten zu »veredeln« und so die Bevölkerung kulturell zu »erziehen«. Dem Werkbund gehörten einige der berühmtesten deutschen Architekten des 20. Jahrhunderts an, darunter Walter Gropius und Ludwig Mies van der Rohe. Die vom Werkbund organisierte Weißenhofsiedlung in Stuttgart von 1927 zählt bis heute zu den bedeutendsten Beispielen moderner Architektur des 20. Jahrhunderts.
Es gab also gute Gründe, in München eine Siedlung im Sinne des legendären Werkbunds zu bauen – noch dazu, da die Vereinigung 2007 ihr 100-jähriges Jubiläum feierte.
Darum tat sich der Deutsche Werkbund Bayern e.V. mit acht verschiedenen Bauherren zusammen. Es entstand ein schöner Wettbewerbsaufruf, in dem stand: »Man hofft auf ein Ergebnis, das vergleichbar den historischen Werkbundsiedlungen (…) weit über München hinaus Impulse für die Kultur des Bauens und Wohnens gibt.«

Klingt hervorragend. Den Wettbewerb gewann schließlich der japanische Architekt Kazunari Sakamoto mit seinem Entwurf der »Punkthäuser«: Er plante hohe Würfel mit Flachdächern, Freiräumen und großen Grünflächen, mit lichten, gläsernen Türmen, die zu schweben schienen, mit hängenden Gärten, transparenten Fassaden. Kein einförmiger Block von Häusern sollte entstehen, sondern eine Siedlung mit freundlichen, mäandrierenden Linien.
Der Entwurf wurde allseits begeistert aufgenommen.
Denn solang etwas noch nichts kostet und auch noch keine Mühe macht, findet der Münchner ja alles erst mal in Ordnung. Wochenlang wurde der Entwurf in den Zeitungen der Stadt vorgestellt, diskutiert, gepriesen. Und auch außerhalb der Stadtgrenzen stieg die Stimmung. Die Frankfurter Rundschau etwa rühmte die »wunderbare Vision, skulptural gedacht, poetisch«. Die FAZ sprach von einem beachtlichen Projekt und von »Wohnungen, die zeigen sollen, wie die Stadt des 21. Jahrhunderts aussehen könnte«.
Dann aber, und das ist heute nur noch schwer nachzuzeichnen, kippte die Stimmung. Warum? »Licht, Luft, Wahrheit, Klarheit«, so hatte man beim Werkbund vor 100 Jahren beschrieben, was neue Architektur auszeichnen müsse. Schöner Slogan, aber der Münchner Stadtrat fragte erst mal: Wo, bitte, bleibt da die Bayerische Bauordnung? Also ersann man in allen möglichen Ausschüssen zahllose Bedenken, die alle berücksichtigt werden mussten. Der Architekt aus Tokio war gezwungen, die Häuser umzuplanen und immer wieder Details zu ändern.
Die Bauordnung schreibt penibel alle möglichen Details vor, an die sich Architekten und Bauherren halten müssen. Man hätte jetzt für die Werkbundsiedlung Ausnahmen machen können. Aber wenn es um Ausnahmen geht, müssen mitreden: a) die Vertreter des Stadtteils (Bezirksausschuss), b) der Planungsausschuss des Stadtrats und c) der Stadtrat selbst, der dem Projekt seinen Segen geben muss. Die gefährlichste Klippe ist von jeher der Planungsausschuss, in dem sehr viele wichtige Menschen ihre Wichtigkeit beweisen müssen und das vorgelegte Projekt messen an: der Bauordnung, der Traufhöhe, den Abstandsflächen, dem in München vorgeschriebenen »sozialen Mix« an Bewohnern, dem Umweltschutz, den Sichtachsen und vielen anderen Dingen, die an sich ja auch durchaus sinnvoll sind, zusammen aber immer wieder großartige Projekte scheitern lassen.

Und wo so viel Diskussion ist, da wird der Münchner schnell müde. Auf einmal waren irgendwie alle gegen den Entwurf: Die einen fanden ihn zu modern, die anderen zu altmodisch, die Dritten sowieso viel zu teuer und die Vierten zu bemüht. Die langjährige Stadtbaurätin Christiane Thalgott, die im April 2007 aus ihrem Amt schied, war selbst Werkbund-Mitglied – aber plötzlich sagte sie über die geplante Siedlung: »Das Beispielhafte kann nicht nur die Andersartigkeit sein.«
Für die Vertreter von Rot-Grün waren die Türme schon deshalb des Teufels, weil sie Mittel binden sollten, die man doch anderswo für den Bau von exakt 123 Sozialwohnungen benutzen könnte. Und nicht einmal die Stadtbaurätin Elisabeth Merk, als Nachfolgerin von Christiane Thalgott gerade neu im Amt, konnte noch irgendwas ausrichten – dabei war sie eigentlich sehr für das Projekt.Walter Zöller, Planungsexperte der CSU, schimpfte: »Es wäre eine Katastrophe, wenn wieder nur das Übliche, was man bei uns immer baut, entstehen würde.«
Doch da war es ganz plötzlich schon zu spät. Im Frühjahr 2007 einigte sich der Stadtrat mit rot-grün-rosa Mehrheit, das Projekt abzublasen. Die offizielle Begründung, wie sie vom planungspolitischen Sprecher der Grünen, Boris Schwartz, vorgetragen worden war, zitierte die SZ etwas später so: Auch nach mehrfacher Überarbeitung könne der finanzielle Mehraufwand nicht gerechtfertigt werden. Dafür habe der Entwurf zu viele Defizite. Innovative Ansätze in den Bereichen Ökologie und soziale Integration fehlten.
Die Wogen schlugen hoch. CSU-Mann Zöller sprach von einer »Schande für München«. Und Matthias Ottmann, einer der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft, klagte, alle Beteiligten – Stadt, Werkbund, Bauträger – hätten zu viel gefordert von der Siedlung, die aber sei nun mal »keine Eier legende Wollmilchsau«.
Die Betreiber der Informationsplattform Münchenarchitektur.de erkannten im Streit um die Siedlung besondere Hintergründe: »Offenbar wird hier in München ein Kulturkampf zwischen Modernisten und Traditionalisten aufgeführt, der an den Streit um die Weißenhofsiedlung erinnert – nur dass diesmal die Protagonisten aus dem parteipolitisch jeweils anderen Lager kommen: In München ist heute die CSU für die Moderne, Rot-Grün dagegen.«

In der Sprache der rot-grünen Herrschaft fehlte der Werkbundsiedlung die »ökologische Komponente« ebenso wie das »Konzept zum sozialen Miteinander« und ein »ausreichendes Energiespar-Potenzial«. So oder so, es läuft auf dasselbe hinaus: Das wollen wir hier nicht, das brauchen wir hier nicht.
Würde Hamburg solche Kriterien anlegen, gäbe es keine HafenCity und keine futuristische Bebauung des Elbufers. Für München ist das Scheitern der Siedlung geradezu typisch: Es wird hier zwar viel gebaut, denn die Stadt wächst, aber selbst der Oberbürgermeister beklagt gelegentlich, wie eintönig die neuen Siedlungen oft sind. Die Neubaugebiete, die es in der wachsenden Stadt glücklicherweise auch gibt, sehen schlimm aus. Und die wenigen Hochhäuser, die gebaut wurden, fristen in München ein Randdasein – und sind durch den berüchtigten Bürgerentscheid auf 100 Meter Höhe begrenzt worden, gekappt wie 1789 die Orchideen im Englischen Garten von wütenden Münchner Bürgern, denen die damals vom Kurfürsten Karl Theodor frisch gepflanzten exotischen Blüten und Parks zu neumodisch waren.
Schade. Einfach schade. Mit der gekippten Werkbundsiedlung haben die Münchner nicht nur eine Chance verpasst, Architekturgeschichte zu schreiben. Sie können jetzt auch nicht den Heerscharen von Fremden, die die neue Attraktion besucht hätten, erklären: Wir haben halt schon immer gewusst, wie man eine schöne Stadt baut. Jetzt bleibt ihnen nur noch der Trost der Beharrlichkeit: Lass es die anderen ruhig besser machen – solange wir es nur besser wissen.
Illustration: Dirk Schmidt