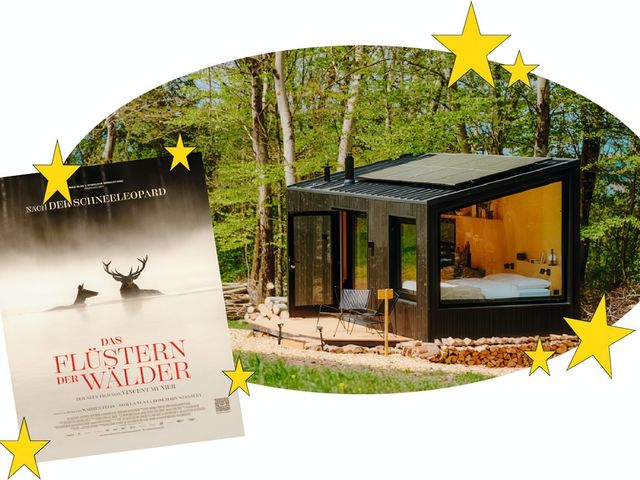Für seine Fans spielt er rund hundert Konzerte pro Jahr, für die Presse ist Bob Dylan allerdings nur selten zu sprechen. Am 24. April erscheint sein neues Album Together Through Life (Sony Music), aus diesem Anlaß gab er ein einziges Interview; geführt hat es der US-Journalist und Buchautor Bill Flanagan. Die ersten beiden Teile des Gesprächs sind seit einiger Zeit auf Dylans Homepage zu lesen, hier folgt nun – exklusiv für Deutschland – der dritte Teil des Interviews.
Bill Flanagan: Dachten Sie bei dem Song »Chicago After Dark« an den neuen Präsidenten?
Bob Dylan: Nicht wirklich. Es geht da eher um die State Street und den Wind, der vom Lake Michigan herüberweht, und darum, wie wir für manche Leute, die wir kennen, irgendwann nicht mehr das sind, was wir mal für sie waren. Ich habe versucht, einem Gefühl aus alten Zeiten nachzugehen.
Sie mochten Barack Obama recht früh. Warum?
Ich habe sein Buch gelesen, und es hat mich angesprochen.
Audacity of Hope (deutscher Titel: »Hoffnung wagen«)?
Nein, es heißt Dreams from My Father (deutscher Titel: »Ein amerikanischer Traum«).
Was hat Sie an ihm beeindruckt?
Nun, eine ganze Reihe von Dingen. Er hat eine interessante Familiengeschichte. Er ist wie eine Romanfigur, nur real. Seine Mutter kommt aus Kansas. Hat nie in Kansas gelebt, aber tiefe Wurzeln dort. Wie Kansas bloody Kansas, wissen Sie. John Brown der Anti-Sklaverei-Guerilla. Jesse James und Quantrill. Südstaatenguerilla, Partisanen. Wizard of Oz Kansas. Ich glaube, Baracks hat Jefferson Davis irgendwo in seinem Stammbaum. Und dann sein Vater. Ein afrikanischer Intellektueller. Bantu-, Massai-, Griot-Erbe – Viehdiebe, Löwenjäger. Ich meine, es ist einfach so widersinnig, dass diese beiden Menschen einander begegnen und sich verlieben sollten. Aber letztlich versteht man es doch. Und dann fesselt einen seine Geschichte umso mehr. Wie eine Odyssee, nur umgekehrt.
Inwiefern?
Zunächst einmal wurde Barack in Hawaii geboren. Die meisten von uns stellen sich Hawaii wie ein Paradies vor – man könnte also sagen, dass er im Paradies geboren wurde.
Und dann hat man ihn aus dem Garten rausgeworfen.
Nicht ganz. Seine Mutter hat einen anderen Mann namens Lolo geheiratet und ist mit Barack nach Indonesien gezogen. Barack besuchte sowohl eine muslimische als auch eine katholische Schule. Seine Mutter stand damals um vier Uhr morgens auf, um ihn selbst zu unterrichten, drei Stunden bevor er in die Schule ging. Und dann ging sie zur Arbeit. Da erkennt man, was für eine Art Frau sie war. Und das ist erst der Anfang der Geschichte.
Was hat Sie noch an ihm gefesselt?
Nun, vor allem seine Sicht der Dinge. Sein Schreibstil berührt einen auf mehreren Ebenen. Man beginnt, zugleich zu denken und zu fühlen – das schafft nicht jeder. Er sagt hochgradig ungewöhnliche Dinge. Er betrachtet zusammen mit ein paar anderen Leuten einen Schrumpfkopf in einer Vitrine im Museum und fragt sich, ob einer von ihnen merkt, dass sie womöglich gerade einen ihrer Vorfahren anschauen.
»Sogar wenn ich Städte bereise, fühle ich mich an den leeren Plätzen am meisten zu Hause«
Was in seinem Buch würde Sie vermuten lassen, dass er ein guter Politiker ist?
Eigentlich nichts. In gewisser Weise könnte man meinen, dass das Politikgeschäft das Letzte ist, was diesen Mann interessieren dürfte. Ich glaube, er hatte eine Sekunde lang einen Job als Investmentbanker an der Wall Street und hat deutsche Wertpapiere verkauft. Aber wahrscheinlich hätte er alles Mögliche werden können. Wenn Sie sein Buch lesen, werden Sie sehen, dass die Welt der Politik zu ihm gekommen ist. Sie stand ihm offen.
Glauben Sie, dass er ein guter Präsident wird?
Ich habe keine Ahnung. Er wird der beste Präsident werden, der er sein kann. Die meisten treten das Amt mit besten Absichten an und verlassen es als geschlagene Männer. Johnson ist ein gutes Beispiel dafür... Nixon, Clinton, auf eine Art, Truman, all die anderen weiter in der Vergangenheit. Es ist, als ob sie alle zu nah an der Sonne fliegen und sich verbrennen.
Haben Sie je Autobiografien anderer Präsidenten gelesen?
Ja, die von Grant habe ich gelesen.
Wie war er? Gibt es Ähnlichkeiten?
Es waren natürlich andere Zeiten. Und Grant hat sein Buch geschrieben, als er nicht mehr Präsident war.
Was fanden Sie interessant an ihm?
Er ist kein begnadeter Schreiber. Er ist analytisch und kalt, aber er hat Humor. Abgesehen davon, dass er ein Militärstratege war, war Grant ein Arbeiter. Er hat mit Pferden gearbeitet, sie versorgt, er hat gepflügt und gefurcht. Die ganze Ernte eingebracht – Mais und Kartoffeln. Er hat Holz gesägt und Wagen gelenkt, seit er ungefähr elf war. Er hatte ein ungemein präzises Gedächtnis für alle Schlachten, an denen er teilgenommen hat.
Erinnern Sie sich an eine bestimmte Schlacht, in der Grant kämpfte?
Da gab es einige, aber die interessanteste ist die von Shiloh. Er hätte sie verlieren können. Aber er war fest entschlossen, um jeden Preis zu siegen. Er hat alle möglichen Strategien angewandt, sogar einen Rückzug vorgetäuscht. Sie können es selbst nachlesen.
Wenn man an den Bürgerkrieg denkt, vergisst man gerne, dass keine Schlachten im Norden stattfanden, außer jener von Gettysburg.
Ja. Deshalb unterscheidet sich der Süden des Landes wohl auch so sehr vom Norden.
Da gibt es ein gewisses Grundgefühl, aber ich bin mir nicht sicher, wie das ganze zusammenhängt.
Es muss die Luft im Süden sein. Sie ist voll von herumschweifenden Geistern und ruhelosen Seelen. Sie schreien alle, sind verloren. Es ist, als ob sie in einem unheimlichen Netz gefangen wären – einem Fegefeuer, zwischen Himmel und Hölle, und sie finden keine Ruhe. Sie können weder leben noch sterben. Als ob es sie im besten Alter erwischt hätte und sie jetzt etwas mitteilen wollten. Sie sind überall. Überall sind Schlachtfelder... oft sogar in den Hinterhöfen der Menschen.
Konnten Sie sie spüren?
Oh, ja. Sie würden staunen. Ich war in Elvis’ Geburtsort – Tupelo. Und ich habe versucht zu fühlen, was Elvis gefühlt haben könnte, als er dort aufwuchs.
Haben Sie auch all die Musik gespürt, die Elvis gehört haben muss?
Nein, aber ich kann Ihnen sagen, was ich gespürt habe. Ich habe die Geister der blutigen Schlacht gespürt, in der Sherman gegen Forrest kämpfte und ihn besiegte. Die Stadt hat etwas Unheimliches. Eine Traurigkeit, die geblieben ist. Elvis muss sie auch gespürt haben.
Sind Sie ein mystisch veranlagter Mensch?
Absolut.
Können Sie sich erklären, warum?
Ich glaube, es ist das Land. Die Flüsse, Wälder, die große Leere. Das Land hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ich bin wild und einsam. Sogar wenn ich Städte bereise, fühle ich mich an den leeren Plätzen am meisten zu Hause. Aber ich liebe die Menschheit, ich liebe Wahrheit und Gerechtigkeit. Ich glaube, ich bin ein gespaltener Charakter. Ich bin eher ein Abenteurer als ein Beziehungstyp.
Aber in Ihrem Album geht es um Liebe – wie sie gefunden und verloren, erinnert und verweigert wird.
Anregungen sind schwer zu bekommen. Man muss sie mitnehmen, wo man sie findet.
Übersetzung: Loel Zwecker