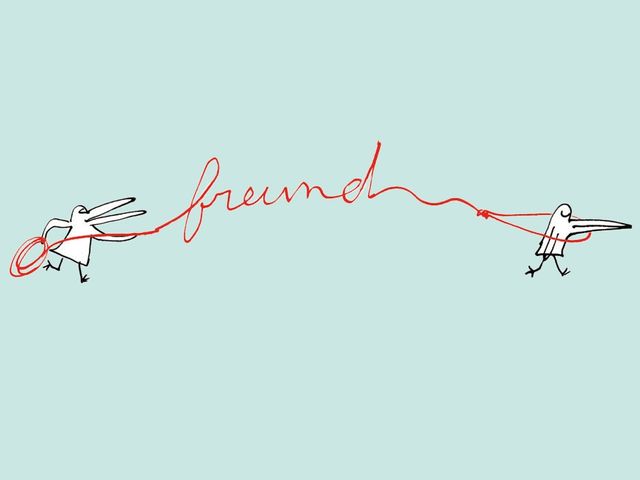Es ist ja gar nicht einfach, diese Sache mit dem Protest. Denkt man sich so leicht: irgendwo dagegen sein und das dann kundtun. Die größten Demos unseres Landes waren 1983 jene gegen den Nato-Doppelbeschluss und gegen den Irak-Krieg 2003. Klar, für Frieden ist jeder. Aber je mehr Einzelinteressen die Menschen haben, desto komplizierter wird die Protestlage.
Der Brexit-Befürworter Nigel Farage bekam vergangenen Mai in Newcastle einen Banane-Salzkaramell-Milchshake ab. Der Werfer sagte später zur Begründung, Farage sei ein Demagoge. Farage ließ vor Gericht verlesen, er habe sich durch den Wurf »zutiefst beschämt« gefühlt. Man muss ihn nicht mögen, um ihm das auf dem Video, das es von dem Vorfall gibt, auch anzusehen. Der Werfer wurde wegen »krass dämlichen Handelns« verurteilt. Okay – Gewalt, immer eine blöde Idee. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit gilt, das ist einfach.
Aber welche Widerstandsformen sind denn erlaubt? Und was ist mit Protestformen, die erlaubt, aber ungeliebt sind? Zuletzt fragte ein Radiosender seine Hörer, ob sie den Klimaprotesten ihre Zustimmung entziehen würden, sobald die Protestierenden anfangen, Verkehrsknotenpunkte lahmzulegen. So nach dem Motto: Kaufen Sie noch im Bioladen, wenn Sie da mit dem Heli nirgends landen können? Darf man mit einer Demo stören? Ja, klar. Wieder einfach. Den Extinction-Rebellion-Demonstranten wurde zuletzt sogar vorgeworfen, sie störten zu wenig, besprächen die notwendigen Sperrungen mit der Polizei und ließen sich auch noch gut gelaunt von eben dieser wegtragen. Protest kann also auch zu brav sein.
Was ist mit Protestformen, die geliebt sind, geschätzt, aber verboten? Etwa Nazi-Symbole im öffentlichen Raum zu übermalen, mit Herzchen. Eine 73-jährige Frau aus Eisenach wurde genau dafür kürzlich zu einer Geldstrafe verurteilt.
Spätestens hier aber begibt man sich in unklare Abstufungen der gesellschaftlichen Zustimmung. Darf man seinen Schulunterricht vernachlässigen, um auf den Untergang der Erde aufmerksam zu machen? Erst waren die Deutschen der Meinung, das gehe zu weit, inzwischen schwänzen Eltern selbst die Arbeit, um mitzugehen.
Nun weiter, in die private Sphäre hinein: Darf man SUV-Besitzer in Innenstädten per höflichem Zettel darauf hinweisen, ihr Auto sei zu groß? Natürlich. Man kann sich eine beliebige städtische Bewegungsschneise anschauen, um zu bemerken, dass das zutrifft. Mehr als die Hälfte des Raums nehmen Autos ein, fahrend, stehend. Dass das ungerecht ist gegenüber Menschen auf Fahrrädern, zwei Beinen, mit Kinderwagen oder Rollstühlen, ist offensichtlich.
Für einen Teil der Bevölkerung scheint diese Art des Protests aber entschieden zu weit zu gehen. Gegen Fridays for Future gründete sich die Gruppierung »Fridays for Hubraum«. Der bayerische Ministerpräsident Söder forderte gerade, der »Hass gegen das Auto« müsse aufhören. Wieso ist hier Kritik gleich Hass? Ist es der Gegenstand, das Auto? Oder ist es das neue Selbstbewusstsein, das Söder provoziert?
Greta Thunberg verstimmte mit ihrem Auftritt vor den Vereinten Nationen selbst ihr zugewandte Regierungsschefs wie Angela Merkel und Emmanuel Macron. Warum? Sie diskutierte nicht mehr über die Prämisse. Sie kam nicht mit Plakat und Zahlenreferat, suchte kein Gespräch oder erklärte ihre Perspektive. Das hatte sie ja bereits versucht. Sie warb nicht mehr, sondern sie klagte an mit der ganzen Kraft ihrer Hilflosigkeit. Das war mächtiger als jeder Milchshake.