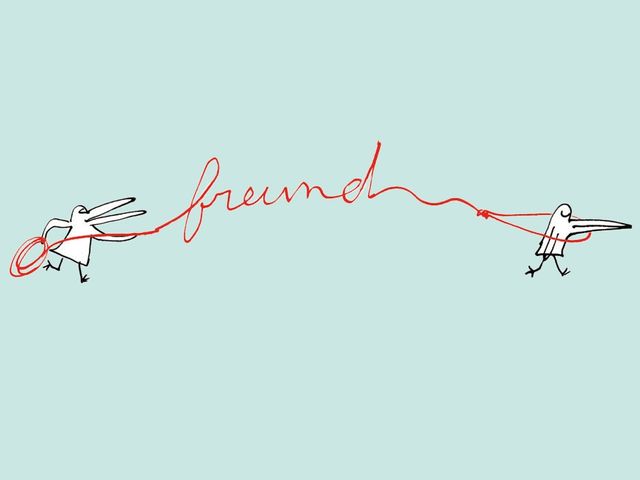So was kann sich halt kein Mensch ausdenken. Sagen wir, ein japanischer Musiker kommt nach Deutschland, kriegt hier eine eigene Fernsehsendung, wird zum Superstar, und schließlich beauftragt ihn das Bundespräsidialamt, ein offizielles Deutschland-Lied zu komponieren, auf dass es fortan bei öffentlichen Feiern gespielt werde. Ein Coen-Film? Nein, das Leben von Marty Friedman.
Friedman ist Amerikaner, geboren in Washington, er hat jahrelang in berühmten Heavy-Metal-Bands gespielt, etwa bei Megadeth, absolut erste Liga. Laut, schnell, irrwitzige Gitarrenläufe, lange Haare, Leder, das ganze Programm. Mit seinen Bands unternahm Friedman endlose Tourneen durch die ganze Welt, auch Japan. Und vor 18 Jahren blieb er da. Nicht wegen der Liebe oder des Geldes, sondern wegen der Musik.
Friedman, heute Ende fünfzig, ein schmaler, freundlicher Mann mit immer noch viel Metal-Wolle auf dem Kopf, sitzt zu Hause in Tokio vor einem roten Vorhang und erzählt per Video: »Irgendwann kam der Punkt, da habe ich mir die Top Ten in den USA angeschaut und dachte, puh, da gefällt mir gerade mal ein Song. Dann habe ich die Top Ten in Japan durchgehört, und mir gefiel so gut wie alles. Da wusste ich, ich muss umziehen.«
Es hätte jetzt eine Laufbahn als Promi-Sonderling in Japan beginnen können. Solche außergewöhnlichen Karrieren gibt es ja auf der ganzen Welt, die Kelly Family in Deutschland, der deutsche Komiker Henning Wehn in England, Italiener in Schweden, Amerikaner in Frankreich. Bei Friedman war es anders: ein anerkannter Virtuose, bejubelt von Kennern in aller Welt für seine Gitarrentechnik – der noch dazu höchst kundig über Bezüge und Unterschiede zwischen westlicher und östlicher Musik sprechen konnte. Er lernte fließend Japanisch (»Über Musik kann ich heute auf Japanisch fast besser reden als auf Englisch«), man lud ihn in Fernsehsendungen ein, als Sachverständigen, und er kam so gut an, dass sie ihm eine eigene Sendung gaben: Rock Fujiyama.
Vor allem begegnet Friedman der japanischen Kultur mit so viel Respekt, dass das Publikum ihn nie als oberflächlichen Möchtegern empfindet. »Dieses Land hat einfach eine sehr viel ältere Kulturgeschichte als die USA«, sagt er. »Sie findet sich überall, in der Sprache, im Alltag. Traditionelle Kleidung spielt eine große Rolle, traditionelle Musikinstrumente genauso.« Zum Vergleich: Wer die deutschen Charts hört oder Deutschland sucht den Superstar sieht, wird komplett mit Kopien angloamerikanischer Popmusik konfrontiert. In Japan: das Gegenteil. Eine der berühmtesten Bands dort heißt Wagakki Band, wörtlich: Japanische-Instrumente-Band. »Die sind unglaublich«, sagt Friedman. »Die benutzen so etwas wie die altehrwürdige Shakuhachi-Flöte, spielen damit aber verrückte, wilde Rockmusik. Im Westen gibt es nichts Vergleichbares.«
Und weil Friedman der eine seltene Fall ist – ein Westmusiker, der den Osten versteht –, klopfte eines Tages tatsächlich eine Regierungsbehörde an und beauftragte ihn, den Japan Heritage Official Theme Song zu komponieren. Ein Lied, eher eine ganze Suite, die bei allen Anlässen erklingen soll, bei denen es um japanische Geschichte und Kulturerbe geht, Schulveranstaltungen, Gedenktage, das ganz große Parkett. Warum ausgerechnet Marty Friedman, der Mann ohne japanisches Blut im Leib? Da ist er sich selbst nicht ganz sicher. »Sie wollten eine Perspektive von außen, soweit ich das verstanden habe. Aber ich hatte eine Heidenangst, dass die meinen Vorschlag hören und sagen, na ja, dann rufen wir mal Ryūichi Sakamoto an.« Japans berühmtester Filmkomponist wäre eine sichere Bank gewesen – aber eben auch die erwartbare Besetzung.
Aber wie komponiert man denn als Musiker aus dem fernen Westen ein Lied, das mitten ins japanische Herz trifft? Geht doch schon damit los, dass die Musik so völlig anders funktioniert. Im Westen würde man ein paar Akkorde zusammenwerfen und mal schauen, was sich darüber singen lässt. »Aber in der japanischen Musik gibt es fast keine Harmonien, wie wir sie kennen. Also Akkorde, Akkordfolgen. Die Melodien werden entweder unisono gespielt oder im Kontrapunkt, als Melodie mit Gegenmelodie.« Friedman kann wunderbar erklären, wie das so ist mit den Unterschieden, man könnte ihm stundenlang zuhören, wenn er vor seinem roten Vorhang am anderen Ende der Welt über musikalische Traditionen und ihre Bedeutung spricht. »Das Fehlen der Harmonien ist faszinierend, denn andererseits ist das soziale Konzept der Harmonie in Japan unglaublich wichtig. Es gibt im Japanischen ein Wort, das bedeutet Harmonie – und zugleich Japanisch. Das ganze Prinzip dieses Landes besteht darin, die Dinge harmonisch zu halten, konfliktfrei.« In der Musik führt das offenbar so weit, dass die Melodie nach Möglichkeit für sich allein stehen soll. Weniger Reibung, weniger Disharmonie, weniger Konfliktgefahr.
Friedmans Heritage Song hört sich denn auch sehr friedlich an, fast völkerverbindend. Erst eine Art asiatisches Jodeln, dann westliche Geigen, dann behutsam japanisches Schlagwerk, gefolgt von einer sehr amerikanischen E-Gitarre, dann setzt das Tokyo Philharmonic Orchestra ein, dann Schlagzeug, Rock, großes Pathos. Erinnert sehr an Queen (immerhin eine Band, die ihren Fans zuliebe auch schon auf Japanisch gesungen hat). Passend pathetisch könnte man sagen, die Musik baut Brücken. Zwischen West und Ost, zwischen einst und jetzt. Klingt kitschig, die Musik durchaus auch. Aber: Das Lied wird regelmäßig gespielt und lässt bei geschichtsträchtigen Veranstaltungen von Kyōto bis Yokohama japanische Herzen höher schlagen. Gute Arbeit.