Sind intelligente Uhren Handfesseln der Überwachungsgesellschaft - oder helfen sie einfach beim Check-in und beim Zahlen im Supermarkt?
Kann schon sein, dass wir manchmal auch auf die Armbanduhr gucken, weil wir wissen wollen, wie spät es ist. Aber die Uhrzeit steht ja schon am oberen Rand des Displays von Smartphone oder Computer, man hat sie ohnehin den ganzen Tag im Blick. Eine Armbanduhr zeigt viel mehr an als nur die Zeit. Aber das gilt nicht für jede Uhr.
Die Apple Watch, die in wenigen Tagen auf den deutschen Markt kommt, betrachten viele Leute skeptisch, wie ein blutsaugendes Insekt, das man sich schnell vom Körper wischen muss. Elternbeiräte, Kulturpessimisten und andere Das-haben-wir-noch-nie-so-gemacht-Fraktionen bilden eine breite Front. Man muss nicht einmal so genau wissen, was eine Smartwatch ist, um dagegen zu sein.
Also: Die Apple Watch zeigt die Zeit an. Außerdem tippt sie ihrem Besitzer sanft gegen das Handgelenk, wenn dieser eine neue Nachricht erhält, sie zählt die Schritte, die man täglich zurücklegt, fühlt den Puls und misst die Qualität des Schlafs. Sie ist das bekannteste und meistgefürchtete Produkt in der Klasse der »Wearables«. Das sind Minicomputer, die man direkt am Körper mit sich herumträgt, am Arm, im Ohr oder auf der Nase. Auch die Brille namens Google Glass zählt dazu. Das Münchner Start-up Bragi entwickelt derzeit einen Mini-Kopfhörer, den man sich ins Ohr stecken kann und der unter anderem die Sauerstoffsättigung des Blutes misst.
Die Technik rückt dem Menschen also auf den Leib. Und der Mensch schlägt zu seinem Schutz um sich. Marktanalysten stellen infrage, ob Wearables jemals ein Erfolg sein können – niemand brauche die Dinger. Stil-Feuilletonisten ereifern sich über das Äußere der intelligenten Uhren und Brillen, die bestimmt nur von ein paar aufgeschwemmten Silicon-Valley-Nerds getragen würden. Pfarrer warnen mal wieder vor kalter Technik und Entfremdung. Und die Schriftstellerin Juli Zeh glaubt, dass die Apple Watch die totale Überwachung ermöglichen wird: »Big brother is watching you.«
Die Kritik an den Wearables folgt damit exakt dem Muster, das die Schriftstellerin Kathrin Passig in ihrem großartigen Bändchen Standardsituationen der Technologiekritik beschreibt: Zunächst wird grundsätzlich bestritten, dass eine technische Neuerung – egal ob Muskete oder Mikroprozessor – gebraucht werde. »Who the hell wants to hear actors talk?«, fragte 1927 der Filmstudiochef Harry M. Warner. Hat die Innovation doch gewisse Erfolge, werden die Early Adopter denunziert, die frühen Nutzer: Das neue Gadget sei doch bloß etwas für die zweifelhafte (männliche, weiße, junge) Minderheit. Und irgendwann macht man sich dann Sorgen, was die neue Technik in den Köpfen und in den Körpern der Mitmenschen anrichtet. Hier lautet ein beliebtes Argument: »Schwächere als ich können damit nicht umgehen.« Alles, was man schon immer am Computer und dem Internet auszusetzen hatte, kann man nun speziell an den neuen smarten Geräten bemängeln.

Die Uhr kann vielleicht bald das Auto aufschließen. Und navigieren sowieso.
In Wahrheit haben Wearables wie die Apple Watch und mechanische Uhren viel gemeinsam – und das liegt nicht nur daran, dass beide Technologien in ganz unterschiedlichen Gesellschaftskreisen als kostbare Statussymbole gelten. Beide trägt man nah am Körper; beide haben ein kunstvolles Innenleben; beide strukturieren das Leben des Menschen. In den Siebzigerjahren nahmen Computer noch einen ganzen Keller oder eine Garage in Beschlag, in den Achtzigern standen sie auf dem Schreibtisch, in den Neunzigern nahmen wir sie als Laptop auf den Schoß, und im vorigen Jahrzehnt steckten wir sie in die Hosentasche. Vor dem nächsten Annäherungsschritt sollten wir schon deswegen keine Angst haben, weil die Uhr uns auf ganz ähnliche Weise immer näher kam.
Über Tausende von Jahren nutzten die Menschen als Zeitkünder einen etwa 150 Millionen Kilometer entfernten Himmelskörper: Die Sonne bestimmte, wann man aufstand und wann man den Dreschflegel sinken und sich einen Krug Bier reichen ließ. Im 13. Jahrhundert erschien dann eine zweite leuchtende Scheibe am Himmel: die Kirchturmuhr. Die erste soll 1283 in Bedfordshire, England, getickt haben. Nur wenige Jahrzehnte später fanden sich fast überall in Europa öffentliche Uhren. Die ausdifferenzierte, arbeitsteilige Gesellschaft benötigte eine abstrakte Form der Zeitrechnung, auf die sich alle beziehen und verlassen können; Reisen mussten geplant, Geschäftstermine koordiniert und Produktionszyklen synchronisiert werden.
Allerdings erwies es sich als unpraktisch, auf das nächste Glockengeläut zu warten, um zu wissen, dass es jetzt drei Uhr ist. Die tragbare Uhr etablierte sich im 19. Jahrhundert. Auch sie ist ein Mini-Computer, das erste Wearable der Geschichte. Nicht die Dampfmaschine, sondern die Uhr ist laut dem New Yorker Philosophen Lewis Mumford die entscheidende Erfindung der industriellen Moderne.
Die Uhr hat den Menschen nicht nur diszipliniert, sondern auch befreit. Schon 1840 engagierte sich der Zimmermann Samuel Parnell in Petone, Neuseeland, mit einem Einmannstreik erfolgreich für den Achtstundentag. Aus heutiger Sicht ist die Uhr, alles in allem, eher Segen als Fluch.
Es gibt Apps wie Word Lens, mit denen man – unter Mithilfe der Smartphone-Kamera – fremde Schriftzeichen scannen und übersetzen lassen kann. Google Translate beherrscht bereits die Audioübersetzung. Bald genügt es, einen Kopfhörer ins Ohr zu stecken und mit dem Mini-Computer zu verbinden, den man am Handgelenk oder in der Hosentasche trägt – schon haben wir einen Simultanübersetzer und können uns mit dem Garküchenmann in Thailand und dem Touristen aus Russland unterhalten. Was war das eigentlich für ein globales Dorf, in dem man den Nachbarn kaum verstand? Längst verwendet man kaum mehr einen Faltplan, sondern lässt sich von der Navi-Stimme durch die Stadt führen. Fitness-Wearables erkennen, ob man beim Joggen übertreibt, und spielen dann automatisch beruhigende Musik. Gut möglich, dass ein Computer bald über Sensoren einen Nährstoffmangel feststellt und die entsprechenden Produkte auf dem Einkaufszettel notiert: Bananen und Zink!

Wenn wir die Augen schließen, geht die Selbstüberwachung erst so richtig los.
Manche dieser bestehenden oder möglichen Anwendungen erfüllen einen alten Menschheitstraum (alle Sprachen sprechen). Andere wirken ein wenig übergriffig. Nicht jede Anwendung ist eine völlig neue Erfindung. Das wirklich Neue ist, wie wir die Geräte und ihre Möglichkeiten nutzen. Eine smarte Brille kann man absetzen, eine smarte Uhr abschnallen, aber wenn wir diese Geräte tragen, erweitern sie so elegant und diskret unsere Sinne, dass uns nicht mehr auffällt, dass wir ja eigentlich gar kein Chinesisch können. Wir werden die neuen Applikationen ganz selbstverständlich und bruchlos nutzen, wir werden kaum mehr das Gewicht an unserem Handgelenk spüren, wir verschmelzen mit der Technik. »Ich will für vier Wochen in die Karibik«, flüstert man in Richtung Handgelenk, und die Uhr schaltet den Thermostat ab, unterbricht das Zeitungsabo, bucht die Tickets. Immer zu wissen, wo man ist und was um einen herum vor sich geht, die Welt mit einem Kurzbefehl oder einem Fingerwischen zu kontrollieren – das sind Superkräfte, die zu vergleichen sind mit den bionischen Implantaten und Mutationen der Helden aus den Science-Fiction-Filmen, das kann wunderbar und aufregend sein.
»Und gefährlich!«, ruft die große Koalition der Kulturkritik. »Es ist schwer genug, den Laptop in Schach zu halten, was soll erst werden, wenn man diese Geräte am Handgelenk und im Ohr trägt? Dann können wir gar keine wahren Gespräche und wahren Freundschaften mehr pflegen. Und wer auch noch seine Fitnessdaten kennt, wird erst recht zu einem seelenlosen Narzissten!«
Wer sich einer Entwicklung verweigert, kann sie nicht gestalten.

In Zeiten von Übersetzungssoftware kommt einem nichts mehr chinesisch vor.
Es stimmt ja: Junge Deutsche zwischen 14 und 29 Jahren nutzen laut einer Emnid-Umfrage den Computer – außerhalb von Schule und Arbeit – durchschnittlich 146 Minuten am Tag. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es 136 Minuten. Der Personal Computer hat sein Attribut also wirklich verdient. Je nach Umfrage aktiviert der durchschnittliche Deutsche zwischen 84- und 150-mal am Tag sein Handy. Klingt nach sehr viel. Allerdings hatten die Menschen früher andere Objekte auch 150-mal pro Tag in der Hand: den Taschenrechner zum Beispiel oder einen Hammer oder eine Sichel. Längst ist wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen mit vielen Facebook-Freunden auch im sogenannten wahren Leben überdurchschnittlich viele Freunde haben.
Und es kann wirklich nicht schaden, ein bisschen mehr über den eigenen Körper und die eigenen Bewegungsroutinen zu erfahren. Schaut man sich ein bisschen um, in deutschen Kantinen und Fußgängerzonen, bekommt man ja nicht gerade den Eindruck, dass die Leute exzessiv Sport treiben oder sich viel zu gesund ernähren. Eine Smartwatch misst und kontrolliert unser Schlafverhalten. Sie zeigt auch an, wenn man unruhig schläft oder sich zu sehr im Bett herumwälzt. Diese Daten kann man dann analysieren. Vielleicht braucht man eine weichere Matratze. Oder man findet heraus, dass man zu Unrecht darüber jammert, mal wieder »kein Auge zugemacht« zu haben. Denn die App zeigt: Man hat perfekt geschlafen, alles ist gut, vermutlich nur ein Mittagstief.
Die Smartwatch wird auch zu einer neuen Ära der Höflichkeit führen. Man muss nicht mehr die ganze Zeit auf den Computer oder das Smartphone starren, wenn man auf eine wichtige Mail wartet. Ein kurzes Summen im Ohr oder ein leichtes Vibrieren am Handgelenk signalisiert, dass diese Nachricht eingetroffen ist. Und wir können uns voll und ganz unserem Gesprächspartner widmen. Ist es nicht großartig, wenn wir nicht ständig nach Kleingeld kramen müssen, sondern bequem bezahlen, indem wir unsere Uhr über einen Scanner führen? Wenn wir nicht mehr tausend verschiedene Karten für Fitnessstudio, Kantine, Krankenkasse und Bahnrabatt brauchen, sondern all diese Information auf einem einzigen Träger gespeichert sind?
Wer sich einer Entwicklung verweigert, kann sie nicht gestalten. Besser als die Schnappatmung ist daher das ruhige Abwägen von Chancen und Risiken. Klar, wir wissen von den Zetta-Speichern der NSA in der Wüste und ärgern uns über das tägliche AGB-Versteckspielen mit Facebook. Wir müssen davon ausgehen, dass jede Mail gehackt und jeder Anruf gescannt werden kann, dass Hacker vielleicht bald den intelligenten Kühlschrank infiltrieren und die Dinnerparty sabotieren. Es ist durchaus möglich, dass uns die Versicherung bald schon bitten wird, unsere Fitnessdaten zu übermitteln, und vielleicht schickt uns dann eine App abends um halb zehn ins Bett. Wer brav ist, bekommt eine Beitragssenkung. Das Motto der Weltausstellung 1933 in Chicago lautete »Science Finds, Industry Applies, Man Conforms«. Dass sich der Mensch gefälligst anpassen solle, sieht man im Silicon Valley heute noch so. Der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt schlug vor, dass die Menschen ihren Namen ändern sollten, wenn sie Probleme mit ihren im Internet gespeicherten Jugendsünden hätten. »Technologischen Defätismus« nennt der weißrussische Digital-Philosoph Evgeny Morozov diese Haltung, die besagt, dass man nicht die Technik an die Werte anpassen soll, sondern die Werte an die Technik.
Technologischer Analphabetismus und technologische Apathie seien aber auch nicht viel besser. Morozov glaubt, dass eine Kombination aus gesellschaftlichem Engagement und politischer Kontrolle am sinnvollsten ist, um den digitalen Gefahren zu begegnen, und fordert neue Etiketten, Normen und Gesetze. Er zieht den Vergleich zum frühen 20. Jahrhundert, als in Industriestaaten plötzlich Lärm ein Problem wurde und sich Organisationen wie die Anti-Noise League oder der Deutsche Lärmschutzverband bildeten. Der Wiener Intellektuelle Theodor Lessing wollte das Musizieren bei geöffnetem Fenster verbieten lassen und schlug die Einrichtung zentraler Teppichklopf-Plätze vor. Aber es gab auch produktive Ideen. Die Industrie erfand Schalldämpfer für Autos, die Politik richtete Lärmschutzzonen um Schulen ein und machte Ruhe zu einem zentralen Lebenswert im Chaos der Moderne.
Solche kleinen, langweiligen Schritte setzen Kompetenz, Wissen und Zähigkeit voraus: Was leistet ein doppelverglastes Fenster? Was kann das Bürgermeisteramt verbieten, und was ist Bundessache? Es wäre eine gute Idee, genau diese Kompetenz nun in Bezug auf den digitalen Wandel zu entwickeln. Wenn die Technisierung als eines der größten Probleme unserer Zeit gilt, warum können dann etwa 99 Prozent der WLAN-Besitzer nicht einmal eine Webseite programmieren oder wissen nicht, was IMEI-Nummer, Algorithmus und Cloud Services sind? Ein wenig wundert man sich schon über diese modernen großstädtischen Menschen, die stricken, Bier brauen oder Wochenendseminare zur Kunst des Holzhackens belegen. Wie wäre es mit ein wenig Wissen für das 21. Jahrhundert? Das Programmieren kann man in Online-Akademien kostenlos lernen. Selbst wenn man sich monatelang mit dem Thema beschäftigt, wird man natürlich nicht zum Hacker, der das System austrickst, aber man wird sensibilisiert und versteht ein paar Grundbegriffe, man versteht, dass die digitale Technologie keine Zauberei ist, sondern etwas, das Menschen gemacht haben – und das Menschen deshalb auch kontrollieren und beeinflussen können.
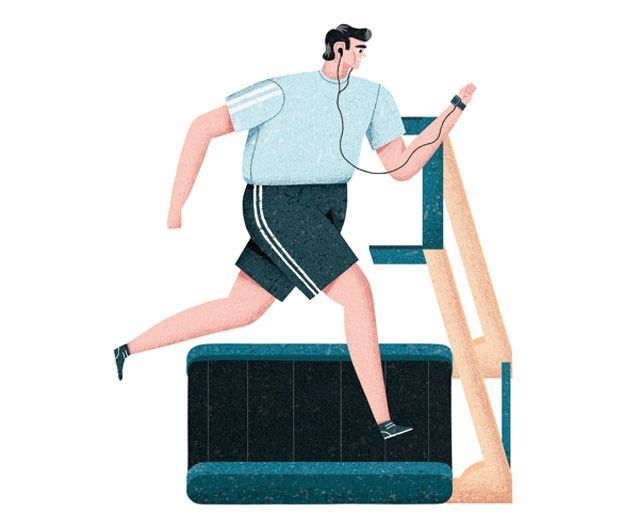
Zeitdruck im 21. Jahrhundert: Die Uhr misst den Puls und fordert mehr Tempo.
Im 20. Jahrhundert konnte man noch einigen wackeren verbeamteten Datenschützern die Drecksarbeit überlassen: Die haben schon irgendwie darauf aufgepasst, dass niemand von der Psychotherapie erfährt, die man gerade gemacht hat. Im 21. Jahrhundert müssen wir selbst für unsere Datensouveränität kämpfen. Dazu gehört etwa das Wissen, wie man E-Mails verschlüsselt. Wir müssen aber auch für moderne Gesetze kämpfen, die genau regeln, wie die großen Internetkonzerne mit unseren Daten umgehen, wann sie anonymisieren und wann sie löschen müssen.
Apple wird von seinen Fans ja für das Design der Geräte gefeiert. Aber es wäre – ja genau! – höchste Zeit, dass wir in die Tiefe gehen. Auch eine Armbanduhr sieht gut aus, doch das eigentliche Design und das eigentliche Wunder sind die Konstruktionen, die es möglich machen, dass die Uhr ganz ohne WLAN die Rotation der Planeten anzeigt und auf welchen Tag der 1. Februar 2089 fällt (Dienstag). Wie die Zahnräder einer Uhr ineinandergreifen, können wir uns ansatzweise vorstellen. Wenn uns die gleiche intellektuelle Leistung auch mit der Funktionsweise von smarten Uhren und Brillen gelingt, werden wir uns weniger vor diesen Gadgets fürchten. Spieltrieb, Neugier und Wissen sind Voraussetzungen für einen vernünftigen und erwachsenen Umgang mit der neuen Technik. Der Satz wird oft gesagt, doch im Fall der alten und der neuen Wearables, also der mechanischen und der smarten Uhren, ist er ausnahmsweise keine Lüge: Wahre Schönheit kommt von innen.
Illustrationen: Jacob Stead

