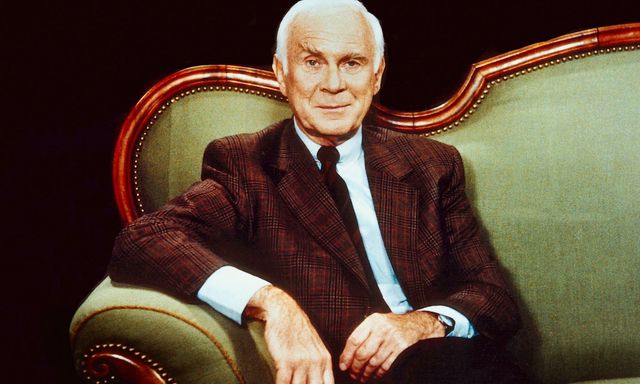SZ-Magazin: Herr von Bülow, in Umfragen zu den beliebtesten Schauspielern und Entertainern landen Sie oft auf Platz eins. Sie gelten als einer der bekanntesten Deutschen überhaupt. Wollen Sie versuchen, Ihre Popularität zu erklären?
Vicco von Bülow: Nein.
Sie stehen kurz vor der Seligsprechung. Man geht sehr respektvoll mit Ihnen um...
...manchmal vertraut man mir sogar familiäre Details aus dem Leben in Mannheim an, auch Näheres von der verheirateten Tochter in Gelsenkirchen.
Und was sagen Sie dann?
Ich bedanke mich für so viel freundliche Zuwendung und sage alles, was ich über Mannheim und Gelsenkirchen weiß.