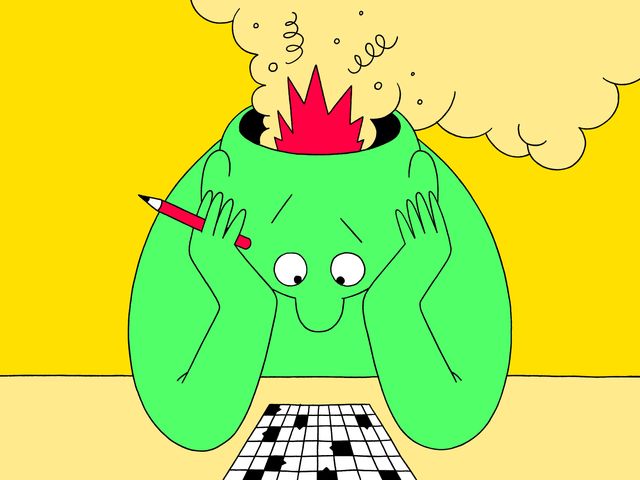Ich bin Märchenerzähler von Beruf. Es ist ein Job wie jeder andere. Ich arbeite einige Stunden am Tag, manchmal mehr, manchmal weniger, ich kann mir einen Fernurlaub im Jahr leisten, und ich gebe für meine Weihnachtsgeschenke so viel aus wie der bundesrepublikanische Durchschnitt. Mit anderen Worten: Ich kann mich nicht beklagen und muss es dennoch tun, weil die Ereignisse der letzten Wochen und Monate dazu angetan sind, meine Existenz zu zerstören.
Als Märchenerzähler fasse ich altbekannte Märchen neu. Frische Märchen gehen nämlich schlecht. Also staube ich die Klassiker ab, poliere die Evergreens. Es gibt keine neuen Geschichten, pflege ich zu sagen, aber jede Menge neue Ohren. Im Spätsommer dieses Jahres war ich dabei, das Märchen vom König Drosselbart mit eigenen Worten nachzuerzählen. Ich hatte die Villa hübsch eingerichtet, den Vater als gütig-strengen Hedgefonds-Manager eingeführt, die Vorstellung der Ehekandidaten im Golfklub elegant inszeniert, da geschah etwas, was ich nur als Sabotageakt bezeichnen kann. Es betraf den Augenblick, wo von und zu Drosselbart um die Hand der anspruchsvollen Tochter des Hauses anhalten sollte, und er machte seine Aufwartung, das Kinn so spitz, behaart und lang wie der Schwanz eines Vogels, alles schien in bester Ordnung, das Gesicht von einer Hässlichkeit, die alles Plaudern und Plauschen im Klub unterband. Doch statt den Mann ob seines grässlichen Kinns zu verspotten, verkündete die Tochter fröhlich: »Das macht gar nichts, wir heiraten, und dann gehen wir zum Schönheitschirurgen.« Alle klatschten vergnügt in die Hände, und mein Märchen war mir nichts, dir nichts zu Ende. Sosehr ich mich anstrengte, ich kam an diesem verfrühten Ausgang nicht mehr vorbei.
Mir blieb nichts anderes übrig, als mit einem anderen Märchen vorliebzunehmen, es gibt ja derer Gott sei Dank genug. Ich entschied mich für Aschenputtel, weil es mir überaus aktuell erschien, Stichwort »Soziale Kälte« usw. Außerdem hatte es schon seit Längerem kein Remake mehr von Aschenputtel gegeben. Der Verlag war begeistert; wenn ich vor Nikolaus abgeben würde, versprach man mir sogar einen Bonus. Ich machte mich an die Arbeit. Es lief so gut, bald hatte ich das Ende mit Schrecken beim von und zu Drosselbart verdrängt. Mit leichter Hand hatte ich Ort, Figuren und Geschehen eingeführt, alles schwebte, wie es sich in einem Märchen gehört, da kenterte meine Erzählung plötzlich, wie eine Nussschale in einem Sturm. Vor meinen entsetzten Augen ging das Königreich pleite, weswegen der Prinz Aschenputtel heiratete, um in schlechten Zeiten wenigstens in den Besitz der Taubenzucht ihrer Familie zu gelangen. Es reichen einige verquere Sätze, um ein Märchen abzuwürgen, um den ehrlichen Fleiß vieler Stunden zunichtezumachen. Wiederum probierte ich alles: Neuanfänge, Nebenstränge – vergebliche Müh, der Bankrott des Königreichs ließ sich nicht aufhalten. Inzwischen war es Herbst geworden, ich hatte zwei lukrative Aufträge vermasselt und mein Konto überzogen.
Ich bin keiner von jenen, die schnell aufgeben. In den Zeitungen war viel von Orient und Integration die Rede, da grub ich das Märchen vom Kalif Storch aus, um diesem einen zeitgemäßen Anstrich zu geben. Alles lief wie am Schnürchen, bald hatte ich das Aschenputtel-Trauma vergessen. Doch als dem Kalifen und dem Wesir das Zauberwort nicht einfiel, das sie in Menschen zurückverwandeln würde, da riefen sie unverzagt im Büro der DITIB an und erhielten korrekte Auskunft: Mutabor. Ich schlug auf den Tisch, fast hätte ich meinen Laptop aus dem Fenster geworfen. Und dieses Mal gab ich auf. Es hatte keinen Sinn, an der DITIB vorbeizufantasieren.
Der erste Advent war vorbei, ich hatte noch genug Geld in der Tasche, um die Schuhe meiner Kinder zu füllen, aber wenn mir nicht dringend ein Märchen gelang, würde ich leere Schachteln unter den Weihnachtsbaum legen müssen. In Blitzeseile überzeugte ich eine Frauenzeitschrift, dass Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern unbedingt als Parabel auf die Endlichkeit der fossilen Brennstoffe aktualisiert werden sollte. Das Honorar war zwar nicht üppig, aber es würde ausreichen, einen verkaufsoffenen Sonntag zu bestreiten. Ich tippte wie ein Getriebener, bei diesem, dem einfachsten aller Märchen, konnte ja nichts schiefgehen. Ich war gut unterwegs, da hörte das Mädchen eine laute, aufdringliche Stimme, schaute hoch und erblickte einen Touristen, der im breitesten Amerikanisch Laute des Mitgefühls von sich gab, und bevor ich mich versah, hatte er dem Mädchen alle Wunderkerzen abgekauft und das frierende Geschöpf zu einem Kinderpunsch in das nächstgelegene Lokal eingeladen. Ich war fassungslos, am Boden zerstört und völlig verzweifelt. Ich begann mich damit abzufinden, dass es ein kaltes, schwieriges Weihnachten werden würde.
Ich schreibe diesen Bericht, während ich im Arbeitsamt darauf warte, dass meine Nummer drankommt. Ich habe mich zur Umschulung angemeldet. Man hat mir einen Ausbildungsplatz bei einer Pomologin vermittelt.
Fotos: Daniel Sannwald