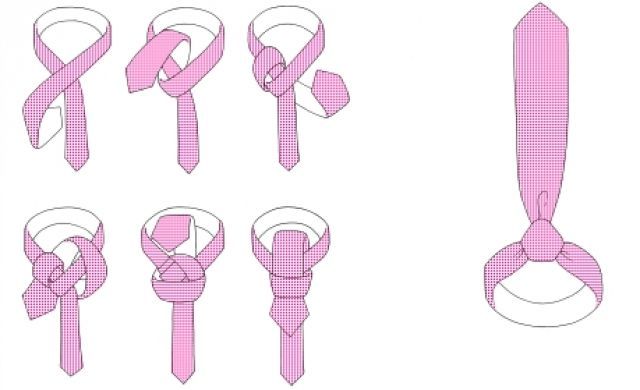SZ-Magazin: Herr Sennett, in Ihrem aktuellen Buch Handwerk plädieren Sie für ein neues Arbeitsethos des »handwerklichen Könnens«. Haben sich die Ban-ker als schlechte Handwerker erwiesen?
Richard Sennett: Absolut. Die meisten dieser Leute verstanden die Finanzinstrumente nicht, mit denen sie hantiert haben, also ihre Werkzeuge. Sie folgten einfach einer Formel. Für eine Weile schufen sie damit ungeheuren Reichtum. Als die Krise jedoch begann, wussten sie nicht, was sie tun sollten. Sie kannten keine selbstkritische Einsicht.
Was hätte ein guter Handwerker getan? Er hätte nicht nach einer neuen Formel verlangt, sondern untersucht, ob nicht die Formel selbst das Problem darstellt. Das haben nur wenige getan. Ein guter Finanz-Handwerker will die Firmen, die er kauft, auch von Grund auf verstehen. Warren Buffet ist so einer. Er denkt immer langfristig. Er bringt Interesse für sein Material auf. Das ist der Geist eines guten Handwerkers. In letzter Konsequenz heißt das: Wer ein Tabakunternehmen kaufen will, sollte sich vorher auch das Rauchen angewöhnen.
Wie könnte dieses Ethos des Handwerkers wieder in die moderne Arbeitswelt zurückkehren? Wir müssen unsere Arbeiter vielseitiger ausbilden. In der US-Autoindustrie beherrscht jeder Arbeiter genau einen Handgriff. Ein guter Handwerker hingegen besitzt viele Techniken, um ein Problem zu lösen. Deutschland hat es da besser. Das Ausbildungsniveau deutscher Arbeiter ist in Europa ohne Konkurrenz. Die Krise hat Deutschland trotzdem getroffen. Viele Menschen hierzulande wissen gutes Handwerk vielleicht zu schätzen, können oder wollen aber nicht dafür zahlen. Da kann eine Regierung ja vielleicht eingreifen und helfen. Was es braucht, ist der Wille, eine Gesellschaft aufzubauen, in der alle Menschen gut ausgebildet sind. Ganz gleich ob sie in der Fabrik arbeiten oder als Naturwissenschaftler. Das hat nichts mit Magie zu tun, es widerspricht nur vollkommen der Weltanschauung, die uns während der letzten dreißig Jahre eingetrichtert wurde. Diese Weltanschauung ist aber gescheitert.
Hat es Sie als Kapitalismuskritiker eigentlich gefreut mitzuerleben, wie eine Bank nach der anderen kollabiert? Nein, ich empfand keine Schadenfreude, wenn Sie das meinen. Zu viele Menschen haben deshalb großes Leid erfahren.
Ist die jetzige Finanzkrise eine gewöhnliche Krise, wie sie den Kapitalismus immer mal wieder durchrüttelt? Genau das behaupten zurzeit die Neoliberalen. Ich bin da anderer Meinung: Unser gesamtes Wirtschaftssystem steckt in einer fundamentalen Krise.
Woran machen Sie das fest? Die Menschen, die jetzt ihre Arbeitsplätze verlieren, werden nur schwer wieder eine Stelle finden. Das Finanzkapital schafft nämlich keine Jobs in Europa oder den USA, sondern woanders.
(Lesen Sie auf der nächsten Seite: Kann Obama den Wandel bringen, den er verspricht?)

Ist es nicht von jeher ein Problem der Globalisierung, dass die Produktion von Gütern in die Billiglohnländer verlagert wird? Schon. Aber etwas Grundsätzliches hat sich verändert: Die glorreichen Zeiten des globalen Warenaustauschs sind vorbei. Die Wachstumsraten werden noch sinken. Nicht auf Jahre, sondern auf Jahrzehnte hin. Wer jetzt so weitermachen will wie bisher, hat nicht verstanden, dass die Nachfrage weltweit sinkt: Chinas Mittelklasse wird in den nächsten zwanzig Jahren nicht weiter wachsen, also wird auch dort weniger konsumiert werden. Das Kreditkartensystem, das den Amerikanern ermöglicht hat, massiv auf Pump zu kaufen, ist Geschichte – es wird nie wieder in dieser Form existieren.
Warum nicht? Weil sich die Banken damit vollkommen verspekuliert haben.
Sie haben doch lange gut von diesem System gelebt. Ja, auf Kosten anderer. Der Rest der Welt glaubte, die Amerikaner würden all diese Kredite für Schuhe oder Reisen ausgeben. Doch sie gaben das Geld für medizinische Versorgung aus, denn in den USA gibt es kein Gesundheitssystem, 45 Millionen Menschen leben ohne jede Krankenversicherung. Die haben ihre Operationen und Arztbesuche mit ihrer Kreditkarte bezahlt. Jetzt ist das Kreditsystem zusammengebrochen und diese Menschen haben keinen Zugang mehr zu medizinischer Versorgung. Deshalb muss der neue US-Präsident Barack Obama nicht nur die Sozialleistungen für Arbeitslose erhöhen, sondern auch eine Kran-kenversicherung einführen.
Kann Obama den Wandel bringen, den er verspricht? Seine Wahl markiert einen neuen Konsens: Die Amerikaner wollten endlich einen Präsidenten, der sie wie Erwachsene behandelt, nicht wie Kinder. Das tut Obama. In Europa gilt er als Linker, wenngleich er nicht deshalb gewählt wurde. Die derzeitige Krise wird ihn aber dazu zwingen, die Probleme auf meine Weise zu lösen (lacht). Mit mehr Sozialdemokratie.
Glauben Sie das wirklich? In einem Land, in dem es jahrzehntelang hieß, jeder Einzelne sei für sein Schicksal selbst verantwortlich? Die Legitimation des alten Systems ist aber geschwunden. Amerika wird wirtschaftlich stagnieren. Das werden die Menschen schnell spüren, weil sie keine Jobs mehr finden und ihnen das Geld ausgeht zum Leben. Die Mehrheit der Amerikaner ist empört darüber, dass 700 Milliarden Dollar an Steuergeldern ausgerechnet denjenigen nachgeworfen werden, die unsere momentane Krise verursacht haben.
Die Menschen hoffen auf schnelle Lösungen. Kann Obama diesen Erwartungen überhaupt gerecht werden? Niemand kann derzeit mit dem Finger schnippen und sagen: So machen wir’s. Selbst der Präsident der Vereinigten Staaten nicht, mag er auch noch so intelligent sein. Ich denke, die Menschen müssen in erster Linie lernen, sich in Geduld zu üben. Es wird keine sofortige Heilung geben. Auch der Aufbau eines tragfähigen sozialen Netzes wird dauern. George W. Bush, aber auch sein Vorgänger Bill Clinton waren ja stolz darauf, den Sozialstaat auszuhöhlen. Wir wollen die Menschen nicht gängeln oder verhätscheln, hieß es. Die kommende Stagnation wird in dieser Hinsicht einen grundlegenden Mentalitätswandel herbeiführen.
(Lesen Sie auf der nächsten Seite: Wer glaubt, dass dieses ungerechte System der Hierarchie und Ungleichheit aufrechterhalten werden könne, ist ein Träumer.)

Ist es nicht bitter für die US-Bürger, sich vom amerikanischen Traum verabschieden zu müssen: dass es jeder schaffen kann, wenn er nur hart genug arbeitet? Manchmal ist es weniger deprimierend, ein Realist zu sein. Die neoliberale Ideologie suggerierte ja, dass man allein die Schuld trägt am eigenen Elend. Dass mit diesem Moralismus nun Schluss ist, muss niemanden in Trauer stürzen.
Was könnte an die Stelle dieser Ideologie treten? Vielleicht der Verzicht, die großartige katholische Tugend. Und zwar in einem säkularen Sinne: die Tugend, dass man mit den Grenzen, die jedem Menschen persönlich gesetzt sind, fertig wird. Was nicht heißt, dass der Einzelne deshalb weniger wert wäre.
Das klingt ein wenig, als sollten wir uns einfach dem Schicksal ergeben? Ich spreche nicht von Passivität oder Resignation. Ich sage nur: Wir haben in einem sonderbaren Universum gelebt, in dem eine nüchterne Einschätzung darüber fehlte, was das System leisten kann und was nicht.
Folgt aus einer nüchternen Einschätzung des Systems nicht auch, dass soziale Gerechtigkeit eine Illusion ist? Nein, ganz im Gegenteil: Wer glaubt, dass dieses ungerechte System der Hierarchie und Ungleichheit aufrechterhalten werden könne, ist ein Träumer. Das Leben ist unfair, kein Thema. Aber ein Wirtschaftssystem, das so viel Wohlstand schafft, aber nur so wenigen zugänglich macht – wird auf Dauer kaum tragen. Der Traum der Neoliberalen war ja, die Gesellschaft würde die Ungleichheit letztlich hinnehmen. In der Realität hat sich gezeigt, dass Menschen, die immer nur verlieren, irgendwann aufbegehren. Dieser Prozess hat gerade erst begonnen.
Wo wird uns die Krise noch hinführen? Das kann ich Ihnen genau sagen: Wenn wir in Europa bald Wachstumsraten von zwei Prozent haben, werden wir dauerhaft mit einer strukturellen Arbeitslosigkeit von etwa 8,5 Prozent leben müssen. Dieses Problem will erst einmal bewältigt sein. Erst dann können wir darüber nachdenken, Geld in Industrien zu investieren, damit sie sich langfristig entwickeln. Ich war übrigens sehr froh, dass die britische Regierung die Banken verstaatlichte. Das würde ich mir für Deutschland auch erhoffen.
Wie muss sich das globale Wirtschaftssystem verändern? Das Letzte, was ich mir wünsche, wäre die Restauration des Ancien Régime. Es nur an die Leine zu nehmen reicht ebenfalls bei Weitem nicht. Man könnte versuchen, ein System zu entwickeln, das auf Kooperation basiert, statt die Menschen nur auszusaugen. Dafür müssen wir aber noch viel lernen. Wer weiß, vielleicht stellt sich am Ende dieses Prozesses sogar heraus, dass es am besten ist, wenn die Wähler selbst über ihr Finanzsystem entscheiden können.
Ist diese Vorstellung nicht völlig unrealistisch? Ich weiß, man gilt sofort als hoffnungsloser Romantiker, wenn man von einer kooperativen Gesellschaft träumt. Nun: Ja! Wir müssen kooperieren. Wenn wir das nicht tun, werden sich unsere Lebensumstände auch nicht verbessern.
Richard Sennett
geboren 1943 in einem Armenviertel von Chicago, lehrt Soziologie und Geschichte in London und New York. Er ist einer der bedeutendsten Theoretiker unserer Zeit. Zuletzt beschäftigte er sich mit der Kulturgeschichte des Handwerks.
Foto: dpa
Illustrationen: Dirk Schmidt