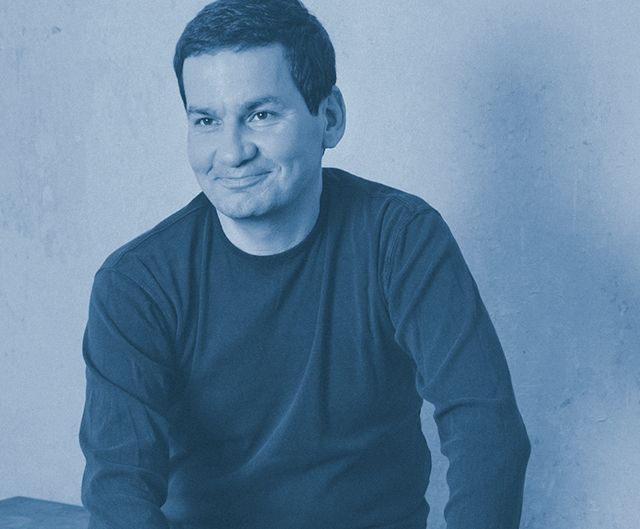SZ-Magazin: Viele Menschen träumen vom eigenen Lokal. Besonders Künstler, weil sie an ein sicheres Standbein denken. Was war Ihr Grund, ein Café aufzumachen?
Moritz Netenjakob: Meinen ersten Roman habe ich zu zwei Dritteln in meinem Kölner Stammlokal geschrieben, ich habe auch oft in Cafés Lesungen gehalten, da dachte ich irgendwann, so ein eigenes Lokal müsste doch paradiesisch sein und wird schon laufen. Ein reines Liebhaberding.
Haben Sie einen Kredit aufgenommen?
Nein. Ich habe nur mein eigenes Geld verbraten, jeden Monat einen vierstelligen Betrag. Mein erster Roman Macho Man war erfolgreich. In einem Anfall von Übermut dachte ich dann: Jetzt oder nie. Hinzu kam, dass mein türkischer Schwager Lebensmittelchemiker war und schon lange nach Deutschland kommen wollte. Also haben meine Frau, mein Schwager und ich uns in Köln auf die Suche gemacht und unser Café bald eröffnet.
Niemand vom Fach?
Nee, das war ja das Problem. Mein Steuerberater hat auch gleich gesagt: Mein Gott, bitte nicht noch ein Künstlerlokal, tun Sie es nicht! Hätte auf ihn hören sollen.
Wie lange gab es Ihr Café?
Zehn Monate. Zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass mein Nachfolger noch schneller pleiteging.
Lag es vielleicht an der Lage?
Da war ja schon ein Lokal drin, das ich noch aus meiner Schulzeit kannte. Da ging man hin, wenn man die Schule schwänzte, was ich natürlich nie tat. Bei unserem drittem Nachpächter funktioniert der Laden jetzt richtig gut.
Was macht er anders?
Wir haben das zehnte Café in der Gegend eröffnet, er verkauft Burger, das ist schon mal keine schlechte Idee. Außerdem hat er das Talent zum Gastgeber. Schon beim ersten Besuch fängt der ein Pläuschchen an, ich habe mich gleich wie ein Stammgast gefühlt.
War es also Ihr Unvermögen oder Ihr Pech?
Ich hab’s nicht gekonnt, wir gingen viel zu blauäugig an die Sache. Wenn man im Café sitzt, romantisiert man das und denkt sich: Ach, die Kaffeemaschine zu bedienen kann ja nicht weiter schwer sein. Ich wollte das Ganze auch nicht hauptberuflich machen, sondern so nebenbei, aber da kommt schnell einiges auf einen zu, zumal mein Schwager, der den Laden führen sollte, direkt aus der Türkei kam und mit deutschen Verhältnisssen überfordert war. In der Türkei sind Arbeitskräfte viel billiger, und unser Café hatte nur 45 Sitzplätze, da darf man nicht groß Leute engagieren.
Sie hätten das wissen können.
Ach, ich hatte einen Businessplan erstellt und dachte, einen Bestseller zu schreiben ist viel unwahrscheinlicher, als ein Café erfolgreich zu führen.
Haben Sie selbst im Café gearbeitet?
Immer wieder, wie auch mein zweiter Schwager. Der ist eigentlich Comedian.
Hat das Scheitern Ihre Ehe belastet?
Natürlich. Wenn man in eine Pleite reinschlittert und die Familie involviert ist, dann ist das schon ein guter Test für die Tiefe der Liebe. Wobei ich sagen muss: Das künstlerische Programm, das wir im Café auf die Beine gestellt haben, mit Lesungen, einer Radiosendung, die ich live moderiert habe, und Auftritten von Bastian Pastewka und Anke Engelke, hat schon einige Aufmerksamkeit bekommen. Das hatte zur Folge, dass uns der Andrang zwischendurch völlig überfordert hat. Wenn 45 Leute da waren, mussten manche eine Stunde auf ihr Frühstück warten. Da zeigte sich schnell, dass wir keine Profis waren. Die vielen Gäste, die wir durch die Lesungen bekamen, verloren wir schnell wieder, weil wir zu langsam waren.
Eine Stunde für ein Frühstück?
Unser Koch war halt nicht der Schnellste. Dabei hatten wir leckere Sachen, türkische Küche aus Izmir, der Heimat meiner Frau.
In Deutschland bringt man ein Café nicht unbedingt mit einer türkischen Speisekarte in Verbindung.
War natürlich auch ein Fehler: Wenn man etwas Ungewöhnliches macht, muss man das besser bewerben. Wir hatten uns Café genannt, und man musste erst reinkommen, um zu merken, dass man da richtig essen kann.
Haben Sie sich nie Hilfe von Profis geholt?
Doch, wir haben einen iranischen Koch engagiert und in der Schlussphase noch einen Profi-Gastronomen, aber die Mehreinnahmen, die durch ihn hereinkamen, waren durch sein Gehalt wieder weg. Gegen Ende bin ich noch zu einem Berater gegangen. Der meinte, ich müsse im Großmarkt nach Sonderangeboten suchen und die dann auf die Karte setzen. Da fing ich an zu heulen, so wollte ich nie denken. Das war der Moment, in dem ich die Reißleine gezogen habe, kurz vor der Insolvenz. Die tausend Ratschläge, die man bekommt, wenn man ein Lokal aufmacht, haben mich ohnehin wahnsinnig gemacht. Jeder rät was anderes. Eine Frau meinte, ich müsse unbedingt den einen teuren japanischen grünen Tee auf die Karte nehmen, die ist dann aber nie wiedergekommen, kein Mensch hat je diesen Tee bestellt. Oder die Sache mit der Cola: Man könne sich mit der richtigen Cola-Marke im Markt positionieren.
Bereuen Sie Ihren Ausflug?
Ich bereue nichts. Ist ja auch ein Roman draus geworden, Milchschaumschläger wird er heißen. Insofern muss ich es nicht als Pleite bezeichnen, sondern einfach als sehr teure Recherche. Außerdem haben meine Frau und ich das Glück schätzen gelernt, von der Kunst leben zu können. Mein Respekt vor Gastronomen ist auch enorm gestiegen, früher war ich viel ungeduldiger, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Inzwischen hab ich eher Mitleid, als dass ich mich ärgere.
Foto: Britta Schüßling