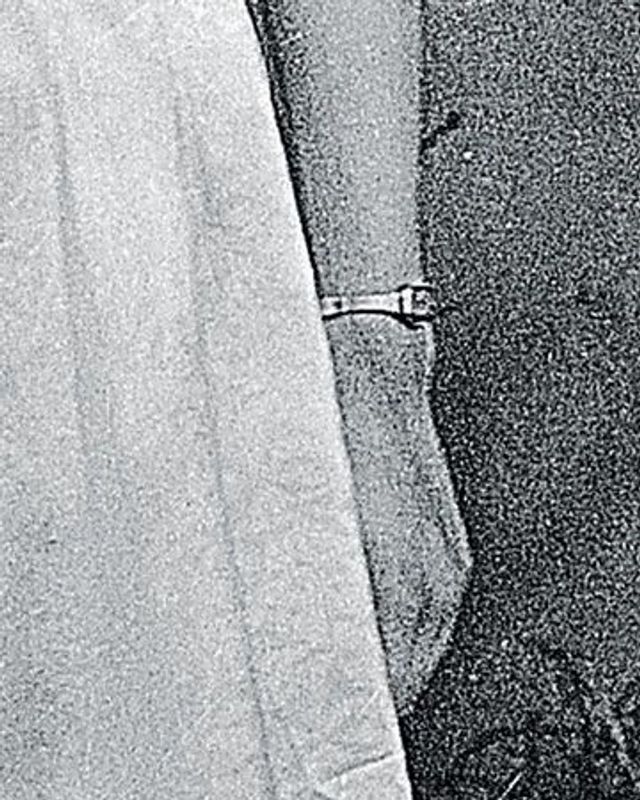Die Wand war gelb, so wie jede Krankenhauswand gelb ist, an die man sich erinnern will. Ich stand vor ihrer Tür und wartete. Es war früher Abend, rechts den Gang entlang war das Schwesternzimmer, von dort kam ein leises Murmeln und von weiter hinten der Klang eines Fernsehers. Links den Gang entlang war es leer. Es roch nach nichts.
Aber es musste nach etwas riechen. Es musste etwas geben, an das ich mich erinnern konnte. Die Tür öffnete sich, und die Schwester kam heraus. Sie war nicht jung und nicht alt, oder sie war jünger, als ich dachte. Ich schaute sie an, und ihr Gesicht war schon verschwunden. Ich wartete kurz, dann ging ich hinein und zog erst die Tür zu, bevor ich mich zu meiner Mutter umsah. Sie saß halb und lag halb, sie hatte die Augen geschlossen und die Decke bis unters Kinn gezogen, sie trug ein rotes Nachthemd, das konnte ich sehen, weil ihr rechter Arm unter der Bettdecke herausgerutscht war. Sie war schon seit zwei Tagen hier. »Du hast es mir doch versprochen«, hatte sie gesagt, als ich sie das erste Mal besuchte, kurz nachdem sie eingeliefert worden war, traurig und mit müden Augen, sie sah auf einmal ganz anders aus.
»Du hast es mir doch versprochen«, den Vorwurf, der in diesem Satz lag, konnte ich verkraften, ich konnte ihn verstehen. Es war trotzdem bitter.
Ihr Atem ging schwer, aber nicht mehr ganz so schwer wie am Tag zuvor. Es war ihr Hausarzt Doktor Koschine gewesen, der festgestellt hatte, dass sie Wasser in der Lunge hatte. Er war ein kleiner Mann mit Augen, die einen trösten konnten, obwohl sie traurig schauten. Er war einer der wenigen Menschen, denen meine Mutter bis zuletzt vertraute.
Er wollte alles dafür tun, dass sie zu Hause sterben konnte. Auch deshalb mochte sie ihn. Als er mich dann anrief, war ich tatsächlich überrascht. Ich hatte gedacht, dass wir es ohne Krankenhaus schaffen würden, auch wenn das vielleicht naiv gewesen war; und ich wusste nicht, was ich meiner Mutter sagen sollte.
»Ich habe schon mit ihr gesprochen«, sagte er, »sie ist einverstanden.«»Sie ist einverstanden?« »Sie leidet, wissen Sie. Es strengt sie sehr an zu atmen.« »Und was heißt das – punktieren?«
»Ich würde das lieber im Krankenhaus machen, das ist sicherer. Die Flüssigkeit wird dort auch gleich untersucht.« Ich schaute auf die Autos, die durch das dunkle Berlin fuhren, so weit weg, so nah. »Und wann?« »Gleich morgen.«
Ich legte auf, ging in die Küche, machte den Kühlschrank auf, machte ihn wieder zu und rief Elfi an, die älteste Freundin meiner Mutter. Sie würde da sein, wenn der Krankentransport komme, sagte sie, sie würde mit ihr ins Krankenhaus fahren, sie würde aber nicht warten können, bis ich da war.
Ich nahm den Flug am frühen Nachmittag, und als ich im Krankenhaus ankam, war es schon dunkel. Es war ein Gefühl zwischen Aufgeregtheit und Ruhe, zwischen Ergebenheit, Erschrecken und Erleichterung. Die Krankheit hatte sich selbstständig gemacht. Der Punkt war gekommen, an dem es kein Ausweichen mehr gab.
Eine Weile geht das recht gut, sehr lange sogar. Der Körper ist mehr eine Ahnung, der fremde sowieso, und so bleibt das, was die Krankheit mit ihm macht, ein Rätsel. Dieses Rätsel bleibt intakt, muss intakt bleiben, es wäre zu schmerzhaft, es zu ergründen.
Meine Mutter hatte ihr ganzes Leben über versucht, stark zu sein, vor allem nach der Scheidung. Stark sein, unabhängig sein, frei sein. Sie hatte das geübt, hatte es trainiert. Ich würde sagen, dass das eine Fiktion ist, eine Selbsttäuschung, dass die Stärke, so wie sie das verstand, etwas Heroisches hatte, fast etwas Pathetisches, und wie alles Heroische machte sie das in letzter Konsequenz einsam.
In ihrem Sterben spiegelte sich noch einmal vieles von dem, was ihr Leben bestimmt hatte, dieses Leben, das manchmal wirkte wie eine Versuchsanordnung, sie war eben die Tochter eines Ingenieurs. Sie hatte sich alles so genau überlegt. Sie hatte vorausgedacht, ihr Kopf war schneller gewesen als ihr Körper, und als ihr der Körper entglitt, blieb ihr immerhin der Rest dieses Plans.
Auch ich hatte einen Platz in diesem Plan, aber wir waren uns beide nicht ganz sicher, wie dieser Platz aussehen sollte. Das lag zum einen an mir, zum anderen an ihr, vor allem aber daran, dass sie lange brauchte, bis sie das Wort »Mutter« ohne Spott oder sogar Verachtung aussprechen konnte.
Sie wollte auf keinen Fall eine Mutter sein wie all die anderen und vor allem nicht wie ihre eigene, jene Martha Hövelmann, die uns manchmal Butterkuchen mit der Post schickte, das war schon ein Zeichen von Zuneigung. Die ich vier oder fünf Mal gesehen habe und die in meinem Leben keine Rolle spielte und an deren Gesicht ich mich nicht erinnern kann, nur an ihre Brille.
Sie hatte den vier Geschwistern meiner Mutter immer gesagt, dass die eine Klasse übersprungen und ihr Abitur mit einer Eins gemacht hatte, was gar nicht stimmte, aber es wäre halt schön gewesen, und außerdem konnte sie so die anderen Geschwister etwas verunsichern und antreiben, das war ihr Wesen.
Diese selbstbezogene Verlogenheit bleibt als Bild von meiner Großmutter, die selbst bestimmte Freiheit war das Ideal meiner Mutter, dazwischen tat sich eine Leere auf, die wir nur teilweise gemeinsam füllten. Als sie stark war, merkte ich das nicht; als sie schwach wurde, gelang es uns besser.
Wir beide verstanden irgendwann, dass es eine ganz andere Art von Stärke erfordert, schwach zu sein. Meine Mutter musste erst lernen, schwach zu sein.

Ich setzte mich zu ihr, auf den Rand des Bettes. Morgen würde sie entlassen werden, das hatten die Ärzte versprochen. Eigentlich sollte sie nur eine Nacht dort sein, jetzt waren es schon drei. Das Wasser aus der einen Lungenhälfte musste entfernt werden, aber weil es so viel war, konnte die andere Hälfte nicht sofort punktiert werden.
»Ja, ja«, hatte sie gesagt, als habe sie schon geahnt, dass sie am Ende doch noch verraten werden würde, um ihr Sterben betrogen. Ich schaute sie an und schaute weg, schaute zum Fenster, weil sie recht hatte und gefangen war in einer der Schleifen, die der Tod immer enger um einen zieht. Gerade ganz am Ende, wenn jede Maßnahme zugleich notwendig und überflüssig ist.
»So soll Ihre Mutter nicht sterben«, hatte Doktor Koschine gesagt, und er meinte damit das Röcheln und Schnaufen und die Atemnot und die Angst und das Wasser in der Lunge. Natürlich nicht. Aber so wollte sie eben auch nicht leben, in einem fremden Zimmer, mit einer Bettdecke, die nicht nach ihr roch.
Sie hat sich ja sogar ihr eigenes Bettzeug mit in den Urlaub genommen. Warum war ihr das so wichtig? Als ich neben ihr saß, in diesem fremden Zimmer, da hatte ich kein schlechtes Gewissen; ich wollte keines haben. Ich wollte nicht, dass dieses Gefühl, dieses negative Gefühl, das überdeckte, was war.
Ich wollte ihr helfen, wollte das Richtige tun. Ich wollte der Sohn sein, der erwachsen geworden ist, der für seine Mutter sorgen kann. Und ich wollte wahrnehmen, wollte erinnern, wollte mitnehmen, was ich konnte. Das lähmte und beflügelte mich zugleich, ich war gefangen in einer der Schleifen, die der Tod auch um die zieht, die dabeistehen und zusehen.
Ich legte ihr die Hand auf den Kopf und streichelte leicht über ihre Haare, die nach der Chemotherapie wieder gewachsen waren, dünne Haare, wie bei einem Kind, das nackt auf die Welt gekommen ist, abhängig und so allein. Sie bewegte den Kopf ein wenig, immerhin.
Die Zärtlichkeit, die gewachsen war, ganz langsam, vor allem in den letzten Wochen, als die Krankheit meine Mutter endgültig beherrschte, diese Zärtlichkeit und Intimität, das war etwas, das ich ihr geben wollte. Das ich mitnehmen wollte. Das tatsächlich da war, das nicht selbstverständlich war, für uns jedenfalls nicht.
»Morgen kommst du nach Hause.« »Das sagst du.« »Und Elfi wird da sein.« »Das wäre schön.« Sie schwankte, zwischen einer Skepsis, die verständlich war, aber auch verletzend sein konnte, und einer Weichheit, die ich nicht kannte, aber sehr mochte.
Ich würde am nächsten Morgen nach Berlin zurückfahren, ihre Freundin Elfi würde da sein, wenn meine Mutter mit dem Krankenwagen nach Hause käme, sie würde sie ins Bett bringen, und Doktor Koschine würde vorbeikommen, Doktor Koschine, der gesagt hatte, dass alles in Ordnung sei, »es ist alles in Ordnung«, hatte er gesagt.
Ich würde Mitte der nächsten Woche wiederkommen, zusammen mit meiner Frau. Wir hatten am Wochenende einen Geburtsvorbereitungskurs in Berlin. Meine Mutter hatte schon öfter gesagt, sie mache sich Sorgen, weil ich so oft bei ihr sei und nicht bei meiner Frau, sie hatte gesagt, sie wolle nicht schuld sein, sie wolle nicht, dass dem Kind etwas passiert. Sie wollte das Leben nicht durch das Sterben gefährden.
»Willst du noch etwas essen?« Das Tablett stand am Fußende des Bettes. Meine Mutter lächelte. Es klopfte an der Tür, und der Arzt kam herein. Meine Mutter war bei der AOK versichert, aber die Chefarztbehandlung hatte sie sich geleistet. Der Arzt schüttelte mir die Hand, was im Krankenhaus etwas zwischen »Guten Tag« und »Herzliches Beileid« bedeutet. »Ich gehe mal kurz auf den Balkon.« Der Arzt nickte. Meine Mutter reagierte nicht, als ich aufstand, und ihre Hand, die ich gehalten hatte, glitt sanft und warm aus meiner.
Draußen war es dunkel und kühl. Ich konnte die Isar von hier aus sehen, selbst im Dämmerlicht, es ging ein Leuchten aus von diesem Fluss, das er auch bei Tag hat, etwas von dem Glanz der Berge schien er mit sich zu tragen, und selbst das Rauschen erinnerte mich an einen Bergbach und nicht an einen der ernsten deutschen Flüsse, auf denen Schiffe fuhren und um die gekämpft worden war. Die Isar ist ein heiterer Fluss, leicht, beschwingt, fast frei.
Schon wegen der Isar musste meine Mutter München mögen. Weiter konnte sie sich nicht entfernen vom Bremen ihrer Kindheit, von der engen Bürgerlichkeit und dem Eckhaus im vornehmen Stadtteil Schwachhausen, ein Haus mit kleinem Garten und kleinen Zimmern, umgeben von größeren Häusern mit größeren Zimmern. Ein Haus, das wirkte, als sei es falsch am Platz.
Aber die Hövelmanns waren in Schwachhausen, das war wichtig, sie waren auf dem richtigen Weg, nach oben. Den Aufstieg wollte vor allem Martha, eine einfache Frau aus einer Soldatenfamilie, mehr noch als ihr Mann Hans-Hermann, ein Erfinder, der Ende der Fünfzigerjahre ein Container-Patent für 65 000 Mark verkaufte, ein Bastler, dessen Vater Maschinenbau studiert hatte wie er, ein kalter, distanzierter Mensch, der enttäuscht war, als keiner seiner drei Söhne Ingenieur wurde.
Martha war protzig, Hans-Hermann war fleißig. Die eine war verlogen, der andere war verschlossen. Zärtlichkeit gab es nicht, Nähe gab es nicht, und geredet wurde auch nicht. 1963 starb Hans-Hermann. Während der Arbeit, wie sonst. Am Herzinfarkt, heißt es.
Auch um diesen Tod gibt es Gerüchte, so wie vieles Gerücht war und Geraune in dieser Familie. Eine Geschichte, die Martha immer wieder erzählte, war die von den polnischen Kriegsgefangenen, die sie gerettet habe. Ob sie diese Geschichten selbst glaubte oder nicht, spielte dabei keine so große Rolle.
Langsam wurde mir kalt. Die Isar war der Fluss meiner Kindheit. Durch den Park hindurch konnte ich sie vom Balkon aus gut sehen, jetzt, wo die Bäume keine Blätter mehr trugen. Sie floss von rechts nach links, von Nirgendwo nach Nirgendwo. Ich ging hinein und schloss die Balkontür leise hinter mir. Der Kopf meiner Mutter war zur Seite gerutscht. Sie hatte die Augen geschlossen. Es war eine andere Wand als zu Hause.

Krebs zehrt einen aus, Krebs nimmt einen langsam weg. Was Krebs ist, habe ich erst wirklich verstanden, als ich meine Mutter zum Punktieren begleitete. Ich ging neben ihr her und hielt ihre Hand, während sie im Bett lag und den Gang entlanggeschoben wurde. Das Behandlungszimmer war groß, und ich setzte mich auf einen Stuhl an der Wand, möglichst weit weg von ihr. Sie konnte mich sehen, wenn sie wollte. Aber ich musste nicht sehen, was ich nicht wollte.
Ich schaute dann doch kurz hin, sah meine Mutter kaum, sah dafür das, was an ihrer Brust wucherte, rötlich, tödlich, was das Leben fraß, gierig und gemein.
Sie hatte sich zur Seite gerollt, ich sah ihren Körper und sah nicht die Frau, die meine Mutter war. Ich sah eine kranke Frau, die mir fremd war. Als sie ihr Nachthemd angezogen hatte, ging es wieder.
Auf dem Weg zurück in ihr Zimmer schaute sie zur Seite, ich schaute zu ihr hinunter, sie sagte nichts, sie hatte so lange gekämpft, dass ein Ende auf gewisse Weise gar nicht vorstellbar war. Und jetzt umso unausweichlicher wurde. Wir saßen im Zimmer und wussten, dass die Zeit wertvoll war. Wir saßen im Zimmer und sagten nicht viel und schwiegen dann, zusammen.
Wie man die Blicke der Krankenschwestern sucht und vermeidet. Wie man den Mann, der das Bett schiebt, anschaut und sich dafür interessiert, was einen nicht interessiert, seine müden Augen zum Beispiel oder die Frage, was so jemand wohl nach der Arbeit macht. Wie man auf den Arzt wartet, der kommt und auch nichts weiß.
Wie man sich selbst sagt, dass das eben so ist. Wie es nicht leicht ist, immer hoffnungsvoll zu sein und gut gelaunt und sensibel und still und unterhaltend und still und zuhörend und still und hoffnungsvoll. Wie das Zimmer da ist, stärker, als es sein müsste. Wie man Gast ist, ausgeliefert, angewiesen auf andere, wie sonst nie.
Wie die Krankheit die Tage bestimmt, die Tage der Chemotherapie, die Tage danach, die Tage der Erholung, die Tage der Tests, die Tage des Wartens, die Tage der Ergebnisse, die Tage der Hoffnung, die Tage der Erschöpfung und der Verzweiflung. Wie man immer allein ist, sie, die Kranke, ich, der Sohn.
Wie man es mal vergisst und doch nicht vergessen kann. Wie man sich schämt, weil man es doch vergessen hat. Wie ich dasitze und weiß, dass das Ende kommt, und nicht weiß, nicht mal ahne, wie es ist, wie es sein wird, jetzt ist sie noch da, bald wird sie nicht mehr da sein, wie wird das sein, ohne sie? Wie geht das?
Es ist so ruhig im Krankenhaus, so trügerisch. Den Tod hört man nicht, es wäre besser, er würde sich mit Lärm oder mit Schreien ankündigen. Die langen Gänge, die Türen, die Stille dahinter. Das, was vergeht. Das Normale am Schrecken ist das eigentlich Verwirrende.
Ich sitze an ihrem Bett und füttere sie, wie man ein Kind füttert. Ich halte ihren Kopf mit der linken Hand, ganz sacht, damit sie sich nicht so anstrengen muss. Ich habe ihr geholfen, sich aufzusetzen, ich habe sie mit der einen Hand um den Rücken gefasst und mit der anderen Hand unter die Knie, ich habe sie angehoben und nach hinten geschoben, was leichter war, als ich dachte, und schwerer, wie immer.
Ich rede mit ihr, leise Worte, nur der Klang, während sie nicht weiß, ob sie sich schämen soll, weil sie wie ein Kind gefüttert wird, oder ob sie es geschehen lassen soll, weil es ihr Kind ist, das sie füttert. Ob sie es sogar ein wenig genießen kann.
Diese Nähe, die im Ende wohnt. Sie isst ein wenig Suppe, sie schluckt, es scheint mir, dass sie mehr isst als sonst. Sie ist schwach, aber sie ist da. Sie konzentriert sich darauf, nichts zu verschütten, wie ich mich darauf konzentriere, nicht mit dem Löffel zu wackeln.
Es ist ein kleiner Löffel. Sie hält das Kinn etwas gesenkt. »Es ist gut«, sagt sie, »danke.« »Noch ein bisschen?« »Schorsch.« »Ich will ja nur, dass du isst.« »Ich esse doch.«
Warum auch streiten. Ganz sanft sinkt sie wieder zurück in die Kissen. Sie hat die Beine angezogen. Sie hat nichts von den Pralinen gegessen, natürlich nicht. Ich habe sie mitgebracht, damit ich ihr Pralinen mitbringen konnte, obwohl ich wusste, dass sie die nicht isst. Pralinen aus ihrem Viertel, ein Stück ihres alten Lebens, ihres guten Lebens.
»Soll ich noch ein bisschen dableiben?« »Musst du nicht.« »Kann ich aber.«
Es ist früher Abend, gegen sieben, ich will nicht auf die Uhr schauen, ich habe es schon eine Weile vermieden, auf die Uhr zu schauen, es scheint so verletzend. Etwas drängt mich zu bleiben, etwas drängt mich zu gehen.
Ich bleibe sitzen und schaue sie an und versuche, in ihrem Gesicht etwas zu finden, ich weiß nicht, was. Ich weiß nicht, was ich suche. »Ich fahre dann morgen nach Berlin zurück.« »Schön. Grüß mir die rosa Prinzessin.«
»Das mache ich.« »Pass gut auf sie auf.« »Ja.«
Der Fluss ist schwarze Ruhe. »Wir kommen nächste Woche wieder.«
»Schön«, sagt sie und lächelt ihr Lächeln ohne Wiederkehr. »Also«, sage ich.
Ich ziehe meinen Mantel an, meinen Schal, sehr langsam, jede Geste ist seltsam klar und bewusst, ich wickele mir den Schal um den Hals; hat sie ein Seidentuch um den Hals?
»Elfi ist morgen da. Morgen kommst du nach Hause. Sie wird bei dir sein, ja?« Sie sagt jetzt nichts. Ich stehe an ihrem Bett, lege meine Hand auf ihren Arm. Der ist warm.
»Tschüss.« »Ciao«, sagt sie, ein letztes Wort, ein Wort wie ein Lächeln, vor allem, wenn man es so sagt wie meine Mutter und das c genießerisch breit drückt, das i kurz berührt, das a gleich zweimal oder dreimal überspringt, das o möglichst lange oben hält.
Ciao.
Wie ist das, einen Menschen zu verlieren, den man geliebt hat, ohne ihn am Ende wirklich gekannt zu haben? Georg Diez hat ein Buch darüber geschrieben: "Der Tod meiner Mutter" erscheint am 24. August bei Kiepenheuer & Witsch.