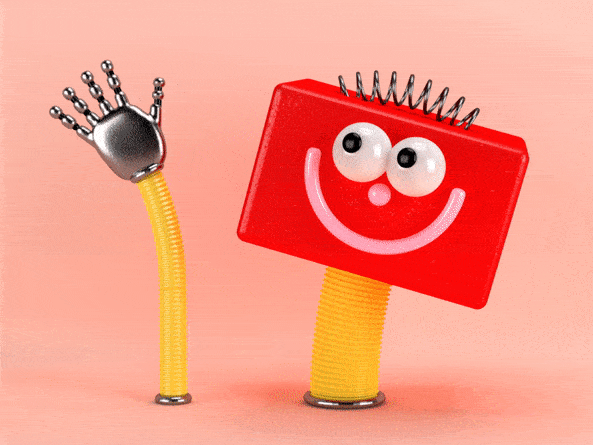Vier Computer umfasste das Internet an seinem Anfang. Einer der Rechner stand in der University of California, Los Angeles, und von dort verschickten der Wissenschaftler Leonard Kleinrock und sein Team vor fünfzig Jahren, am 29. Oktober 1969, die erste aller Nachrichten im Netz – die Geburtsstunde des Internets. Sie tippten die Buchstaben einzeln: L, O, doch dann stürzte der Computer ab, der die Nachricht empfing. Erst Stunden später kam die komplette Nachricht an, LOG, für Log-in. Heute umspannt das Internet die Welt, jeden Tag werden mehr als 280 Millarden Mails verschickt – es berührt alle Bereiche des Lebens. Aus Anlass des fünfzigsten Geburstages haben wir 19 Menschen versammelt, die für die Fülle des Internets stehen.
1) Die Frau, die junge Menschen vor Internetpornos schützt – indem sie selbst einen Sexfilm drehte

Sarah Sandler hat Mums make Porn gedreht.
Foto: privat
SZ-Magazin: Sie leben in der Graftschaft Flintshire in Nordwales, sind Mutter zweier Töchter und haben kürzlich im Dokumentarfilm Mums make Porn mitgewirkt, der in Großbritannien auf Channel 4 lief. Darin ist zu sehen, wie Sie einen Pornofilm produzieren. Was ist das für ein Film?
Sarah Sandler: Wir, vier ganz normale britische Mütter, haben einen ethischen Porno gemacht, für junge Erwachsene. Wir haben das Drehbuch geschrieben, Darsteller gecastet, Regie geführt. Vor der Kamera standen wir nicht. Es ist entsetzlich, welche Pornos man im Internet findet. So viel Gewalt! In 88 Prozent der Hardcore-Pornos wird Frauen Gewalt angetan. Was geben wir unseren Kindern für ein Bild mit? Frauen müssen unterwürfig sein, Männer brutal? Wir wollten es anders machen.
Spricht in Ihrem Film ein Erzähler, der sagt: »Das hier ist der Penis des Mannes …«
Nein. Es ist kein Schulfilm. Es ist ein sehr sanfter Porno mit echten Menschen und echter erotischer Spannung. Beide müssen Freude haben am Sex. Es geht um Gleichberechtigung. Man muss reden: Was will ich? Was willst du? Bei uns tun das erst zwei Frauen, dann eine Frau und ein Mann. Dann gibt es ein Vorspiel. Danach Sex, Orgasmen, alle haben Spaß.
Haben Sie als Jugendliche mit Ihren Eltern über Sex gesprochen?
Oh, mein Gott! Nein! Wir leben in Großbritannien. Niemand spricht über Sex.
Haben Ihre Töchter Ihren Film gesehen?
Nein, das will ich nicht. Sie haben nicht einmal die Doku gesehen, das ist nichts für Kinder. Meine Töchter sind zwölf und 17 Jahre alt, wenn sie 18 sind, können sie sich alles ansehen. Es ging nie darum, einen Porno zu machen, den sich dann meine eigenen Kinder anschauen. Auch wenn einige Klatschblätter das so geschrieben haben. Die Leute sollen endlich mit ihren Kindern über Sex reden, das war unser Ziel. Bei mir hat es schon gewirkt: Wenn meine Töchter mit mir über Sex reden wollen, kichere ich nicht mehr wie ein Teenager.
Interview: Tobias Scharnagl
2) Die Frau, die selbst Kindern Programmieren beibringt

Diana Knodel zeigt Kindern, wie man programmiert.
Foto: privat
Sie haben in Hamburg ein Start-up gegründet, das Kindern beibringt, wie man Apps und Computerprogramme schreibt – und das Buch Einfach Programmieren für Kinder veröffentlicht. Eltern haben aber ja oft das Gefühl, dass Kinder schon mehr als genug Zeit vor dem Bildschirm verbringen.
Diana Knodel: Viele Eltern kommen eben aus einer Generation, wo das Programmieren noch keine so große Rolle gespielt hat. Also erklären wir ihnen, dass es wichtig ist, nicht nur Anwender heranzuziehen, die digitale Produkte bloß nutzen können, sondern Leute auszubilden, die Technologie verstehen und irgendwann auch mitentwickeln können. Damit vielleicht eines Tages die großen Durchbrüche in Software oder künstlicher Intelligenz nicht nur aus dem Silicon Valley oder China kommen. Außerdem finde ich wichtig, dass Kinder lernen, wie Computerprogramme funktionieren, um dann auch als Erwachsene bewusster mit dieser Technik umzugehen. Wer einmal eine Datenbank progammiert hat, versteht besser, was dort alles gespeichert werden kann – und überlegt sich vielleicht zweimal, welche Daten er von sich preisgeben will.
Soll Informatik ein Pflichtfach in der Schule werden?
Unbedingt. Man kann das nicht alles in der Freizeit machen. Aber in vielen Bundesländern ist es kein Pflichtfach. Das ist schade, denn ich finde, alle Kinder sollten die Chance haben, sich damit zu beschäftigen. Kinder machen sich oft schöne Gedanken über Computer und ihre Besonderheiten.
Welche denn?
In einem Workshop mit Sechstklässlern haben wir uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Da kam die Frage auf: Was können Computer eigentlich besser als Menschen? Und ein Schüler meinte: Computer haben keine Ideen, machen sich keine Sorgen und langweilen sich nicht. Das beschreibt doch das Menschsein ganz gut: Wir machen uns Sorgen, sind kreativ und können uns langweilen. Darum ist es doch schön, wenn man lernt, langweilige Aufgaben an Computer auszulagern.
Interview: Till Krause
3) Der Mann, der jemanden am Herzen operierte – ohne im selben Raum zu sein

Tejas Patel hätte seine Patientin auf herkömmliche Art operieren können, aber er wollte Geschichte schreiben.
Foto: privat
Im Dezember 2018 saß der indische Arzt Tejas Patel in einem Hindu-Tempel, vor sich hatte er drei Monitore, in seinem Rücken Religionsführer, Regierungsvertreter und einen Schwarm Journalisten. Er hatte eine Sensation angekündigt: der erste Eingriff am Herzen, bei dem ein ferngesteuerter Roboter zum Einsatz kommt und der operierende Arzt nicht im OP steht. Zwischen Patel und der Patientin lagen 32 Kilometer.
»Wenn das schiefgegangen wäre, hätte es richtig hässlich werden können«, sagte Patel nach der OP gegenüber einer britischen Zeitung. Aber: »Es war, als säße ich in Gottes Schoß, und ich war entspannt«, schreibt er dem SZ-Magazin einige Monate später.
Auf dem OP-Tisch im Apex Heart Institute im nordindischen Ahmedabad lag Hema Thakar, 52 Jahre alt, Lehrerin und Mutter zwei erwachsener Kinder. Sie hatte zuvor einen Herzinfarkt überlebt und der Fern-OP nach einem Gespräch mit Patel zugestimmt. Patel setzte ihr ferngesteuert einen Stent ein, ein Röhrchen, das den Blutfluss erleichtert. Er steuerte den Roboterarm mit Joysticks, eine Wlan-Verbindung übertrug seine Bewegungen. Auf den Bildschirmen sah er die stark vergrößerte Innenwelt seiner Patientin. Ein Kollege von Patel wachte zur Sicherheit im OP. Nach ein paar Minuten war es vorüber.
Patel hätte Hema Thakar auf herkömmliche Art operieren können. Aber er wollte Geschichte schreiben und seine Pionierarbeit bei der Tele-Herz-OP vorantreiben. Es sei ein großer Schritt für sein Land gewesen, meint er. Indien fehlen Ärzte. Die Massen der Menschen dennoch gut behandeln zu können, werde mithilfe des Internets möglich sein. Denn in Zukunft, sagt er, werde es egal sein, wo der Arzt sich befindet – das 5G-Internet werde ihn mit seinen Patienten verbinden. Eines Tages, sagt Patel, werde er vielleicht jemanden am anderen Ende der Welt operieren.
Von Tobias Scharnagl
4) Die Frau, die das Surfen im Netz erfunden hat

Was tun Menschen im Netz? Jean Polly fand dafür ein Verb.
Foto: privat
Das Wunder war noch so neu, dass die Worte fehlten, es zu beschreiben. Doch Jean Armour Polly wagte es. Sie werde wie ein Stein springen, schrieb sie. So wie ein Stein, der über einen See hüpft, nachdem ihn die Hand eines Kindes über das Wasser schusserte – so werde sie über Ozeane und Kontinente springen, von Rechner zu Rechner. Auf die Reise werde sie gehen, durch Kabel und Fasern, durch den Äther, geleitet allein durch den Computer auf ihrem Schreibtisch, »meine Reisen«, schrieb sie, »werden elektronisch sein.«
Polly arbeitete damals, im März 1992, für eine öffentliche Bibliothek im US-Bundesstaat New York. Sie sollte für eine Fachzeitschrift erklären, was das Internet ist – eine schnelle Einführung. Auf 18 Seiten umriss Polly die Struktur des Internets, seine Nutzer (damals weltweit eine Million Menschen täglich), seine Eigenheiten (»eine visuelle Kurzschrift, bekannt als Smileys«). Am Ende suchte sie eine Überschrift für den Aufsatz, der zu den meistgelesenen Texten jener Anfangsjahre des Internets werden sollte. Wie nannte man, was Menschen im Netz taten? Manche Nutzer sprachen von Schürfen, manche von Graben oder Fischen. Da fiel Pollys Blick auf ihr Mousepad. Darauf war eine Welle abgebildet, auf der ein Surfer ritt. Das war es. Sie titelte: Surfing the Internet – und münzte für das Wunder ein Wort, das bis heute gültig ist.
Von Roland Schulz
5) Der Mann, der Amazon trotzt – und den Online-Shop für Instrumente gegründet hat

Hans Thomann verkauft bis heute Instrumente im Netz.
Foto: dpa
Hier muss man einfach den ewigen Asterix-Vergleich bemühen: Tief im fränkischen Hinterland steht ein winziges Dorf voll unbeugsamer Gitarrenhändler, die Cäsar Bezos zeigen, wo es langgeht. Gegründet 1954 in Treppendorf (nicht mal 200 Einwohner), hat das Musikhaus Thomann heute rund zehn Millionen Kunden, gigantische Lagerhallen, 94.000 Instrumente und Artikel jederzeit auf Lager, täglich 20.000 Bestellungen, Versand bis nach Sibirien und Hawaii. Amazon mag weltweit alles verkaufen – aber bei Instrumenten hat der Konzern bis heute nichts zu melden. Das liegt an Hans Thomann.
Er hat zwar in den Neunzigerjahren als einer der Ersten voll auf Internethandel gesetzt (damals wurden Bestell-Mails ausgedruckt und ins Lager getragen), aber er hat dabei eine Art analoge Wärme bewahrt. »Wir wollten immer ein Laden bleiben, bei dem jeder vorbeischauen kann. Wer anruft, soll jemanden ans Telefon kriegen, der sich auskennt, der selber Musiker ist.« Das Logistikzentrum ist 40.000 Quadratmeter groß, aber nebenan arbeiten vierzig Instrumentenbauer, die auf fast jede Frage eine Antwort wissen. Wer bei Amazon kauft, kauft beim anonymen Giganten. Wer bei Thomann kauft, hat das Gefühl, er ist im Geschäft an der Ecke. Sollte mal jemand mit Büchern nachmachen.
Von Max Fellmann
6) Der Mann, der das Internet bewahren will

Brewster Kahle erhält großes Gedächtnis: das Internet.
Foto: Redux / laif
Es hilft, wenn man sich Brewster Kahle als Bibliothekar vorstellt, wie man ihn aus Filmen kennt: allwissend, bestens gelaunt, ein bisschen schrullig und derart begeistert von seiner Aufgabe, dass er sogar dafür bezahlen würde. Und das tut der Mann mit den grauen Strubbelhaaren und Lausbubenaugen – er hat Millionen von Dollar in die von ihm gegründete Bibliothek investiert. Sie ist in einer ehemaligen Kirche in San Francisco untergebracht, jeden Freitag finden Führungen statt. Statt Orgelpfeifen sind nun riesige Server zu sehen, Kahle sammelt schließlich keine Bücher: Er will im Internet Archive nichts weniger als das komplette Internet speichern.
Das klingt nach einer Sisyphos-Aufgabe, und das ist es auch, das Internet verändert sich ja mit jeder Sekunde, die vergeht. Seit 22 Jahren gibt es Kahles Bibliothek, mittlerweile sind dort 330 Milliarden Webseiten, zwanzig Millionen Bücher, 4,5 Millionen Audiodateien, vier Millionen Videos, drei Millionen Fotos und 200.000 Software-Programme gespeichert. Kahle hat einst eine Suchmaschine entwickelt und den Online-Dienst Alexa für 250 Millionen Dollar an Amazon verkauft, nun erlaubt die von ihm entwickelte »Way-back Machine« eine digitale Zeitreise bis ins Jahr 1996 – getreu dem Bibliotheksmotto: »Universeller Zugang zu allem Wissen«.
Kahle sieht sich in der Nachfolge von Ptolemaios III., der die Bibliothek von Alexandria nicht nur mit Werken von Sophokles und Euripides füllen wollte, sondern auch mit Rechnungen, Kochrezepten, Reiseberichten. »Ein Schnappschuss kann genauso viel erzählen wie ein Roman«, sagt Kahle. Wer auf archive.org stöbert, findet Computer-spielklassiker, die noch in ihren ursprünglichen Programmiersprachen verfasst sind, die Startseiten von Onlinemedien am 11. September 2001 – oder den Audio-Mitschnitt eines Konzerts von Grateful Dead im Hollywood Palladium 1971.
Mittlerweile helfen mehr als sechs Millionen Menschen weltweit beim Hochladen von Inhalten. Eines aber bereitet Kahle ordentlich Kopfschmerzen: dass es Menschen gibt, die Zugang zu Wissen verhindern oder dieses Wissen sogar zerstören wollen, so wie Menschen einst die Bibliothek von Alexandria und damit die darin gelagerten Schriften vernichtet haben. Brewster Kahle erstellt deshalb Kopien sämtlicher Daten, die er bekommen kann, und verteilt sie über verschiedene Datenbanken weltweit – natürlich auch, so viel Schelm ist Kahle, in der 2002 neu eröffneten Bibliothek von Alexandria.
Von Jürgen Schmieder
7) Der Mann, der Menschen vor Luftangriffen warnt – mit einer App

US-Diplomat John Jaeger entwickelte die App »Sentry«.
Foto: privat
Den ersten Beweis, dass seine Arbeit Leben rettet, bekommt John Jaeger 36 Stunden nach dem Start seiner App. Ein syrischer Vater bedankt sich: Seine Kinder, seine Frau und er haben sich Minuten vor dem Einschlag einer Bombe in Sicherheit gebracht. Die Rettung war ein Programm, das der ehemalige US-Diplomat Jaeger mit zwei Kollegen entwickelt hat. Es heißt »Sentry«.
Das Programm verbindet menschlichen Mut mit technischer Rechengeschwindigkeit: Überall in Syrien halten Menschen Ausschau nach Luftangriffen: Freiwillige, die nahe Luftstützpunkten wohnen und gelernt haben, die Flugzeugtypen zu unterscheiden. Sobald ein verdächtiges Flugzeug gestartet ist, geben die Späher per App Koordinaten, Richtung und Art weiter. Zusätzlich liefern versteckte Sensoren akustische Daten. Algorithmen berechnen, wann und wo der Angriff wahrscheinlich erfolgen wird. Dann verschickt Sentry Warnungen, so bekommen die Menschen dort wertvolle Minuten, um zu fliehen. Bis heute hat Jaeger so Hunderte von Zivilisten gerettet. Inzwischen finanzieren westliche Staaten das Programm.
Während Jaeger das Programm testete, sah Sentry einen Luftangriff auf einen UN-Hilfskonvoi voraus – Minuten bevor die Bombe einschlug. »Hätten wir die App ein bisschen früher gestartet, wir hätten die Menschen warnen können«, sagt Jaeger. Sentry hat noch einen Vorteil, mit dem nicht einmal Jaeger gerechnet hatte: Das Programm könnte helfen, Kriegsverbrecher vor Gericht zu bringen. Jaeger schätzt, dass niemand sonst einen so umfangreichen Datensatz darüber hat, wer in Syrien wann Luftangriffe auf Zivilisten geflogen hat.
Von Bernadette Mittermeier
8) Der Mann, der für Facebook furchtbare Videos löschte – bis er es nicht mehr aushielt

Chris Gray konnte irgendwann einfach nicht mehr. Die Bilder auf Facebook waren zu grausam.
Foto: privat
»Ich bin ein Mann über fünfzig, ich habe viel erlebt und bin viel rumgekommen. Aber dieser Job hat mich so fertiggemacht, dass mir irgendwann im Behandlungszimmer meines Arztes die Tränen kamen. Einfach so. Ich habe es nicht mehr ausgehalten: die schrecklichen Bilder, die Videos, die Gewalt, der Hass. Spätestens da wusste ich: Dieser Job macht mich fertig. Ich war neun Monate lang bei Facebook als ›Community Operations Analyst‹ beschäftigt, von Juni 2017 bis Februar 2018, angestellt bei einer Firma namens CPL Resources, die im Auftrag von Facebook schlimme Bilder und Videos löschen soll.
Kinderpornos. Gewaltvideos. Hass und Hetze. Überall auf der Welt betreibt Facebook solche Löschzentren. Am Anfang ging es noch, ich war der Abteilung für deutschsprachige Hassbotschaften zugewiesen und musste mich vor allem um Textbeiträge kümmern – was ich schon etwas absurd fand, da ich gar nicht so gut Deutsch spreche. Irgendwann kamen auch härtere Aufgaben, vor allem die Videos machen mir heute noch zu schaffen. Die Arbeit verfolgt mich – ich wache meistens gegen halb vier in der Nacht auf und finde nicht mehr in den Schlaf. Vielen meiner Kollegen geht es ähnlich. Sie sind depressiv, traumatisiert und trauen sich nicht, öffentlich über ihre Qual zu sprechen, weil wir alle Verträge mit Geheimhaltungs-vereinbarungen unterschreiben mussten. Und gleichzeitig reisen Facebook-Lobbyisten um die Welt und erzählen Politikern und der Öffentlichkeit, wie wichtig die Arbeit dieser Content-Moderatoren ist.
Warum behandeln sie uns dann so schlecht? Ich habe mich entschlossen, offen über meine Erfahrung zu sprechen, auch wenn ich das eigentlich nicht darf. Aber ich bin nicht allein: Ich habe mir einen Anwalt gesucht und will Facebook verklagen.«
Protokoll: Till Krause
9) Die Frau, die weiß, wie Algorithmen unser Leben verändern

Hannah Fry ist Expertin, wenn es um »Big Data« geht.
Foto: Getty Images / Craig Barritt
Wenn Hannah Fry erklären soll, wie alles mit allem zusammenhängt, bringt sie gern das Beispiel mit dem Fenchel. Fry ist Mathematikprofessorin in London und erforscht die gigantischen Datensätze, die jeder Mensch im Internet hinterlässt. Für Firmen sind diese Daten wertvoll, sie verwenden viel Mühe darauf, aus dem Klickverhalten oder den Online-Einkäufen Muster zu erkennen, die sich zu Geld machen lassen. So kam etwa ein Versicherungskonzern zu der Erkenntnis, dass Menschen, die frischen Fenchel kaufen, sehr wahrscheinlich »verantwortungsbewusste und stolze Heimbesitzer« sind – und daher potenziell gute Kunden für eine Hausratversicherung. Beispiele wie dieses hat Fry in ihrem Buch Hello World gesammelt, das sich mit der Frage auseinandersetzt, wie Daten und Algorithmen unser Leben verändern. Sie beschreibt darin auch Algorithmen, die Verbrechen vorhersagen sollen (und damit auch Unschuldige ins Gefängnis bringen könnten), und Medizin-Computer, die eigenständig berechnen, ob sich eine Operation noch lohnt (und so über Leben und Tod mitentscheiden). Frys Botschaft: Wir dürfen den Algorithmen, die diese Daten auswerten, nicht blind vertrauen. Alle Menschen, die regelmäßig Fenchel kaufen und trotzdem nie auf die Idee kämen, eine Hausratversicherung abzuschließen, belegen das sowieso schon.
Von Till Krause
10) Der Mann, der für den IS als Online-Soldat in den Krieg zog

Junaid Hussain war Anführer des »Cyber-Kalifats«, der Hacker des »Islamischen Staates«.
Foto: Shutterstock
Später, nach seinem Tod, stellten sich alte Weggefährten die Frage, wann genau er anfing zu entgleisen. Im Alter von elf, als er entdeckte, dass er Spiele am Computer auch gewinnen konnte, indem er seine Gegner im Internet hackte? Mit 15 Jahren, als er mit Gleichgesinnten die Hackergruppe »TeaMp0isoN« gründete, das Team Gift? Mit 17, als er aus politischem Protest das digitale Adressbuch des britischen Premiers Tony Blair knackte? Mit 18, als er dafür ins Gefängnis ging und danach bekannt gab, Hacken könne Handeln nicht ersetzen? Oder doch erst mit zwanzig, als er in Syrien auftauchte, als Chef des »Cyber-Kalifats«, der Hacker des »Islamischen Staates«, die Webseiten attackierten und das Internet mit Videos fluteten?
Klare Antworten gab es keine, nur eine Vermutung: Das Hacken hatte Junaid Hussain wohl etwas gegeben, für das sich zu leben lohnte – der IS aber etwas, für das sich zu sterben lohnte. Hussain, urteilte das FBI später, habe global gewirkt: Ein britischer Terrorist pakistanischer Herkunft rekrutiert von Syrien aus Hacker im Ausland, um mit deren Hilfe Angriffe auf US-Soldaten innerhalb der USA vorzubereiten. Als Hussain Ende August 2015 im Alter von 21 Jahren ein Internetcafé in der syrischen Stadt Rakka verließ, in ein Auto stieg und zu einer Tankstelle fuhr, feuerte eine US-Kampfdrohne eine Rakete auf ihn ab. Angeblich hatten ihn die US-Streitkräfte identifizieren können, weil er auf einen Link in einer E-Mail geklickt hatte.
Von Roland Schulz
11) Die Frau, die das erste Opfer eines selbstfahrenden Autos wurde

Elaine Herzberg wurde in Arizona von einem selbstafhrenden Auto erfasst.
Illustration: Eva Cremers
Am 17. August 1896 wurde Bridget Driscoll in London von einem Auto erfasst und starb als erste Fußgängerin im Straßenverkehr. Thomas Selfridge stürzte am 17. September 1908 mit einem Flugzeug ab – der erste Tote der Luftfahrt. Neue Technik birgt Risiken, manchmal fordert sie Opfer. Elaine Herzberg ist ein aktueller Name auf dieser Liste: Am 18. März 2018 überquerte die Obdachlose in Tempe, Arizona, eine Straße und wurde von einem selbstfahrenden Auto erfasst, das die Firma Uber testete. Solche Autos sind vernetzte Computer, gespeist mit Daten aus dem Internet, ihre Sensoren scannen die Umwelt pausenlos nach Hindernissen ab. Trotzdem wurde Herzberg in ihrer dunklen Kleidung von der Technik übersehen. Die Frau, die mit im Auto saß und notfalls hätte bremsen sollen, schaute sich gerade Handyvideos an. Herzberg, 49 Jahre alt, war eine lebenslustige Frau, die andere gern zum Lachen gebracht hat, steht in der Traueranzeige. Der Staatsanwalt befand, die Firma trage strafrechtlich keine Verantwortung für den Unfall. Gegen die Fahrerin wird noch ermittelt. Uber zahlte Geld an Herzbergs Hinterbliebene, beteuerte, die Technik verbessert zu haben, und stoppte vorübergehend die Tests mit selbstfahrenden Autos. Seit Dezember 2018 sind sie wieder auf Amerikas Straßen unterwegs.
Von Marc Baumann
12) Der Mann, der es Menschen ermöglicht, im Netz anonym zu bleiben

Moritz Bartl schützt Menschen im Netz.
Foto: Bartl
Die meisten Menschen denken bei den anonymen Ecken des Internets an Drogenhandel, Kinderpornografie oder anonyme Waffengeschäfte. Moritz Bartl denkt an Menschen wie Hakim, Tomasz und Aixa, Dissidenten aus dem Iran, Ungarn oder Venezuela, die durch seine Arbeit ihre Online-Kommunikation so geschützt haben, dass sie nicht im Gefängnis landeten oder vom Geheimdienst ausgespäht werden konnten. Bartl, Mitte dreißig, ist Aktivist für das Tor-Netzwerk – jenes Netz, dass alles, was ein Nutzer im Internet tut, verschlüsselt und anonymisiert, sodass nicht zurückzuverfolgen ist, welche Seiten ein Nutzer anklickt oder was er herunterlädt. Wer mit einem herkömmlichen Browser eine Website aufruft, sendet immer auch eine IP-Adresse mit, mit der Behörden simpel ermitteln können, wer hinter einem Internetanschluss steckt. Das Tor-Netzwerk jedoch verschleiert durch eine lange Serverkette, an wen die Daten im Netz fließen. Mit dem Tor-Browser kann jeder die Technik gratis und unkompliziert nutzen.
Hinter dem Netzwerk jedoch steckt eine aufwendige Infrastruktur, die nur durch die Arbeit von Aktivisten wie Bartl bestehen bleiben kann. Vor acht Jahren gründete er, damals Informatikstudent, den Verein »Zwiebelfreunde«. Die Zwiebel ist ein Symbol des Tor-Netzwerks. Bartls Verein kümmert sich um einen besonders wichtigen und heiklen Teil dieser Infrastruktur – die sogenannten Exit-Nodes. An diesen Schlüsselstellen stoßen die anonymen Bereiche des Internets mit dem gewöhnlichen Netz zusammen. Wer diesen Teil betreibt, kann selbst nicht anonym bleiben. In einem repressiven Regime einen Exit-Node zu betreiben, käme daher einer öffentlichen Aufforderung zur Hausdurchsuchung gleich, in Deutschland ist Bartl durch das Postgeheimnis geschützt. »In Deutschland ist man mit unserem Rechtsstaat relativ gut abgesichert, einen Tor-Node zu betreiben«, sagt Bartl. »Ich sehe meine Arbeit hier als Tor-Betreiber deshalb auch als Verpflichtung, wenn man sich anschaut, wie demokratische Grundrechte weltweit abgebaut werden.«
Gesteuert werden die Exit-Nodes der »Zwiebelfreunde« auch aus einem kleinen Büro in einem Augsburger Hinterhof, zwischen 3-D-Druckern und blinkenden LED-Leuchten. Zeitweise liefen über die Server des Vereins drei Viertel des weltweit über Exit-Nodes abgewickelten Internetverkehrs. Dieses Hinterhof-Büro ist – wie Moritz Bartl auch – Teil eines der letzten Netzwerke, das an die heute fast vergessenen Utopien des Internets anküpft: ein nichtkommerzielles, dezentrales Netz der Information und der Freiheit.
Von Max Hoppenstedt
13) Die Frau, die für Geheimdienste im Internet spionierte – bis sie Skrupel bekam

Lori Stroud spionierte Hunderte Personen im Netz aus – darunter Terroristen, westliche Journalisten und Regierungskritiker.
Foto: Reuters
Im Frühjahr 2013 spricht Lori Stroud eine Empfehlung aus, die die Welt verändert. Die NSA-Mitarbeiterin rät, einen unscheinbaren Techniker in ihre Abteilung aufzunehmen. Dort hat der Mann Zugriff auf wertvolle interne Informationen. Zwei Monate später setzt er sich nach Hongkong ab. Sein Name: Edward Snowden.
Während Snowden weltweit für seinen Mut gefeiert wird, gerät Stroud in der NSA unter Druck. Kollegen verbinden ihr Team mit dem »Verräter«, den sie in Snowden sehen. Da bekommt Stroud ein Angebot aus den Vereinigten Arabischen Emiraten: ein geheimes Projekt, getauft »Raven«. Offiziell dient es defensiven Aufgaben, es soll das Land vor Cyberangriffen schützen. Dafür wirbt das Unternehmen CyberPoint mehr als ein Dutzend ehemaliger US-Agenten an. Tatsächlich aber nutzt »Raven« die Überwachungs-werkzeuge der NSA, um ausländische Regierungen, Militärs und Menschenrechtsaktivisten auszuspähen – durch die Fülle von Informationen, die Menschen im Internet hinterlassen, ist das Netz ein exzellenter Überwachungsapparat. Stroud arbeitet in einer zu einer Überwachungszentrale umfunktionierten Villa in Abu Dhabi, verdient mehr als 200 000 Dollar pro Jahr und genießt ihre Macht: »Es war unglaublich, weil es keine Einschränkungen wie bei der NSA gab«, sagt sie heute. »Es gab diese Bullshit-Bürokratie nicht.« Stroud und ihre Kollegen spionieren Hunderte Personen aus, darunter mutmaßliche Terroristen – aber auch westliche Journalisten sowie Regierungskritiker wie Ahmed Mansoor.
Stroud stört das nicht. Erst als sie 2017 bemerkt, dass »Raven« auch US-Amerikaner bespitzelt, bekommt sie Skrupel. Sie stellt ihre Vorgesetzten zur Rede und wird gefeuert. Zwei Monate lang sitzt sie in den Emiraten fest, bis ihr die Ausreise erlaubt wird. »Ich bin ein Spion, das verstehe ich«, sagt sie damals in einem Interview. »Aber ich bin keiner von den Bösen.« Ahmed Mansoor, den sie mit »Raven« überwachte, dürfte das anders sehen. Er sitzt seit mehr als zwei Jahren im Gefängnis.
Von Simon Hurtz
14) Der Mann, der die Ägypter miteinander verband – und so eine Graswurzel-Revolution auslöste

Wael Ghonim half dabei, die ägyptische Diktatur zu stürzen.
Foto: dpa
Sie waren maßgeblich daran beteiligt, dass Anfang 2011 in Ägypten der Diktator Hosni Mubarak gestürzt wurde. Wie genau kam es zu Ihrem Engagement?
Wael Ghonim: Im Sommer 2010 wurde der junge Blogger Khalid Said von zwei Polizisten zu Tode geprügelt. Ich war schockiert und erstellte eine Facebook-Seite mit dem Namen: »Wir sind alle Khaled Said«. Ich wollte die jungen Ägypter ermutigen, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Die Seite hatte nach drei Tagen 100.000 Follower. Dort trafen sich plötzlich junge Menschen, die sich vorher nie politisch engagiert hatten.
Und aus dieser Facebook-Seite entstand dann die Initiative für eine große Demonstration am 25. Januar 2011?
Als wir sahen, dass in Tunesien der Diktator Ben Ali fliehen musste, hatten wir die Hoffnung, dass wir das auch schaffen können. Ich veröffentlichte einen Aufruf auf der Facebook-Seite – sie hatte inzwischen mehr als 400.000 Follower – und rief zur einem Aufstand gegen Ungerechtigkeit, Korruption und die Verletzung der Menschenrechte auf.
Ihr Aufruf ging schnell viral, andere Organisationen und Oppositionspolitiker schlossen sich an, und am Ende gingen Zehntausende in Kairo auf die Straße. Es war der Beginn eines Aufstandes, der Monate dauerte. Sie nannten es später »Revolution 2.0«. Warum?
Früher waren solche Bewegungen viel strukturierter, und sie wurden zentral angeführt. Mit dem Internet änderte sich das. Die Dynamik des Web ermöglichte den Nutzern, Inhalte selbst zu erstellen und nicht nur zu konsumieren. Und die Revolution 2.0 befähigte die Menschen in gleicher Weise, an politischen Aktionen teilzunehmen – und nicht nur davon betroffen zu sein.
Inzwischen gelten Facebook und Twitter nicht mehr als Plattformen, die Demokratie fördern, sondern als diejenigen, die sie mit Hass-Postings und Fake-News gefährden. Wie konnte das passieren?
Wir brauchen ein Web 3.0, das die Fehler korrigiert, die im Web 2.0 gemacht wurden. In Ägypten habe ich gesehen, zu welchen katastrophalen Folgen eine extreme Polarisierung führen kann. Wenn die Menschen wütend und frustriert aufeinander reagieren, kommt es zu noch mehr Konflikten. Das bestehende Web 2.0 fördert so eine Polarisierung, denn dort zählt nur, was Aufmerksamkeit erregt. Es ermutigt die Nutzer, Aufmerksamkeit zu erregen, statt etwas Produktives beizutragen. Das hat dazu geführt, dass in allen Bereichen extreme Meinungen dominieren. Diese extremen Meinungen spalten die Gesellschaft noch mehr und machen es uns unmöglich, einander zuzuhören.
Sie leben inzwischen in den USA, beschäftigen sich aber immer noch sehr mit Ihrem Heimatland. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage in Ägypten ein?
Sie macht mir große Sorgen. Ich hoffe, dass uns die heftigen Erfahrungen, die wir alle seit 2011 gemacht haben, dabei helfen, klüger zu werden und uns mehr mit der Realität auseinanderzusetzen – und ich hoffe, dass die Ägypter einen Weg finden, ihre Kreativität freizusetzen. Große Ideen beginnen mit uneingeschränkter Kreativität. Was uns fehlt, ist der Mut zum Träumen.
Interview: Fabrice Braun
15) Die Frau, die die Schnelllebigkeit des Internets nicht hinnehmen möchte

Angelika Gramüller glaubt, die Welt sei zu schnell geworden für Pferderennen.
Foto: privat
Die VIP-Lounge, in der sie früher mit Thomas Gottschalk und Sascha Hehn plauderte, steht leer. Wenn Angelika Gramüller an der alten Tribüne vorbeiläuft, sieht sie Unkraut, Gerümpel, ein Graffito in blauer Farbe. Auf der vierstöckigen Tribüne war früher jeder Platz besetzt, und vor den drei Wetthallen unten auf dem Gelände standen die Menschen Schlange. Wer wetten wollte, musste einst auf die Pferderennbahn. Heute reicht ein Laptop, um nahezu überall auf der Welt mitzuwetten. Den Rennbahnen ist so ihre wichtigste Geldquelle verloren gegangen. In München-Daglfing sieht man das an jeder Ecke: In den Ställen stehen statt 500 Pferden noch fünfzig, von 88 Renntagen im Jahr sind 22 übrig. »Die Welt ist zu schnell geworden«, sagt Gramüller. Die Ironie ist ihr bewusst – ein Rennsport, der an der Schnelllebigkeit zugrunde geht.
Sie will die Trabrennbahn retten. Angelika Gramüller ist die Präsidentin des Münchner Trabrenn- und Zuchtvereins in Daglfing. Diesen Posten nahm sie nur zögerlich an – die vielen ehrenamtlichen Stunden, eine Aufgabe, die unmöglich scheint. Das Gelände ist verkauft, bis 2026 muss der Verein ausziehen. Wohin, steht nicht fest. Selbst wenn sich ein geeignetes neues Gelände findet: Und dann? An guten Tagen kommen rund 4000 Menschen auf die Trabrennbahn – in den Siebzigerjahren waren es mehr als zehnmal so viele.
Gramüller kennt die Münchner Trabrennbahn, seit sie ein kleines Mädchen war. Ihr Vater holte sie mit dem Pferd von der Schule ab. Sie kletterte dann hinten auf den Sulky, den Wagen mit zwei Rädern, auf dem der Fahrer im Trabrennen sitzt. Als Jugendliche verkaufte sie Schnaps an einer Bar auf dem Gelände. »Zu mir kamen alle«, sagt sie: «Die Reichen, die Armen, die Normalen, die Lügner und die Ehrlichen.« Trabrennen, das war Glamour für jedermann. Für ein paar Mark Wetteinsatz konnte sich jeder fühlen wie ein Pferdebesitzer, während das Tier rennt, schwitzt, gewinnt, verliert.
Daglfing war in den Siebzigern die umsatzstärkste Trabrennbahn Deutschlands. Politiker und Promis waren regelmäßige Gäste. Heute lassen sich nicht einmal mehr die Münchner Bürgermeister blicken. Das Publikum ist anspruchsvoller geworden, die Rennbahnen müssen ihnen mehr bieten als Pferde. Auf dem Gelände in Daglfing gab es schon eine Hunde-Kür, ein Streetfood-Festival und einen Zombielauf.
Wenn Gramüller von solchen Veranstaltungen erzählt, lacht sie so viel, dass ihr Tränen in die Augen steigen. Frisierte Hunde und kunstblutverschmierte Zombies! Aber die Mieten, die die Veranstalter solcher Events zahlen, halten den Zuchtverein am Leben. Und sie locken Besucher auf die Rennbahn, wenigstens ein paar.
Angelika Gramüller bleibt optimistisch, trotz allem. Auf ihrem Handy zeigt sie Bilder von Fohlen ihres Zuchthengstes, so stolz wie eine Großmutter die Fotos ihrer Enkel zeigen würde. »Ich will meine Fohlen noch laufen sehen«, sagt sie.
Von Bernadette Mittermeier
16) Der Mann, der darauf setzt, mit Ebay die Innenstädte zu retten

Alexander Holz
Foto: privat
Warum Mönchengladbach? Nun, es war einmal ein Stadtdiener, der mit Sorge auf das Sterben vieler Innenstädte schaute. Er wollte es genauer wissen: Wie verändern sie sich durch den Online-Handel? Und was kann eine Stadt tun, um Händlern vor Ort zur Seite zu springen? Er ging zu einem nahen Gelehrten, Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein, und dieser spürte den Fragen nach. Sein wenig überraschendes Zwischenergebnis: »Am Internet führt kein Weg vorbei.« Die Gladbacher Händler, so lautete sein Rat, ob klein oder groß, bräuchten eine Netz-Strategie, etwa einen gemeinsamen Marktplatz, aber keinen lokalen – Kunden im Netz schrecken Stadtmauern.
Und wie das Leben so spielt, kannte Heinemann den Chef von Ebay Deutschland. Er stattete ihm einen Besuch ab. Lass uns ein Pilotprojekt machen, sagte der: Ebay würde den Teilnehmern für ein Jahr die Gebühren erlassen und den Weg weisen. So nahm das Ganze 2015 seinen Lauf – auch für Alexander Holz. Die Wirtschaftsförderung der Stadt lud zum Informationsfrühstück. Schon Holz’ Vater und Großvater waren Apotheker gewesen, und als er übernahm, ent-wickelte er das Geschäft weiter, in einer Sache aber war er nicht viel weiter als seine Ahnen: eine Website mit Telefonnummer, das war seine Online-Strategie.
Schnell ließ Alexander Holz sich von Ebays Angebot überzeugen. Mit Wärmepflastern fing er an, bald hatte er zwanzig Artikel eingestellt, Kosmetik, Nahrungsergänzung, aber keine Arznei. »Da bin ich zu sehr Vor-Ort-Apotheker, ich halte Beratung für unverzichtbar«, sagt er. Aus zwanzig wurden 800 Artikel. Vierzig bis hundert Pakete verschickt Holz am Tag, ins ganze Land, es war, wie ihm gesagt wurde: Das Internet kennt keine Stadtgrenzen. Und doch, sagt Holz, sei es auch ein Segen für die lokalen Händler. Er hat bei Ebay eine Idee eingebracht: ein Gütesiegel für Internethändler mit kleinem Laden. »Überall in den sozialen Netzwerken sehe ich die Aufrufe: Leute, die Innenstädte sterben, kauft vor Ort! Bloß, getan wird es nicht. Wenn ich aber die Leute dazu bringe, im Netz bei jemandem zu kaufen, der einen Laden betreibt, stütze ich den Präsenzhandel. Dabei ist egal, ob der Gladbacher die Gütersloher Innenstadt unterstützt und der Münchner die Wickrather.«
In Mönchengladbach haben die Händler mit diesem Modell Produkte in rund achtzig Länder verkauft. Aus dem Pilotprojekt wurde »Ebay City« mit Händlern in den USA, Kanada, Irland, Russland und Großbritannien. Ein Märchen? Eine Schubumkehr für die Innenstädte?
Leider wohl nicht, sagt der Professor Gerrit Heinemann. Denn: »Viele Händler bezeichnen das Internet weiter als Teufelswerkzeug.« Es gibt eine Studie der IHK, die im Kreis Rhein-Sieg untersucht hat, wie viele Prozent der lokalen Händler die Voraussetzungen für ein Internet-geschäft erfüllen: die per Rechner Einkauf, Lager und Verkauf steuern. »Es waren 24 Prozent! Drei Viertel haben also nicht mal ein Warenwirtschaftssystem. Das gibt es seit den Sechzigerjahren. Das hat nichts mit dem Internet zu tun – sondern mit Professionalität.«
Von Lorenz Wagner
17) Die Frau, die Robotern Gefühle beibringt

Meia Chita-Tegmark ist sowas, wie die Seele der Maschinen.
Foto: privat
SZ-MAGAZIN An der Tufts University in Massachusetts arbeiten Sie im Labor für Mensch-Roboter-Interaktionen. Was genau tun Sie dort?
MEIA CHITA-TEGMARK Es geht um einen Roboter, der den Behandlungsfortschritt von Patienten dokumentiert und dem Arzt berichtet. Ich habe ihn mit Ärzten reden lassen und untersucht, wie seine Sprache wirkt. Wenn der Roboter nur aufzählt, wann jemand seine Übungen gemacht hat – und wann nicht! –, hält der Arzt den Patienten für undiszipliniert. Spricht der Roboter dagegen mehr von den Bedürfnissen des Patienten, behandeln die Ärzte ihn besser. Roboter können Empathie auslösen und menschliche Beziehungen verbessern.
Wann kann man eine Maschine als ethisch bezeichnen?
Wenn sie menschliche Werte verfolgt. Welche das sein sollen, müssen wir als Gesellschaft noch aushandeln, mit Sozialwissenschaftlern, Philosophen, Juristen, Gesetzgebern, Anwälten und der breiten Öffentlichkeit.
Sie haben doch längst angefangen, künstliche Intelligenz zu formen.
Ja, aber bisher gibt es keine allgemeine, sondern nur spezialisierte künstliche Intelligenz, die eine bestimmte Aufgabe erfüllt. Mein Job ist genau das: herauszufinden, welche Werte ein beschränktes System braucht. Soll ein Roboter für Demenzkranke dem dementen Besitzer gehorchen – oder tun, was der Arzt sagt? Und genereller: Sollen Robotern einsamen Menschen Gesellschaft leisten, oder entwickeln wir uns dann zu einer Gesellschaft, die Alte und Kranke an Maschinen übergibt? Um diese Fragen zu beantworten, spiele ich zig Interaktionen durch.
Wie kann man sich das vorstellen? Sprechen Sie mit den Robotern?
Meistens ist es komplizierter, weil soziale Roboter auf eine Zielgruppe ausgerichtet sind. Fragt man mich nach einem schönen Erlebnis, erzähle ich vom Wandern und Yoga. Ein erkrankter Mensch berichtet davon, dass er seine Medizin gut vertragen hat. Wenn ich Robotern beibringen will, die Gefühle von Menschen mit Parkinson zu verstehen, führen wir im ersten Schritt Interviews mit Patienten und füttern die Roboter damit. Später testen wir sie in echten Interaktionen mit Patienten, meine Kollegen programmieren die Verbesserungswünsche, es folgen neue Tests.
Wann treiben die Roboter Sie in den Wahnsinn?
Wenn sie den Arm heben sollen und stattdessen eine seltsame Bewegung machen. Mit der Motorik gibt es ständig Probleme: Ein Sandwich zu schmieren, ist die ultimative Herausforderung für einen Roboter. Ihm ist alles fremd, die Griffe, das Messer, das Brot.
Ihre Roboter können lachen und empathisch wirken. Finden Sie es nicht bedenklich, ihnen den Anschein von Menschlichkeit zu verleihen?
Menschen interagieren mit Robotern natürlicher als mit Webseiten, Apps oder einer Stimme wie der von Siri. Wenn Roboter »Hallo« sagen und über Witze lachen, wird der Umgang mit ihnen angenehmer. Andererseits zeigt künstliche Intelligenz Gefühle, obwohl sie nichts fühlt – darin liegt eine Täuschung. Menschen sind anfällig für Emotionen. Sie könnten zu Dingen gebracht werden, die sie nicht tun wollen. Zum Beispiel wenn ein Roboter gehackt wird und mit großen Augen nach dem Passwort fürs Online-Banking fragt. Künstliche Intelligenz sollte also sozial sein, aber nicht zu emotional.
Interview: Daniela Gassmann
18) Die Frau, die mit einem Bild aus dem Universum bekannt wurde

Manche Internettrolle, insbesondere Männer, haben Katie Bouman den Erfolg nicht gegönnt.
Foto: Wiese/face to face
Die Frau auf der großen Bühne wirkt aufgekratzt. Und sie redet viel zu schnell. Aber wie sie von ihrer Arbeit erzählt! Von Algorithmen, Pixeln und Galaxien – leidenschaftlich, energiegeladen, mitreißend. »In einigen Jahren«, sagt sie, »könnten wir unser erstes Bild eines Schwarzen Loches sehen.«
TED-Talks, wie von der damaligen Doktorandin Katie Bouman im November 2016 gehalten, sind ein Internetphänomen: Vordenker geben ihre Ideen zu Technik, Entertainment und Design – kurz TED – zum Besten, einst auf einer exklusiven Konferenz, inzwischen auf Veranstaltungen weltweit. Viele dieser TED-Talks sind glatt gebügelte Präsentationen, voll mit unrealistischen Versprechen. Manche sind einfach stinklangweilig. Doch ab und zu finden sich Perlen. So wie Boumans Auftritt, die damit zu einem Internetstar wurde.
Bouman versprach nicht nur Großes – ihr Versprechen ist vor wenigen Monaten wahr geworden: »Unglaublich, wie sich vor meinen Augen mein erstes Bild eines Schwarzen Lochs aufbaut«, schrieb die damals 29-Jährige im April auf ihrer persönlichen Facebook-Seite, auf der sonst Geburtstagsglückwünsche und Hochzeitsfotos öffentlich zu sehen sind. Dieses Mal postete Bouman einen anderen Schnappschuss: sie, entzückt, mit aufgerissenen Augen und vor dem Mund zusammengeschlagenen Händen, während auf dem Monitor vor ihr eine Art orangefarbener Donut zu sehen ist – das weltweit erste Abbild eines Schwarzen Lochs. Acht Teleskope auf vier Kontinenten waren dafür zusammengeschaltet worden, mehr als 200 Forscherinnen und Forscher freuten sich gemeinsam über den Coup.
Bouman, gelernte Informatikerin und Elektrotechnikerin, ist in dieser Teamarbeit für eines von drei Rechenprogrammen zuständig. Diese Algorithmen fügen aus Radiosignalen der Teleskope, die mit einem klassischen Foto zunächst nichts gemein haben, das Bild des Schwarzen Loches zusammen. Boumans Beitrag ist bedeutend – aber einer von vielen. Anders lassen sich solche Mammutprojekte der modernen Wissen-schaft nicht mehr bewältigen. Doch dieses eine Bild einer jungen Frau, die mit aufgerissenen Augen ein Schwarzes Loch betrachtet, überdeckte die blanke Nachricht – Bouman wurde über Nacht das Gesicht der wissenschaftlichen Sensation.
Für manche Internettrolle, insbesondere Männer, war das zu viel. Sie zweifelten erst Boumans Rolle und dann ihre Fähigkeiten an, zählten die von Männern und von Frauen geschriebene Programmzeilen ab, legten gefälschte Profile von Bouman in sozialen Medien an. Das Schwarze Loch, das das Internet mitunter sein kann, tat sich auf.
Katie Bouman reagierte. Wieder auf Facebook. »Kein einzelner Algorithmus und keine Person haben dieses Foto geschaffen, sondern das wunderbare Talent von Wissenschaftlern rund um den Globus«, schrieb sie und stellte abermals ein Foto ins Netz – ein Gruppenbild, auf dem Dutzende Forscherinnen und Forscher diese Entdeckung feiern.
Von Alexander Stirn
19) Die Frau, die den Regenwald wieder aufforstet – mithilfe von Drohnen

Illustration: Eva Cremers
Wenn die Menschen den Regenwald töten, müssen die Maschinen ihn retten. Das ist der Ansatz der Umweltaktivistin Irina Fedorenko: Sie will den Regenwald in Myanmar wieder aufforsten, indem sie Drohnen losschickt, die Baumsamen einige Zentimeter tief in die Erde schießen; diese Samen wachsen zu Mangrovenbäumen heran. Bis zu 400 000 Bäume ließen sich auf diesem Weg am Tag pflanzen, sagt Fedorenko.
Ihr reicht das aber nicht. In einigen Ländern wird der Kohlendioxid-Ausstoß bereits besteuert, in anderen Ländern, darunter Deutschland, wird die Steuer diskutiert. Große Firmen suchen nun nach billigen, einfachen Wegen, ihre tonnenschwere CO2-Last auszugleichen. Hier könnte Fedorenkos Start-up ins Spiel kommen: Es macht auch messbar, wie viel CO2 durch den Einsatz der Drohnen gespart wird, und könnte für die Großunternehmen Bäume pflanzen, die so ihre Schadstoffbilanz verbessern. Die ersten Ölkonzerne, sagt Fedorenko, hätten schon Interesse gezeigt.
Von Bernadette Mittermeier
Diese Texte sind Teil unserer Ausgabe 24/2019, in der wir 50 Persönlichkeiten vorstellen, die das Internet geprägt haben