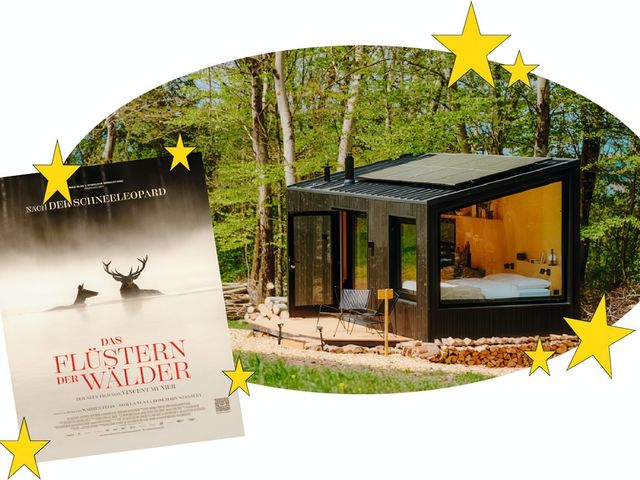Michaela Vaitl mit Simon im Garten.
Das Kind muss weg. Es muss verschwinden. Als wäre es nie herangewachsen in ihrem Bauch. Sie ist hochschwanger, und keiner weiß es. Genau genommen wusste sie es bis gerade eben selbst nicht, sie hat verdrängt, dass sie ein Kind bekommen wird. Vor ein paar Stunden erst kam Michaela Vaitl, 23, an diesem Samstag von der Arbeit als Kellnerin in einer Diskothek zurück, um 4.30 Uhr in der Früh, hat sich erschöpft ins Bett fallen lassen, und alles war wie immer. Sie hat bis Mittag geschlafen. Jetzt sieht sie Blut und Schleim in ihrem Urin und ahnt, dass es bald so weit sein wird. Da wird ein Kind sein.
Sie sitzt auf dem Klo ihrer Wohnung im niederbayerischen Weiler Wildtier – eine Handvoll Häuser und ein Steinbruch – und heult gegen die Angst an und die Panik. Das Kind muss fort, und keiner darf davon wissen, sonst sorgt ihr Ex-Freund Roman* dafür, dass er das alleinige Sorgerecht bekommt für die beiden Mädchen, Michelle, 8, und Gracia, 3: Er hat geschworen, dass er ihr die Kinder nimmt, wenn sie sich noch einmal von einem anderen schwängern lässt, schon Gracia ist ja nicht von ihm. Und Michaela Vaitl nimmt seine Drohungen ernst, seit er sie ein Jahr zuvor – da waren sie längst kein Paar mehr – durch das ganze Dorf geprügelt hat, aus alter, gegorener Eifersucht, ohne Anlass, dafür aber so brutal, dass ihre Schwester sie im Krankenhaus fast nicht erkannt hätte, zugeschwollen, wie sie war, und mit den kahlen Stellen am Schädel, wo er ihr so viele Haarbüschel auf einmal ausgerissen hatte, wie in eine Männerfaust passen. Geholfen hat ihr niemand damals, die Vorhänge haben sie zugezogen, die Nachbarn, als Roman, schwere Statur, lange braune Haare, immer und immer wieder auf sie einschlug, in seinem dumpfen Nebel aus Wut und Bier. Michaela weiß, was manche im Dorf über sie denken: dass sie asozial sei und dass ihr damals vielleicht ganz recht geschehen sei. Aber wenn andere sie asozial nennen, hört sie weg, macht zu, wie sie es gelernt hat in ihrem Leben, das kompliziert genug war: Mit 13 zieht sie bei ihrer Mutter aus, die sie und ihre zwei Geschwister abwechselnd grob misshandelt und ignoriert, und wohnt von da an bei der Mutter ihres Freundes Roman. Mit 15 bekommt sie von ihm, der mehr Bruder ist als Geliebter, die erste Tochter, Michelle. Mit 19 verliebt Michaela sich in einen anderen und verlässt Roman, der bis ins Innerste gekränkt zurückbleibt. Ihr neuer Freund wird Gracias Vater, aber bald macht Michaela Schluss, weil er gleich mehrere andere Frauen hat.
Und jetzt sitzt Michaela da und ist wieder schwanger, von einem 39-jährigen Lkw- Fahrer, den sie auf einem Motorradtreffen kennengelernt hat und – wenn es hoch kommt – zweimal die Woche sieht. Sie ist wieder schwanger, und in ihrem Kopf ist nur Platz für den einen Gedanken: Das Kind muss weg. Sie wird ihre Töchter nicht hergeben, sie sind alles, was sie hat.
Michaela glaubt ihrem Ex-Freund, wenn er sagt, er habe das Jugendamt in der Tasche: Sie hat nicht einmal eine Ausbildung, er ist Mechaniker bei BMW, er hat ein Haus und eine Mutter, die sich um die Kinder kümmern kann, eine Mutter, bei der Michelle und Gracia oft übernachten, auch jetzt gerade übers Wochenende, es sind Ferien.
(Lesen Sie auf der nächsten Seite: Manchmal fürchtet sie, die Nachbarn oder ihre Cousine hätten ihren Bauch bemerkt. Aber niemand sagt etwas.)

Auf dem Moped setzen die Wehen ein.
Als Michaela die Toilette verlässt, hat sie die Anzeichen der bevorstehenden Geburt weggespült. Wie konnte sie überhaupt schwanger werden? Nach Gracias Geburt hatte ihr Frauenarzt doch gesagt, damit werde es nichts mehr! Als dann die Periode ausbleibt, als sie zunimmt und zunimmt, sagt sie sich immer wieder: Es kann nicht sein. Sie redet mit niemandem darüber. Sie macht keinen Schwangerschaftstest, sie geht nicht zum Arzt. Sie hat Angst vor Roman, sie darf nicht schwanger sein, sie ist einfach nicht schwanger.
Monatelang versteckt sie die Schwangerschaft auch vor allen anderen. Ganz schlank war sie nie, nun werden die T-Shirts, Pullover, Hosen und Röcke eben weiter, das fällt erst nicht auf, dann, irgendwann, eigentlich schon. Manchmal fürchtet sie, die Nachbarn oder ihre Cousine hätten ihren Bauch bemerkt. Oft denkt sie, die Arbeitskollegen in der Disko müssten es doch sehen. Aber niemand sagt etwas. Nur einmal muss Michaela Vaitl lügen: Als sie wieder über und über mit Sommersprossen gesprenkelt ist – wie bei den beiden Schwangerschaften zuvor –, fragt ihre Schwester Annette: „Bist wieder schwanger?“ – „Nein“, sagt Michaela, „und hör mit dem Schmarrn auf!“
Den Vater des ungeborenen Kindes hält Michaela auf Abstand. Sie führen eine eher lose Beziehung, und seit der Bauch richtig wächst, ruft sie ihn nicht mehr an. Sie mag ihn zwar, wirklich, aber ihr Vertrauen in Männer ist beschränkt.
Weinend lässt Michaela sich auf die Couch im Wohnzimmer fallen. Sie hat im Fernsehen die Berichte über tote Babys in Tiefkühltruhen und Blumenkästen gesehen. Babys, deren Mütter die Schwangerschaft bis zum Schluss verdrängt und versteckt hatten. Mütter, die dann, als das Kind kam, in Panik ein Kissen nahmen oder eine Schnur, damit es ein Ende hat. Und immer wollte danach niemand etwas bemerkt haben.
Tote Babys, wer hält das denn aus?, denkt Michaela Vaitl und heult weiter. Es wird Nachmittag. Sie schwitzt – nicht nur aus Angst, auch weil es heiß ist, ist ja Ende August. Irgendwann hat sie eine Idee: Sie wird ein Krankenhaus anrufen und sagen, eine Freundin sei hochschwanger, darf das Kind aber nicht bekommen. Vom Mobiltelefon aus will sie nicht anrufen, die Nummer könnte man zurückverfolgen. Also fährt sie mit ihrem Mofa – sie hat kein Auto – drei Minuten ins nächste Dorf, nach Patersdorf, wo eine Telefonzelle steht. Die Anrufe in den Krankenhäusern Viechtach und Zwiesel bringen nichts, man sagt ihr, die Freundin solle zum Arzt gehen, und zwar schleunigst.
Im Deggendorfer Krankenhaus bekommt Michaela die Hebamme Bärbel Vollkommer ans Telefon. Die sagt, es gebe da vielleicht eine Möglichkeit: eine anonyme Geburt. Da könne ihre Freundin nach der Entbindung nach Hause gehen, als wäre nichts gewesen, und das Kind im Krankenhaus lassen. Die Hebamme sagt, die Freundin solle am Montag, also übermorgen, bei der Beratungsstelle Donum Vitae in Deggendorf anrufen, die würden sich um alles Weitere kümmern. „Aber wenn es pressiert?“, fragt Michaela. In der Leitung ist kurz Stille. „Sie sind selbst schwanger, oder? In welchem Monat sind Sie denn?“, fragt die Hebamme. „Weiß ich nicht, aber ich glaub, es dauert nicht mehr lang“, sagt Michaela. „Kommen Sie einfach, wenn es so weit ist, und fragen Sie nach mir, das kriegen wir schon“, sagt die Hebamme. Michaela fängt vor Erleichterung schon wieder an zu weinen.
(Lesen Sie auf der nächsten Seite: Sie kann nicht den Krankenwagen holen oder jemanden anrufen, der sie hinbringt. Bleibt nur ihr Mofa.)

Michaela Vaitl in ihrer Wohnung in einem Dorf in Niederbayern.
Als sie gegen 16.30 Uhr zu Hause die Wohnungstür aufschließt, platzt die Fruchtblase. Jetzt muss es schnell gehen. Allerdings sind es bis Deggendorf 25 Kilometer, und sie hat ja kein Auto. Sie kann auch nicht den Krankenwagen holen oder jemanden anrufen, der sie hinbringt. Bleibt nur ihr Mofa, Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h. Sie packt einen Schlafanzug, ein T-Shirt, Unterwäsche und eine Zahnbürste in eine Umhängetasche und fährt los.
Schon nach ein paar Kilometern setzen die ersten Wehen ein. Michaela Vaitl ignoriert die Schmerzen und fährt weiter, immer weiter, auch wenn sie nicht gut sieht wegen der Tränen. Sie muss daran denken, wie es war, als sie das letzte Mal im Krankenhaus war: Eine Woche schoben die Schwestern sie im Rollstuhl herum, weil sie nicht gehen konnte; ohne Hilfe konnte sie nicht einmal vom Bett aufstehen, so hatte er zugeschlagen, er: Roman.
Kurz vor 18 Uhr an diesem Samstag kommt Michaela am Deggendorfer Krankenhaus an und verlangt nach der Hebamme Bärbel Vollkommer. „Ich hab vorher angerufen“, sagt sie. „Ist ja schnell gegangen“, sagt Vollkommer und lächelt. Auf dem Weg zur Frauenärztin, zur Kontrolle, fragt sie, wer alles von dem Kind weiß. „Niemand“, sagt Michaela. Die Hebamme glaubt ihr nicht, die Frau vor ihr ist sehr offensichtlich schwanger. „Und warum darf niemand von Ihrem Kind erfahren?“, fragt die Hebamme. „Mein Mann will kein drittes Kind“, lügt Michaela Vaitl, „sonst geht er und nimmt unsere zwei Töchter mit.“ – „Sie haben Angst vor ihm, oder? Schlägt er Sie?“, fragt Vollkommer. Michaela nickt.
Hebamme, Schwestern und Ärztin rätseln, was sie in die Akten eintragen sollen. Für fast alle ist es die erste anonyme Geburt, nicht nur für Michaela Vaitl. Irgendwann beschließen Hebamme und Ärztin, Michaela „Frau Unbekannt“ zu nennen.
Die Wehen werden stärker. Als Bärbel Vollkommer ihre Patientin in den Kreißsaal schiebt, bittet sie Michaela um ihren Ausweis, „für alle Fälle, bei einer Geburt kann viel sein“. Michaela zögert, sie will nicht. „Jetzt hören Sie mir mal zu“, sagt die Hebamme, „wenn Ihnen was passiert, müssen wir wissen, wie Sie heißen, allein schon wegen Ihrer Kinder.“ Das sieht Michaela dann doch ein. Sie einigen sich darauf, dass die Hebamme Michaelas Namen auf einen Zettel schreibt, den sie nach der Geburt zerreißen wird, wenn alles gut geht. Rechtlich ist das problematisch: Eigentlich müsste die Hebamme Michaela Vaitls Namen der Polizei melden, wenn sie ihn weiß.
(Lesen Sie auf der nächsten Seite: Um 20.14 Uhr entbindet Michaela als "Frau Unbekannt" ein Kind.)

Oft dachte Michaela: Irgendwer muss doch den Bauch bemerkt haben.
Um 20.14 Uhr entbindet Michaela als Frau Unbekannt ein Kind. Über ihren Knien liegt ein großes weißes Handtuch. Sie soll das Kind nicht sehen, sie soll auch nicht erfahren, ob es ein Junge oder Mädchen und ob es gesund ist. Je weniger man von einem Baby weiß, desto leichter gibt man es weg, heißt es.
Aber Michaela liegt im Kreißsaal und sieht, wie Hebamme und Schwestern das Kind anstarren, das sie geboren hat. „Ja leck“, sagt die Hebamme. Das Kind schreit nicht, eine Schwester wickelt es in Handtücher, bringt es weg. Ist was mit dem Kind?, denkt Michaela, hat es was? Dann kippt sie weg, sie hat viel Blut verloren.
Später, im Zimmer, fragt sie die Schwester, ob alles in Ordnung sei mit dem Kind. Die ist verwirrt: „Wollen Sie das wirklich wissen?“ – „Ja“, sagt Michaela, „bitte.“ Irgendwann gegen drei Uhr schaut die Schwester wieder ins Zimmer. Sie lacht. „Alles in Ordnung. Der Bub hat fast fünf Kilo“, sagt sie. „Ja leck“, sagt Michaela. „Wollen Sie ihm einen Namen geben?“, fragt die Schwester. Michaela überlegt. „Simon Felix gefällt mir“, sagt sie.
Am späten Sonntagnachmittag, keine 24 Stunden nachdem auf dem Mofa die ersten Wehen eingesetzt haben, fährt Michaela mit dem Mofa wieder Richtung Patersdorf. Ohne Kind.
Eigentlich wollten die Ärzte sie nicht gehen lassen, ihre Blutwerte waren noch zu schlecht, also ging sie auf eigenes Risiko, unterschrieb mit „Frau Unbekannt“. Es hilft ja nichts, sie muss nach Hause, Romans Mutter wird um 18 Uhr die Mädchen bringen, da muss alles sein wie immer.
Michaela Vaitl hat Augenringe, weil sie kaum geschlafen hat, sie hat verquollene Augen vom vielen Weinen, und sie ist sichtbar dünner geworden – über Nacht. Dass etwas mit ihr nicht stimmt, könnte augenscheinlicher nicht sein. Aber niemand spricht sie darauf an: nicht Romans Mutter, als sie am Abend Gracia und Michelle bringt, nicht die Nachbarn und nicht ihre ältere Schwester Annette, mit der sie am nächsten Tag, Montag, zum Kaffee verabredet ist.
Ihre Schwester schrickt zwar zusammen, als sie Michaela ohne Babybauch um die Hausecke biegen sieht, aber sie sagt nichts, schreibt stattdessen eine SMS an ihre Cousine: „Hilfe!! Die Ela ist da, und der Bauch ist weg! Komm vorbei!“ Bei Kaffee und Kuchen sitzen die drei Frauen dann zusammen, aber am Tisch spricht keiner das Offensichtliche an. Immer noch hoffen Schwester und Cousine, ihre Ela werde selbst damit anfangen. Dann sieht Annette einen blauen Fleck am Handrücken ihrer Schwester, denkt bei sich: Da war eine Kanüle drin, dann war die Ela im Krankenhaus, dann hat sie wenigstens nicht allein entbunden, und fragt laut: „Was hast denn da gemacht?“ – „Ach, nur angestoßen“, sagt Michaela.
(Lesen Sie auf der nächsten Seite: Sie wollte sich richtig verabschieden, und die Hebamme brachte ihr ihren Sohn. Als Michaela Simon küsste und ins Bettchen zurücklegte, fing sie an zu heulen.)

25 Kilometer bis zum Krankenhaus. Sie kann niemanden anrufen, es darf ja niemand wissen.
Dienstag. Michaela Vaitl hat die drei Nächte seit der Geburt kaum geschlafen. Aber sie muss funktionieren. Dienstags holt Romans Mutter immer die Kinder, dienstags steht Michaelas Name immer im Schichtplan der Diskothek. Vielleicht kann sie danach wenigstens schlafen, denkt sie, als sie das Mofa vor der Diskothek abstellt. Den ganzen Abend merkt sie, dass die Kollegen auf ihren Bauch starren. Aber sie sagen nichts. Dafür setzt eine Kollegin per SMS das Gerücht in die Welt, die Ela habe ein Mädchen bekommen, ein Mäderl, und sie habe es weggetan. Einfach irgendwo ausgesetzt.
In Wirklichkeit hat Michaela ihren Sohn an diesem Tag sogar schon im Arm gehalten. Die Krankenschwestern waren nicht besonders überrascht, sie zu sehen: Bevor Michaela am Sonntag das Krankenhaus verlassen hatte, hatte sie um ein Polaroidfoto von Simon gebeten, zur Erinnerung. Dann wollte sie sich doch richtig verabschieden, und die Hebamme brachte ihr ihren Sohn. Als Michaela Simon küsste und ins Bettchen zurücklegte, fingen beide Frauen an zu heulen. An diesem Dienstag wollte sie ihn ein letztes Mal sehen. Vielleicht hat er es woanders besser, sagte sie sich, als sie zum zweiten Mal weinend und ohne ihren Sohn das Krankenhaus verließ. Sie würde nicht riskieren, ihre Töchter zu verlieren.
In der Zwischenzeit fangen ihre Schwester und die Cousine an nachzuforschen, was passiert sein könnte. Erst jetzt mischen sie sich ein, wo sie wissen, dass es zu spät sein könnte, wo sie Angst haben, ihre Ela könnte etwas Schlimmes getan haben. Sie überlegen sogar, anonym bei der Polizei anzurufen – immerhin hatte die Ela einen dicken Bauch, und jetzt ist da kein Kind.Aber erst wollen sie wissen, was war, und setzen sich vor Annettes Computer, suchen nach „heimliche Schwangerschaft“ und stoßen auf die Möglichkeit einer „anonymen Geburt“. Sie finden heraus, dass das im Deggendorfer Krankenhaus geht, im Rahmen des „Moses Projekts“ von Donum Vitae. Annette ruft im Krankenhaus an – bekommt aber keine Auskunft. Sie überlegt. Dann ruft sie noch einmal an, verlangt diesmal die Hebamme, die am Wochenende Dienst hatte. Bärbel Vollkommer geht ans Telefon, will aber nichts sagen. Michaelas Schwester bettelt, die Hebamme bleibt dabei, sie darf nichts sagen. Außer vielleicht das: „Sprechen Sie mit Ihrer Schwester, ich kann mir vorstellen, dass die jemanden zum Reden braucht.“
Am Mittwoch, vier Tage nach Michaelas Entbindung, ist die Geburt so wenig anonym, wie eine Geburt nur sein kann. Die Welt ist eng in Niederbayern, Patersdorf hat keine 2000 Einwohner, jeder kennt jeden, und man trifft sich oft: beim Tanken, beim Einkaufen, beim Wirt; und wer eine Geschichte weiß wie diese, der erzählt sie auch. Selbst Schwester und Cousine erfahren so von dem Mädchen, das Michaela Vaitl angeblich ausgesetzt hat. Die Cousine schreibt ihr am Mittwochvormittag eine SMS: „Warum hast denn nix gesagt? Wir hätten dir doch alle geholfen!“ Ihre Schwester Annette schreibt: „Magst nicht doch vorbeikommen, zum Reden?“
(Lesen Sie auf der nächsten Seite: Michaela spürt, wie ihr die Kontrolle entgleitet, wie andere die Wahrheit erfahren oder verdrehen und wie der Druck immer größer wird.)

Der kleine Simon Felix. Vielleicht wird ihm seine Mutter eines Tages seine ungewöhnliche Geschichte erzählen.
Michaela spürt, wie ihr die Kontrolle entgleitet, wie andere die Wahrheit erfahren oder verdrehen und wie der Druck immer größer wird. Sie ruft ihre Betreuerin bei Donum Vitae an, mit der sie schon am Montag gesprochen hat, und sagt, dass sie ihrer Schwester alles erzählen wird. „Wenn Sie das tun, ist es keine anonyme Geburt mehr“, sagt die Betreuerin. „Macht nichts, ich mag den Simon sowieso bei mir haben.“ Ihr plötzlicher Mut überrascht sie selbst. Sie fährt zur Schwester.
Schon bevor sie sich umarmen, weinen beide. „Musst nix sagen, Ela“, flüstert die Schwester und drückt sie fest, „ich weiß schon von dem Mäderl, was du kriegt hast. Und dass du es weggetan hast.“ Michaela weint und lacht und schüttelt den Kopf. „Ein Bub ist es, und was für einer – fünf Kilo!“ Dann fahren die beiden ins Krankenhaus: Simon anschauen. „Verdammt noch mal, packen hätte ich dich sollen und zum Arzt fahren“, sagt die Schwester unterwegs. Und später, als sie den Jungen im Arm hält: „Wenn du ihn nicht nimmst, Ela, dann nehm ich ihn, das weißt schon.“
Auch Roman, der Ex-Freund, weiß inzwischen, was passiert ist. Er lässt seine Mutter anrufen und ausrichten, Michaela könne die Kinder gleich bei ihm lassen, sie sei sie jetzt eh los. Er behauptet, mit dem Jugendamt gesprochen zu haben und sie werde ihr Baby nie wiedersehen. Den restlichen Tag ist Michaela schlecht vor Angst. Er wird dafür sorgen, glaubt sie, dass sie ihre drei Kinder hergeben muss. „Der kann dir nichts“, sagt ihre Schwester, aber Michaela glaubt ihr nicht.
Trotzdem tut sie in den kommenden Tagen alles, um Simon offiziell zu ihrem Sohn zu machen. Im Jugendamt, im Standesamt, im Krankenhaus – überall unterschreibt sie mit ihrem wirklichen Namen, auf der Geburtsurkunde und auf allerhand Formularen. Aber sie darf Simon nicht mitnehmen. Im Jugendamt sagt man ihr, er komme vorerst in eine Pflegefamilie, man müsse doch prüfen, wie es um das Kindeswohl bestellt sei, wenn eine Mutter ihr Kind erst nicht will und plötzlich doch. Michaela glaubt, Roman habe das veranlasst, und denkt: Er wird durchkommen damit, so wie er auch damit durchgekommen ist, dass er sie zusammengeschlagen hat. Es hat damals nicht einmal eine Verhandlung gegeben.
Wochenende. Michaela kann immer noch nicht schlafen, seit der Geburt schon nicht, die jetzt eine ganze Woche her ist. Sie weint ständig, aus Angst, aus Erschöpfung, und sie kann ihren Töchtern nicht erklären, warum. Außerdem kann sie Simon nicht besuchen, weil das Jugendamt nicht weiß, welche Pflegefamilie ihn hat. Und dann muss Michaela noch Simons Vater sagen, dass er einen Sohn hat. Sie bestellt ihn per SMS zu sich. Als er auf der Couch sitzt, fragt er, ob sie einen anderen hat. Sie schüttelt den Kopf. „Bist schwanger?“, fragt er. „Nein“, sagt sie, „nicht mehr.“ – „Hast das Kind wegmachen lassen?“ „Nein“, sagt sie, „ich hab’s bekommen.“ Michaela rechnet damit, dass er aufsteht und geht. Aber er bleibt sitzen. Dann lacht er. „Also bin ich jetzt Papa. Oder wie?“ – „Ja“, sagt sie, „ja.“ Und wieder weint sie.
(Lesen Sie auf der nächsten Seite: Michaela Vaitls Töchter staunen über den plötzlichen Bruder.)

Montag, neun Tage nach der Geburt. Eine Frau vom Jugendamt kommt, sie kontrolliert, ob Michaela all das besitzt, was ein Kleinkind braucht. Und ist zufrieden: Seit Tagen haben Michaelas Schwester und Cousine herumtelefoniert und Berge von Kindersachen organisiert, es stehen sogar zwei Wiegen und drei Kinderwagen vor der Tür. „Morgen können Sie Ihren Sohn abholen“, sagt die Frau.
Dienstag, Tag zehn. Michaela Vaitls Töchter staunen über den plötzlichen Bruder. „Gut, dass wir das nicht schon gewusst haben“, sagt die dreijährige Gracia, „der ist so lieb, das hätten wir doch gar nicht ausgehalten, neun Monate auf den zu warten!“ Der Abend ist der erste gemeinsame Abend mit Kind für Michaela und ihren Freund. Trotzdem schläft sie auch in dieser Nacht schlecht, sie fürchtet sich vor dem nächsten Tag, da steht ein Termin an mit Roman, dem Ex-Freund, und einer Mitarbeiterin des Jugendamts: wegen der Mädchen.
Mittwoch. Das Treffen findet bei Romans Mutter statt. Sie bringt ihre Schwester Annette mit. Die Frau vom Jugendamt sagt, dass niemand ihr die Töchter wegnehmen kann. Nie habe es Zweifel daran gegeben, dass Michaela eine gute Mutter sei, und daran habe Simons Geburt nichts geändert. Sie sagt zu Roman, er solle sich um ein sinnvolles Miteinander bemühen. Und die Angst wird weniger bei Michaela.
Ein Jahr nach Simons Geburt lebt Michaela Vaitl mit ihren drei Kindern immer noch in derselben Wohnung – nur ist es dort enger geworden. Ihr Freund, Simons Vater, ist oft da, sie wollen sich bald eine gemeinsame Wohnung suchen. Das Geld ist knapp, aber seit Michaela Vaitl ihren Stolz überwunden und Arbeitslosengeld II beantragt hat, ist es besser. Roman kann ihr nichts mehr, denkt sie. Der Hebamme hat sie zu Weihnachten 2007 eine Dankeskarte geschickt mit einem Foto von Simon. Unterschrieben mit „Frau Unbekannt“.
*Name von der Redaktion geändert
Lesen Sie auf der nächsten Seite: Verdrängte Schwangerschaft und anonyme Geburt: Hilfe für Betroffene, rechtliche Lage sowie Pro und Kontra.

Verdrängte Schwangerschaft
Die Situation
Wenn eine Frau ihre Schwangerschaft verheimlicht oder verdrängt, sind fast immer familiäre Probleme die Ursache: der Ehemann, der keine Kinder mehr will und mit Trennung droht; der strenge Vater, der seiner minderjährigen Tochter nicht einmal erlauben würde, ihren Freund zu küssen. Aber auch illegal in Deutschland lebende Frauen sind betroffen, die sich aus Angst vor der Ausweisung oder Abschiebung nicht zum Arzt trauen. Eine dritte Gruppe sind drogenabhängige Frauen, die sich nicht in der Lage sehen, ein Kind zu bekommen.
Was Sie tun können: das Schweigen brechen
Die Erzählungen vieler Frauen, die ihre Schwangerschaft verheimlicht haben, ähneln sich in einem zentralen Punkt: Freunde, Verwandte oder Bekannte bemerken die Schwangerschaft, aber kaum jemand spricht die Frauen darauf an. Da die Betroffenen nicht von selbst reden, sind sie schließlich isoliert. Dies verschärft ihre Lage und endet schlimmsten- falls damit, dass die Mutter in Panik nach der Geburt das Kind tötet oder nicht ausreichend versorgt. Das Gefühl des Alleinseins, das Schweigen bereitet Infantiziden, also Morden an Säuglingen, erst den Weg. Allerdings steht am Ende immer nur die Mutter am Pranger, bei fast allen Babymorden reicht den Vätern der lapidare Satz: Ich habe nichts bemerkt.
Hilfe für Betroffene: Ansprechpartner
Organisationen wie der Hamburger Verein SterniPark (bundesweiter Notruf: 0800/456 07 89) oder die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle Donum Vitae (bayernweiter Notruf des „Moses Projekts“: 0800/006 67 37) sind gute Ansprechpartner in solchen Notlagen. Auch im Internet gibt es Menschen, die sich kümmern, vor allem das Forum der Internetseite www.anonyme-geburt.de.tl hilft mit fast allem, was man wissen kann oder sollte.
Die anonyme Geburt
Rechtliche Lage
Die anonyme Geburt ist in Deutschland per Gesetz verboten, alle 130 Krankenhäuser, die sie dennoch anbieten, tun dies über rechtlich bedenkliche Konstruktionen, die Ärzten, Hebammen und Krankenschwestern keine Rechtssicherheit bieten – ihnen drohen Geldstrafen und Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren. Theoretisch könnten auch Mütter belangt werden, die ihr Kind anonym zur Welt bringen. Doch werden kaum Beteiligte wirklich vor Gericht gestellt. Derzeit laufen verschiedene Initiativen zur Legalisierung der anonymen Geburt, u.a. beschäftigt sich auch das Familienministerium mit dieser Frage.
Pro anonyme Geburt
Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Frauen in Notsituationen wird ein Ausweg aufgezeigt. Gleichzeitig haben diese Frauen nach der Geburt meist acht Wochen Zeit, sich ihr Kind zurückzuholen – befreit von der Angst. Schätzungen zufolge taten dies auch 75 Prozent der Frauen, die in Deutschland anonym entbunden haben. Allerdings ist das Zahlenmaterial nicht besonders aussagekräftig, weil die Fallzahlen zu gering sind. Gegenüber der Babyklappe hat die anonyme Geburt den Vorteil, dass Mutter und Kind sich während und nach der Geburt unter ärztlicher Betreuung befinden. Dadurch wird die Geburt sicherer, und die Frauen müssen nicht nach einer Geburt allein im eigenen Badezimmer entscheiden, was mit dem Kind geschieht.
Kontra anonyme Geburt
Die Gegner der anonymen Geburt kritisieren generell, dass dieses Angebot nicht wirklich die Frauen anspreche, die andernfalls ihr Kind töten würden. Diese befänden sich in einem psychischen Ausnahmezustand und seien für Hilfsangebote einfach nicht erreichbar. Außerdem verweisen sie auf das gesetzlich verankerte Recht des Kindes auf seine Herkunft und auf die psychologischen Probleme, die Findelkinder später haben.
Problem
Weder eine lebensrettende Wirkung von anonymer Geburt oder Babyklappe kann statistisch belegt werden noch das Gegenteil. Auch weil die Fallzahlen relativ niedrig sind: 2006 kamen 673 000 Kinder in Deutschland zur Welt, im selben Jahr starben 40 Babys durch Tötung oder Aussetzung.
Fotos: Stephanie Füssenich und Urban Zintel