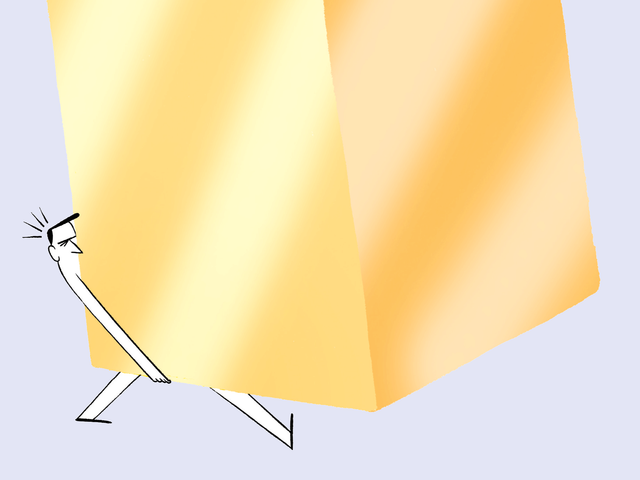Ich wusste natürlich, dass sich etwas verändert hatte, ich hatte ja so ungefähr neun Monate Zeit dafür gehabt oder wahlweise auch mein ganzes bisheriges Leben; aber wirklich verstanden hatte ich das erst, als ich mit sieben schweren Tüten voll Lebensmitteln vor meiner Haustür stand und nach dem Schlüssel suchte.
Ich öffnete die Tür – und war Vater. Das klingt jetzt etwas kitschig, ist aber so gemeint: Es war der Tag nach der Geburt meiner Tochter, und auf einmal konnte ich das Wort "Hamstertrieb" buchstabieren. Ich wusste ganz intuitiv, dass ich raus musste zum Supermarkt und acht Hühnerbrüste, einen Sack Zwiebeln, Karotten, zwölf Packungen Orangensaft, einen Kasten Milch und noch einiges mehr jagen musste. Die Biologie hatte mich eingeholt. Am Anfang war ich nicht so sicher, wie ich das finden sollte: Es fühlte sich gut und richtig an – aber lebte ich mein Leben, oder rutschte ich da schon ins Klischee? Und wenn ich ehrlich bin, stellt sich diese Frage immer noch und immer wieder neu, seit meine Tochter da ist und Haltungsfragen ganz anders diskutiert werden: So ein Puppenkinderwagen etwa – ist der nun süß, oder finde ich das nur in meiner Sentimentalität?
Das ist die Theorie. Die Praxis schaut so aus: Ich kann mich tatsächlich ernsthaft und ohne mich zu schämen über die Frage unterhalten, welcher Kindergarten wohl der richtige für meine Tochter ist. Ich koche für meine kleine Familie besonders gern, weil es meine kleine Familie ist. Ich bin schnell gelangweilt, wenn sich die Leute abends auf den Partys die üblichen Small-Talk-Schlachten liefern. Ich kann Yoga machen, ohne zu lachen. Ich habe manchmal Angst, etwas zu verpassen, weil ich nicht mehr so oft ausgehen kann, und bin meistens sehr froh, wenn ich wieder zu Hause bin, weil ich weiß, wie wenig es zu verpassen gibt außerhalb meiner Wohnung.
Das hört sich jetzt ein wenig bieder an; aber biederer als das, was man ruhig und schräg gegen den Zeitgeist "Bürgerlichkeit" nennen kann, weil es dafür gerade kein besseres Wort gibt, finde ich doch die Angst vor der Bürgerlichkeit – die im Grunde genommen nichts anderes ist als die Angst vor sich selbst. Und schlimmer als Menschen, die ihr Leben mit Kindern romantisieren, sind nur noch die, die das Leben verklären, das sie führten, bevor sie Kinder hatten.
Aber geschenkt – dafür ist die Jugend schließlich da, man soll sich später mal daran erinnern können, wie man gern gewesen wäre. Das Problem ist nur: Die Menschen machen sich leicht etwas vor dabei. Sie sind nicht wegen ihrer Kinder so, sie wären auch ohne ihre Kinder so. Menschen ändern sich nicht wesentlich, alles andere ist bloß ein Mythos, den sich ein paar Lebenshilfe-Gurus ausgedacht haben, um die neoliberale Selbstverbesserungsindustrie am Laufen zu halten. Menschen sind, wie sie sind, weil es vor ihnen ein paar gab, mit denen sie zufälligerweise verwandt waren; und jetzt gibt es wieder ein, zwei, drei neue kleine Menschen, die sie mit großen Augen ansehen – und in diesen Augen entdecken sich die Erwachsenen dann selbst, wie in einem Spiegel. Wenn sie also vor dem Leben erschrecken, das sie führen, dann erschrecken sie im Grunde vor sich selbst.
Nur Mut also. In den schweren Tüten, in den Windelpaketen, in den Milchfläschchen, tief im Kinderwagen steckt in Wahrheit so viel Freiheit, wie man will. Oder mit den Worten der freundlichen antiken Lebenshilfe-Philosophie der Stoiker: Es ist, wie es ist. Und es ist gut so.
Hier können Sie das Magazin "Süddeutsche Zeitung WIR" bestellen.
Foto: ap