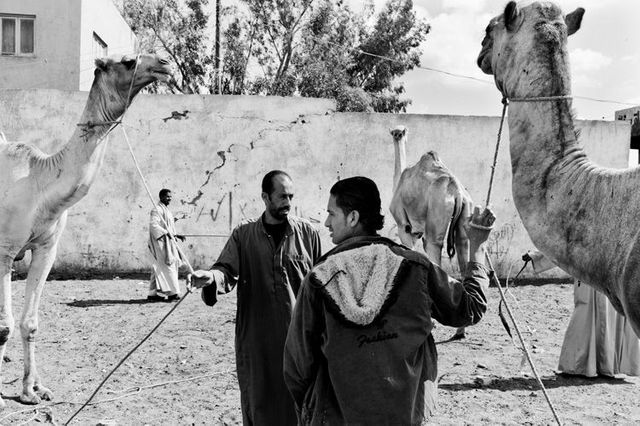Jedes Mal, wenn er den Löffel zum Mund führt, legt sich ein schwarzer Pelz auf seinen Teller. Kratzt er ein wenig Reis vom Blech, schrecken die Fliegen auf, nur um sich sofort wieder auf seine karge Mahlzeit zu stürzen. Zu Tausenden bevölkern sie Yousrys Hütte auf einer Müllkippe im Osten von Kairo. Den Bretterverschlag hält ein Plakat zusammen: das Porträt jenes Mannes, der zu Jahresbeginn noch als stärkste Kraft des Nahen Ostens galt. Seine Augen sind ausgestochen, seine Lippen mit Rasierklingen zerschnitten. Es ist Hosni Mubarak, der gefallene Diktator von Ägypten.
Seit seiner Kindheit wühlt sich Yousry durch zerfetzte Klamotten, Stromkabel und Wasserrohre, durch verfaultes Gemüse, Blutkonserven und Fäkalien. Seine Haare sind zerzaust, seine Augen entzündet, die Hände verkrustet vom Dreck der Müllkippe. Am 11. Februar war er dabei, als auf dem Tahrir-Platz im Zentrum von Kairo Hunderttausende sangen, tanzten, Fahnen schwenkten. Nur mit der Sehnsucht nach Freiheit bewaffnet, hatten die Ägypter Mubarak gestürzt, den seit dreißig Jahren verhassten Despoten. In der jubelnden Menge ergriff ein Mann in Anzug und Krawatte Yousrys Hand; seine schmutzigen Kleider kümmerten ihn nicht. »Gemeinsam sangen wir: Freies Ägypten! Freies Ägypten!«, erinnert sich Yousry. »Das war der glücklichste Tag meines Lebens.«
Dafür hat Yousry teuer bezahlt. Der jüngere Bruder starb in seinen Armen. »Kopfschuss. Wahrscheinlich ein Scharfschütze.« Zwei Freunde kamen ebenfalls ums Leben. Die Revolution wurde von Jugendlichen aus der Mittelklasse ausgelöst, die mit ihren Handys auf Facebook und Twitter zum Protest aufriefen. Doch erst als sich die Massen in den Elendsvierteln anschlossen, sich Straßenschlachten mit der Polizei lieferten, Highways und Schienen blockierten und streikten – erst da entwickelte sich die Schlagkraft, die Mubarak nach 18 Tagen zu Fall brachte. »Wir sind das Blut der Revolution«, sagt Yousry und verscheucht die Fliegen. »Bei uns, auf den Müllkippen, in den Slums, entscheidet sich die Zukunft von Ägypten.«
Imbaba. Der Slum im Nordwesten von Kairo zählt zu den größten der Welt. Imbaba ist dreimal so dicht bevölkert wie Manhattan. Eine Million Menschen. Verkehrschaos. Autowracks. Müllberge. Die Gassen, oft keine zwei Meter breit, klaffen wie Schnitte zwischen unfertigen Turmhäusern aus Backstein; dazwischen hängt das Lametta vergangener Feste.
Seit Jahren campiert Ahmed, 29, mit seiner Frau und vier Kindern auf einem Treppenabsatz zwischen der vierten und fünften Etage eines heruntergekommenen Wohnblocks. Jeden Morgen faltet der spindeldürre Mann seine Kartons zusammen, um sie nachts wie eine Puppenkiste für sich und seine Familie wieder aufzustellen. Sie schlafen zu sechst auf zwei Decken. Die Nachbarn steigen über sie hinweg. Jeder Treppenabsatz ist belegt. Auf dem Flachdach, im Hinterhof, im Abwasserschacht – überall hausen Menschen in flüchtig gezimmerten Verschlägen. Eine sechsstöckige Metapher für das klaustrophobische Elend in den Kairoer Slums.
»Alles ganz offiziell«, sagt Ahmed und hebt wie zur Entschuldigung die Hände. »Wir bezahlen Miete.« Neunzig Pfund. Wenig mehr als zehn Euro. Weil Ahmed keine Arbeit hat, bekommt er das Geld oft nicht zusammen. Jetzt – nach der Revolution – will er ein eigenes Haus. Zweistöckig. Mit Klimaanlage und Badewanne. »Und einen Mercedes«, sagt er ohne jede Spur von Ironie. »Zur Not gebraucht.«
Die Erwartungen der Armen an das neue Ägypten sind gewaltig. Nach dem Sturz des Diktators hat die Armee die Regierungsgeschäfte übernommen und einen »friedlichen Übergang« versprochen. Wenn die Generäle Wort halten, finden im Herbst freie Wahlen statt. Ägypten könnte die erste liberale Demokratie der arabischen Welt werden. Ein Vorbild für alle, die im Nahen Osten mit friedlichen Mitteln Reformen wollen.
Doch in den Elendsvierteln von Kairo macht sich bereits Ernüchterung breit. Zweimal seit der Revolution sind Ahmed und seine Familie im Treppenhaus überfallen worden. »Ausgerechnet wir«, klagt er, während er die Kartonwände für die Nacht aufstellt. »Unser gesamter Besitz passt doch in zwei Plastiktüten.« Als die bewaffneten Jugendlichen nichts von Wert fanden, nahmen sie die elfjährige Aisha mit. Von
Ahmeds Tochter fehlt seither jede Spur.
Fast die Hälfte der 80 Millionen Ägypter lebt an der Armutsgrenze von zwei Dollar am Tag. Weit mehr als zehn Millionen Menschen drängen sich allein in Kairo in den sogenannten »ashwa’iyat« – vom arabischen Wort für »planlos«, »willkürlich«. Oft ohne Zugang zu Wasser und Strom, ohne richtige Straßen. Es mangelt an Schulen. Auf einen Arzt kommen Hunderte, manchmal Tausende von Patienten. Auf offiziellen Karten von Kairo existieren die meisten »ashwa’iyat« überhaupt nicht.
»Wir sind nur ein kleiner Haufen«, sagt Mahmoud und lässt nervös den Cursor über den Monitor seines Laptops kreisen. »Die in den Slums sind eine Armee.« Ein Café im Stadtzentrum von Kairo. Keine halbe Stunde von Ahmeds Treppenabsatz entfernt. Mahmoud trägt Röhrenjeans und Converse-Turnschuhe und studiert Kommunikationswissenschaften. Auch seine Freunde gehen zur Uni. Ihre Eltern sind Ärzte, Anwälte, Künstler. Auf dem Tisch liegen ihre neusten iPhones und Blackberrys. Die Monitore von Laptops leuchten. Horreya – der Name des Cafés bedeutet »Freiheit«.
Rechts gibt es Bier, links Tee. Mahmoud und seine Freunde sitzen links. »Leute wie wir haben die Revolution ins Rollen gebracht«, sagt Mahmoud voller Stolz und erklärt, wie sie mit anderen Jugendlichen aus der ägyptischen Mittelschicht in den ersten Tagen mit ihren Smartphones auf Facebook zum Protest aufriefen. Sie sind gebildet, gut informiert, essen bei »McDonald’s« und shoppen in glitzernden Einkaufspassagen. Beim Gedanken an die Massen in den Slums, wo die Arbeitslosigkeit mancherorts achtzig Prozent beträgt und jeder Zweite Analphabet ist, bekommt Mahmoud eine Gänsehaut: »Nicht auszudenken, was passiert, wenn die alle die Islamisten wählen.«
Damit die Revolution nicht ihre Kinder frisst, wollen Mahmoud und seine Freunde den Slumbewohnern Demokratie beibringen. Doch die Slums, wo die Millionen leben, auf deren Stimme alles ankommen wird, sind ihnen fremd. Keiner weiß so recht, wo sie anfangen sollen. Abendkurse geben? Aktionsgruppen gründen? Eine eigene politische Partei? Ihre letzte Hoffnung: »Gib doch bei Google mal ›Demokratieförderung‹ ein.«
Der ägyptische Volksaufstand hatte keinen Anführer. Das war seine Stärke. Doch jetzt sagt den Helden der Revolution niemand, was sie tun sollen. Nach jahrzehntelanger Diktatur mit wenig politischer Teilhabe herrscht fieberhafter Aktionismus. Dutzende von Parteien werden gegründet: linke, liberale, konservative, religiöse, säkulare. Jeden Tag entstehen neue politische Aktionsgruppen und Komitees.
»Keiner blickt mehr durch«, sagt Mahmoud und nippt an seinem Tee. »Ich weiß, was wir mit den Slumbewohnern machen. Wir zeigen denen, wie Facebook funktioniert.« Es ist nicht ganz klar, wie ernst er diese Idee wirklich meint.
Wie schützt man seine Familie?
Eine Straßenkreuzung in Imbaba. Überall sonst im Elendsviertel wimmelt es von Menschen – nur das »Nest« ist gespenstisch leer. Keine Fußgänger, keine Autos. Fenster und Türen sind verrammelt. Der Ort heißt so, weil sich am Schnittpunkt mehrerer Straßen der Müll zwei Stockwerke hoch häuft; Straßengangs haben sich darin eingerichtet. An einer Ecke üben sich Jugendliche im Umgang mit ihren Butterflymessern. Einer lässt sein Nunchaku sirren, eine tödliche Waffe aus zwei Holzstücken, die durch eine Kette verbunden sind.
Vom »Nest« aus kontrollieren die Gangs das Geschäft mit Alkohol, Drogen, Waffen, Prostitution. Banden bekriegen sich offen. Raubüberfälle und Morde nehmen zu. Die Polizei traut sich nicht in die Gegend. »Die Leute haben Angst, ihre Häuser zu verlassen«, sagt Ramzy, ein kahl geschorener Mittvierziger, der gleich um die Ecke wohnt. »It is completely fucked up!«
Wie schützt er sich und seine Familie? Zuerst zuckt Ramzy mit den Schultern. Aber später an diesem Nachmittag öffnet er in einer Sackgasse in Imbaba ein schweres Eisentor. Männer mit tätowierten Unterarmen führen ihn durch eine zweite Tür. Unter einer nackten Glühbirne wartet ein Ägypter in einem mottenzerfressenen Anzug; als Krawatte trägt er einen Galgenstrick – sein Markenzeichen. Der Lederkoffer auf dem Tisch enthält eine Menge guter Gründe, warum er anonym bleiben will.
»Neun-Millimeter-Beretta«, sagt er und zeigt auf ein halbes Dutzend gebrauchter Pistolen. Erbeutet aus Polizeibeständen während der Revolution. »Stück neunzig Dollar.« Vier russische Karabiner: »Je 160 Dollar.« Eine Maadi Misr, ägyptische Kalaschnikow: »Verhandlungssache.« Dazu eine Auswahl an Klapp- und Kampfmessern.
Demokratieförderung? Abendkurse? Facebook? Der Mann zieht einen vergoldeten Kamm durch sein Stoppelhaar und entblößt die verfaulten Schneidezähne. »Große Probleme«, sagt er und zeigt mit dem Kinn auf die Waffen. »Einfache Lösung.«
Von kaum einer Million Menschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Einwohnerzahl des Ballungsraums Kairo auf geschätzte 25 Millionen angeschwollen. Was, wenn sich das Leben der Slumbewohner auch unter einer demokratisch gewählten Regierung nicht spürbar bessert? Wenn sich ihre Erwartungen an das neue Ägypten nicht erfüllen? »Wir kennen jetzt den Weg zum Tahrir-Platz«, sagt Ramzy, als er im »Nest« wieder auf die Straße tritt; in seiner Hosentasche steckt die neue Beretta. »Nächstes Mal schießen wir zurück, wir lassen uns nicht mehr verarschen.«
Die einen gründen Parteien, die anderen bewaffnen sich. Wie soll da eine Demokratie entstehen? Eine klassenlose, freie Gesellschaft? »Wir müssen ganz unten anfangen«, sagt Mohammed Atia, 70, langes Gewand, getönte Sonnenbrille, grauer Vollbart. »Bei den Armen, dem Salz der Erde.«
In Sharabiya, einem der zahllosen unterprivilegierten Stadtteile Kairos, sieht es genauso trostlos aus wie in Imbaba. Erst auf den zweiten Blick fallen feine Unterschiede auf: Der Gang der Bewohner wirkt gelassener. Eine Frau schmückt ihren baufälligen Balkon mit Papierblumen. Auf der Kreuzung steht ein rüstiger Alter in Flatterhosen und Karibikhemd und regelt freiwillig den chaotischen Verkehr. »Wir lassen alles stehen und liegen, wenn wir helfen können«, sagt Atia, stolz darauf, wie die Leute von Sharabiya ihren Alltag meistern.
Atia ist verantwortlich für ein Krankenhaus der Muslimbruderschaft, jener im Westen als extremistisch, antiwestlich, antiisraelisch gefürchteten islamischen Vereinigung. Mubarak unterdrückte die Muslimbrüder brutal. Seit der Revolution sind sie die am besten organisierte politische Kraft Ägyptens. In den Elendsvierteln genießen sie hohes Ansehen, weil sie seit Jahrzehnten jenen helfen, um die sich sonst kaum jemand kümmert.
Es ist kurz nach acht Uhr abends. Atia bahnt sich seinen Weg durch die Menschen, die sich auf den vier Etagen des Krankenhauses drängen. Zwanzig Ärzte versorgen hier täglich mehr als tausend Patienten. »Wer kein Geld hat, muss nichts bezahlen«, sagt Atia und gibt den Wartenden im Vorbeigehen die Hand. »Unabhängig von Glaube, Hautfarbe und sozialer Herkunft.«
Tagsüber arbeiten die Ärzte in privaten Einrichtungen, wo sie für eine Blinddarmoperation umgerechnet 200 Euro verlangen, ein halber Jahresverdienst für viele in Sharabiya. Dieselben Ärzte führen die Operation im Krankenhaus der Muslimbrüder umsonst aus. »Zakat geben«, sagt Atia – Bedürftige unterstützen, eine der fünf Säulen des Islam. »Wenn wir nicht für die Armen da sind, sterben sie.«
Sharabiya. Lange Reihen von Wohnblocks mit zerplatzten Fassaden. Lichtlose Gassen, die sich auf müllübersäte Plätze öffnen. Vor dem Eisentor einer Bäckerei drängen sich Frauen; es sieht aus, als kämpften sie miteinander. Dreirädrige Tuk-Tuks. Schafherden. Im Rauch brennender Autoreifen wippen Kinder in verrosteten Schiffschaukeln. Weiter draußen hausen Tausende in Zelten. Die Slums von Kairo. Halb Dorf, halb Apokalypse. Nicht das Gegenmodell der Stadt, sondern ihre Essenz.
Hier unterhalten die Muslimbrüder Kindergärten und Schulen, verteilen Reis, Zucker, Speiseöl an die Ärmsten, statten Mädchen mit Schuluniformen aus, springen bei Hochzeiten ein, wenn das Geld knapp ist. »Wir tun das nicht für Wählerstimmen«, sagt Atia, der seinen Dienst erst kurz nach Mitternacht beendet. »Wer den Armen unterstellt, sie würden ihre Stimme verkaufen, beleidigt sie.«
Nach aktuellen Umfragen haben die Muslimbrüder gute Chancen, bei den geplanten Wahlen stärkste Kraft zu werden. Ihre alte Garde folgt dem Motto »Der Koran ist unsere Verfassung«, will den Islam als Staatsreligion und die Scharia, die islamische Rechtsprechung. Frauen und Nicht-Muslime sollen von höheren politischen Ämtern ausgeschlossen werden.
Die jungen Muslimbrüder hingegen sehen sich als moderate islamische Bewegung. »Wir sind für Demokratie und Menschenrechte«, sagt Hamdy, 22, ein Muslimbruder, dem Mubaraks Häscher auf dem Tahrir-Platz den Arm brachen. »Zugleich wollen wir unsere religiöse Identität behalten – wie die deutschen Christdemokraten.«
Wo genau die Muslimbrüder sich positionieren, wird auch von der Frage abhängen, ob sie sich auf Allianzen mit den Salafisten einlassen. Vor der Revolution hatten diese radikalen Islamisten Angst vor Mubaraks rigoroser Polizei. Jetzt nutzen sie die errungene Freiheit auf ihre Weise: Sie verprügeln Frauen auf offener Straße, zerstören Sufi-Schreine, zünden Videotheken, Alkoholläden und koptische Kirchen an. Für das ägyptische Fernsehen fordern die Salafisten ein Verbot von Küssen.
Doch in den Slums kommen die Radikalen nicht gut an. »Ich will Geld, ein Auto, eine Frau«, sagt Youssef, 19, Muslim, in einer staubigen Seitenstraße von Sharabiya. »Das Letzte, was ich jetzt brauchen kann, sind religiöse Spinner.« Einem Gottesstaat, der Ägypten um 400 Jahre zurückwirft, gibt Youssef keine Chance. »Wir haben Mubaraks Diktatur gestürzt, jetzt wollen wir keine Diktatur des Korans.«
Dennoch: Die Angst vor den Salafisten wächst. Vor allem bei den Kopten, mit rund zehn Prozent der Bevölkerung die größte christliche Glaubensgemeinschaft im Nahen Osten. In Ägypten gehören die Kopten zu den Ärmsten der Armen. In den Slums leben sie meist friedlich und ohne Probleme in direkter Nachbarschaft mit Muslimen. Doch schon unter Mubarak waren sie immer wieder Opfer von Schikanen und religiös motivierter Gewalt. Nach jüngsten Übergriffen warnte der regierende Militärrat, dass jeder, der an der konfessionellen Grenze zwischen Muslimen und Christen zündle, mit dem »Schicksal der Nation« spiele. Die Lage könne schnell außer Kontrolle geraten.
»Wir haben gehofft, unser Leben würde nach der Revolution besser«, sagt Nagwa, eine junge Koptin in schwarzem Gewand und schwarzem Kopftuch. »Aber jetzt ist alles noch viel schlimmer.« In Nagwas Wohnzimmer schichten sich Abfälle bis unter die Decke. Im Schlafzimmer, in der Küche, in der Zelle, in der die Kinder schlafen: überall Dreck, Fliegen, Ratten. An einem gerissenen Keilriemen über der Haustür hängt ein Poster von Jesus Christus.
»Warum schützt die Armee uns nicht?«
Zarayeb ist eine Stadt aus Müll, der schlimmste Slum in Kairo, ein bedrückendes Sinnbild für den Überlebenskampf der Christen im muslimisch dominierten Ägypten. Rund 60 000 Kopten leben hier von den Abfällen, die sie in Kairo sammeln und in ihren Vierteln recyceln. »Während der Revolution standen wir Kopten an der Seite der Muslime«, sagt Nagwa und zieht aus dem Haufen, den sie gerade sortiert, ein verschimmeltes Stoffpferdchen; ihr Baby steckt es in den Mund, um daran zu nuckeln wie an einem Schnuller. »Wir hatten ein gemeinsames Ziel: Mubarak musste weg.«
Christen und Muslime sind Brüder, hieß es auf den Spruchbändern auf dem Tahrir-Platz. Niemand kann uns trennen. Doch schon wenige Wochen nach dem Sieg der Revolution besprühten Islamisten koptische Frauen mit Säure, weil sie kein Kopftuch trugen. Maskierte erstachen einen koptischen Priester und schrien »Allahu akbar«, als sie aus dem Pfarrhaus rannten. Als in einem Vorort von Kairo im März ein muslimischer Mob eine Kirche niederbrannte, strömten auch die Kopten der Müllstadt Zarayeb aus Protest auf die Straße. Sie blockierten eine wichtige Verkehrsachse. Ein Handgemenge mit Muslimen eskalierte. Bald säumten Autowracks die Straße. Häuser brannten.
»Ist er nicht schön?«, fragt Nagwa und betrachtet auf dem Display ihres Handys das Bild eines strahlenden jungen Mannes. »Sie schossen ihm in den Hals.« Er und zwölf andere starben bei den Unruhen. Mindestens 110 Menschen wurden verletzt. »Seit mein Mann tot ist« – Nagwas Baby klammert sich an ihren schwarzen Rock –, »seit sie ihn umgebracht haben, hoffe ich nichts mehr.«
Aus einer benachbarten Müllgrube stürzt plötzlich eine alte Frau in einem schwarzen Gewand. »Die Islamisten schlachten uns ab«, schreit sie wie verrückt und bekreuzigt sich. »Wir werden für das Kreuz sterben. Wir alle. Bald.« Sie zittert am ganzen Leib, rauft sich das Haar, stampft mit den Füßen auf. »Wo ist die Armee?«, schreit sie, sackt zusammen und bleibt im Müll liegen. »Warum schützt die Armee uns nicht?«
Ein Barackenviertel am anderen Ende von Kairo. Der junge Mann würde jeden anderen um Schutz bitten, nur nicht die Armee. »Ali«, sagt er und sieht sich um, bevor er die Tür zu seinem Unterschlupf aufschließt. »Ali ist gut, so heißen hier Tausende.«
Ali also. In seiner fensterlosen Kammer gibt es nur eine Matratze und ein staubiges Aquarium, in dem ein Goldfisch aus Plastik liegt. Ali zieht sein Hemd aus und dreht sich ins zuckende Licht einer Neonröhre. Schorfige Wunden wuchern über seinen gesamten Rücken. »Sie schlugen mich mit ihren Gürteln«, sagt Ali, und seine Stimme wird mit jedem Wort brüchiger. »Sie schlugen mich, bis ich in meinem Blut stand.«
Er steht leicht vornübergebeugt. Im Rhythmus seines Atems dehnen sich die Striemen auf dem Rücken. Die Kalligrafie der Folter, des Terrors. Wer hat ihn so zugerichtet? Mubaraks Schergen? »Sie verhafteten mich auf einer friedlichen Demonstration und brachten mich in ein Militärgefängnis«, flüstert Ali. »Es waren Soldaten, es war die Armee.«
»Die Armee und das Volk sind eins«, jubelten die Massen noch vor Kurzem auf dem Tahrir-Platz. Ohne das Stillhalten der Generäle hätte das Regime die Revolution wohl niedergeschlagen. Statt auf ihre Landsleute zu schießen, posierten Soldaten für Familienfotos. Als Mubarak abtrat, sprangen sie von ihren Panzern und küssten Demonstranten. In Ägypten sind Soldaten Volkshelden.
»Sie verbanden mir die Augen«, sagt Ali – seine Stimme ist jetzt ganz leise, ein Atmen in seinen Sätzen, als bemühe er sich, es beim Sprechen nicht zu vergessen. »Dann zerquetschten sie meine Hoden, bis ich bewusstlos wurde.«
Ali ist nicht der Einzige, der seit der Revolution in den Kerkern der Armee misshandelt wurde. Mit denselben Methoden, die zuvor Mubaraks Folterknechte praktizierten. Menschenrechtsorganisationen prangern eine ganze Reihe ähnlicher Fälle an.
»Die Armee sucht einen Grund, um an der Macht zu bleiben«, glaubt Ali und starrt auf den Plastikgoldfisch im leeren Aquarium. »Und diesen Grund werden sie bei uns in den Slums finden.« In der ausufernden Kriminalität. Im Konflikt zwischen Christen und Muslimen. Aber eine Kürzung der Subventionen für Brot würde auch schon genügen. »Nimm uns unser Brot, und wir gehen auf die Barrikaden.« Einen Aufstand der Hungrigen müsste die Armee niederschlagen. Wahlen könnten dann nicht stattfinden. »Das wäre der Anfang der Militärdiktatur«, sagt Ali und wendet den Goldfisch im Aquarium. »Die Macht hätten dann dieselben Leute wie unter Mubarak.«
Jahrzehntelang hat ein selbstherrliches, korruptes Regime die verarmten Massen ausgepresst, verhöhnt, vergessen. Die Slums sind Mubaraks gefährlichstes Erbe. Auf der Schattenseite der ägyptischen Vorzeigerevolution eskaliert schon die Gewalt. »Wenn das alles nur gut für diese Facebook-Typen war, gibt es bald einen neuen Aufstand«, sagt Ali und knöpft sein Hemd wieder zu. »Die nächste Revolution kommt aus den Slums.«
Wie hatte Ramzy im »Nest« noch gesagt? »Nächstes Mal schießen wir zurück.« Er ist nicht der Einzige, der in den Elendsvierteln seine Beretta poliert.
Vor dem Gebäude des Staatsfernsehens, unweit vom Tahrir-Platz im Herzen Kairos, stehen sich an diesem Sonntag Ende April Tausende in zwei Gruppen gegenüber. Die einen brüllen »Hosni, unser Held, unser Vater, wir lieben dich« – die anderen »Mubarak, du Mörder, wir hängen dich auf«. Sie schwingen die Fäuste, beleidigen einander, spucken sich an. Zwischen den Fronten: Soldaten in Kampfanzügen und schusssicheren Westen, die Kalaschnikow griffbereit. Es ist ein knisterndes Sinnbild für den Schwebezustand Ägyptens.
Plötzlich, wie auf ein geheimes Signal, stiebt die Menge auseinander. Glasflaschen und Steine fliegen. Schreie. Feuer. Rauch steigt auf. Ein Mann wird von einem Pflasterstein getroffen und geht zu Boden. »Es ist rot«, stammelt er und starrt dem Blut nach, das aus seinem Kopf über die Straße rinnt. »Ganz rot … es hört … einfach nicht auf.«
Die Soldaten rücken vor, schlagen mit abgewetzten Knüppeln auf die Leute ein. Solche Bilder sind es, die in Ägypten die Angst vor der Militärdiktatur schüren. »Die Armee ist die einzige Institution, die in diesem Land noch funktioniert«, sagt ein Offizier, der von der Treppe eines Hauseingangs über Funk seine Befehle gibt. Er ist ein hochgewachsener, muskulöser Mann mit glatt rasiertem Gesicht. Sein Kampfanzug sitzt perfekt, seine Stiefel glänzen. In dem ganzen Chaos scheint er der Einzige zu sein, der wirklich weiß, was er tut.
Auf der Straße bewegen sich zornige Menschenmengen aufeinander zu. Wie in Gefechtsformation. Freies Ägypten. Freie Wahlen. Muslime und Christen vereint. Ein Vorbild für den Nahen Osten. Jetzt geht es nicht mehr um Visionen. Nur noch um Gewalt. »Wenn das so weitergeht«, sagt der Offizier, »wird uns das Volk am Ende auf Knien bitten, an der Macht zu bleiben.« Dann packt er seinen Knüppel und zieht in die Schlacht.
Fotos: Moises Saman/Magnum Photos/Agentur Focus