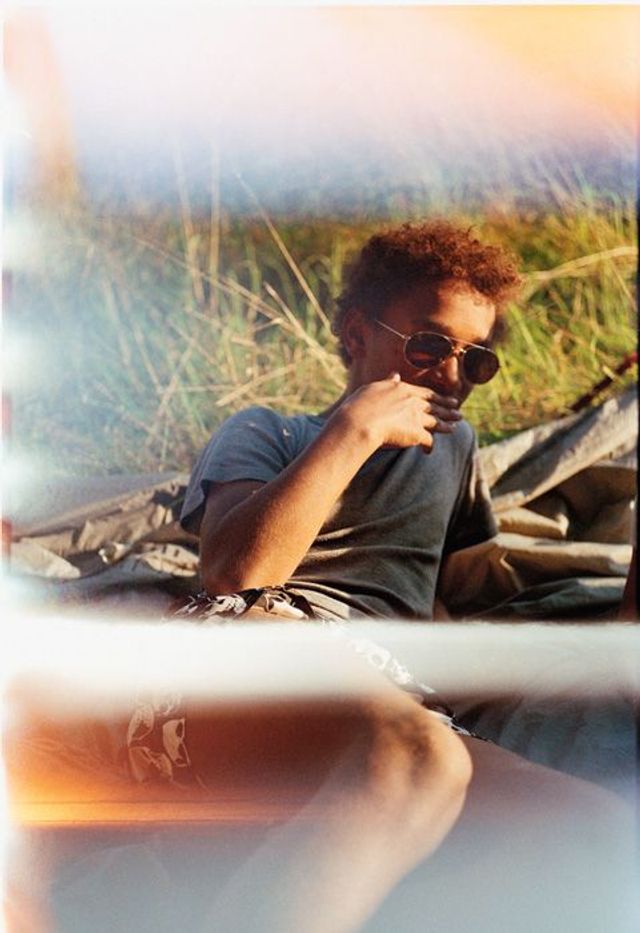Bis Ben um fünf Uhr morgens weinend im Zelt zusammenbricht, läuft es gut, nicht ohne Probleme, aber das war auch nicht zu erwarten. Sieben Kinder, zwölf bis 14 Jahre alt, ohne Eltern, ohne Lehrer, ohne eigenes Handy, jeder 150 Euro für knapp drei Wochen – und nur sie allein. Die Schule hat sie Ende August losgeschickt, die nächsten Erziehungsberechtigten sind mehr als 100 Kilometer entfernt. Das Ziel: überleben. Selbst einkaufen und kochen, jeden Tag einen Schlafplatz suchen, heil nach Berlin zurückkommen.
Das Dreimannzelt, das Ben mit Bruno und Francis teilt, steht auf einer Lichtung im Wald. Die Kanus haben sie ein paar Meter weiter am Seeufer vertäut. Ums Zelt verstreut liegen ein einzelner Schuh, Francis nasses Shirt, eine Zahnbürste und der Topf vom Abendessen, in dem jetzt eine Nacktschnecke kriecht. Es hat viel geregnet. Bruno, der vom Schluchzen aufgewacht ist, versucht Ben zu beruhigen. Nach einer halben Stunde gibt er auf.
In den anderen beiden Zelten rührt sich nichts. In einem schläft Luna, das einzige Mädchen, im anderen schlafen Johni, Jakob und Fabian. Sie sind nicht auf einer normalen Klassenfahrt. Es ist ihre »Herausforderung«. So hat ihre Schule das Projekt genannt. Monatelang haben sich die Kinder während des vergangenen Schuljahres darauf vorbereitet, nach vielem Hin und Her haben sich die sieben zusammengefunden und ein Ziel überlegt. Sie sind Gruppe 30. Ihre Schulfreunde aus Gruppe 49 arbeiten in einer Robbenstation auf Föhr. Vier Mädchen aus Gruppe 23 radeln von Berlin nach Kopenhagen. Gruppe 25 bestellt einem alten Paar den Bauernhof in Griechenland. Insgesamt sind 227 Schüler der Jahrgangsstufen acht bis zehn der Evangelischen Schule Berlin Zentrum auf »Herausforderung« unterwegs. Wie es bei den anderen läuft, wissen Ben, Bruno, Francis, Luna, Jakob, Johni und Fabian nicht. Sie selbst paddeln drei Wochen mit vollgepackten Kanus auf der Mecklenburgischen Seenplatte, jeden Tag ein neuer Ort. Das ist der Plan.
Am Abend vor der Abreise bittet Ben seine Mutter in sein Zimmer. Sie ist nervös, hat ihn fünfmal gefragt, ob er auch an seinen Fleecepulli gedacht hat. »Mama, es ist nicht deine Herausforderung, sondern meine«, sagt er zu ihr. Luna, die mit ihrem Vater und zwei jüngeren Schwestern in einer WG in Kreuzberg wohnt, kuschelt noch mal mit den Kleinen. Und Bruno, Bens Freund, rollt mit Mutter, Vater und seinem Bruder »Power-Bällchen«. Bruno, ein hochgeschossener strohblonder Zwölfjähriger, liest ernst die Mengenangaben von seinem iPod ab. Die »Power-Bällchen« sollen mit in den Rucksack und Energie liefern, wenn beim Paddeln die Kraft ausgeht. Seine Mutter hat dafür eingekauft und alles in Schalen portioniert: Haferflocken, Kokosflocken, Erdnussbutter, Weizenkleie, Leinsamen und eine echte Vanilleschote. Die meisten Zutaten sind bio. Vorm Küchenfenster hängt seit Monaten eine Plane, weil der Stuckaltbau in Berlin-Prenzlauer Berg luxussaniert wird. Die Familie wehrt sich dagegen, der Vater freiberuflicher Fotograf, die Mutter Produktdesignerin. Sie haben ihre beiden Kinder auf die evangelische Reformschule geschickt, weil ihnen der Ansatz vom freien Lernen ohne Leistungsdruck und Noten gefällt. Während andere Schulen im Frontalunterricht Mathematik, Erdkunde und Sprachen durchpauken, gibt es an Brunos Schule »Lernbüros«, in denen die Schüler sich Wissen im eigenen Rhythmus erarbeiten, sowie Fächer, die »Verantwortung« heißen – und außerdem die »Herausforderung«.
»Darauf bin ich neidisch«, sagt Brunos Mutter. »So etwas gab es zu unserer Zeit nicht.«
Wer wie sie in den Siebzigerjahren aufwuchs, kann rückblickend kaum fassen, wie er das überlebt hat. Fahrrad fuhr man ohne Helm, Autos hatten weder Gurte noch Airbags, Handy und GPS-Armbänder waren noch nicht erfunden und der Tagesablauf war nicht durch Yoga, Geige oder Hockey getaktet. Es war normal, dass Eltern nicht wussten, wo sich ihre Kinder herumtreiben.
Brunos Mutter genoss diese Freiheit. Trotzdem erzieht sie ihre Kinder heute anders, will wissen, wie sie denken, fühlen, was sie machen – will näher dran sein, wie alle Eltern ihres Bekanntenkreises. Ihr Sohn darf allein auf die Straße, sie weiß aber immer noch genau, wo er steckt: beim Basketballtraining, beim Angeln, bei welchem Freund.
Deshalb ist das Schulprojekt von Bruno, Ben und Luna nicht nur eine Herausforderung für die Schüler, sondern auch für die Eltern. Sie sollen sich einmal komplett raushalten, nichts organisieren, nichts packen, keinen Kontakt haben, sobald die Kinder in den Zug steigen. Den Eltern erklärte die Rektorin, als sie die »Herausforderung« 2007 einführte, sie wolle die »schlummernden Fähigkeiten« bei den Kindern wecken. Gelerntes bleibt nur zu zehn Prozent hängen, wenn wir es lesen, zu neunzig Prozent aber, wenn wir es selbst tun, das zeigt die Hirnforschung. Weil es nach der ersten »Herausforderung« Ärger mit den Eltern gab, schickt die Schule seitdem jeder Gruppe einen volljährigen Betreuer mit. Der begleitet die Kinder, ist immer in der Nähe, die Kinder müssen ihn mitfinanzieren und ihn auch mit Essen versorgen. Aber der Betreuer kümmert sich um nichts, er darf nur im Notfall eingreifen: bei einem Unfall, wenn Kinder sich gefährden oder wenn sie Verbotenes tun. Sollte die Gruppe allerdings den ganzen Tag in die falsche Richtung paddeln, muss er sich raushalten.
»Wir sind nicht durchgängig gut darin, ihn einfach machen zu lassen«, sagt Brunos Mutter. Den Kanuverleih, an dem die Kinder die Reise beginnen, kennt sie, ihr Mann hat dort schon fotografiert. Beim Packen hat sie Bruno mehr Unterwäsche dazugesteckt, und sie haben im Wohnzimmer das Kochen mit Gaskartusche geübt. Aber eigentlich weiß sie, dass es Zeit ist, loszulassen. Und jetzt hat sie tatsächlich keine Ahnung, wie die sechs Jungs und das Mädchen in der Gruppe zurechtkommen, was sie essen, wo sie schlafen und ob sie sich nicht verlieren.
Was also passiert, wenn man Großstadtkinder einer Freiheit aussetzt, die früher normal war?
Am ersten Tag der »Herausforderung« geht schon bei den wichtigsten Aufgaben einiges schief: beim Essen und Organisieren eines Schlafplatzes. Als die Kinder am Bahnhof in Fürstenberg an der Havel, dem Ausgangspunkt für Wasserwanderer, aus dem Zug steigen, teilen sie sich auf. Vier sollen im Netto Vorräte für die nächsten Tage besorgen, die anderen drei den Campingplatz mit Kanuverleih finden. Vor der Rezeption des Naturcampingplatzes am Ellbogensee werfen Bruno, Francis und Fabian das Gepäck für drei Wochen Paddeltour ab. Sie tragen Jeans und graue Kapuzenpullis, als hätten sie sich abgesprochen, ihre wasserdichten Seesäcke glänzen wie neu. Die Betreuerin Romy Schwarz, die die Schule ihnen mitgeschickt hat, bleibt draußen. Die Jungs sollen die Übernachtung selbst regeln. Sie öffnen die Tür zur Rezeption und stehen vor der Besitzerin des Campingplatzes, einer blassen, älteren Frau. Sie starrt sie an.
»Wir zelten. Was kostet das die Nacht?«
»Ihr habt nicht angerufen. Wie viele seid ihr?«
»Sieben, nee acht insgesamt.«
»Wie alt?«
»Alle so zwölf, 13.«
Die Frau stützt sich am Tresen ab, graue Strähnen fallen ihr ins Gesicht; gerade hat sie einen Sommer voller Camper überstanden. Sie schüttelt den Kopf. Was machen diese Kinder hier allein? Wo ist ein Erwachsener, Lehrer, eine Aufsichtsperson, mit der sie sprechen kann? Sie verhandelt nicht mit Minderjährigen. Sie will sie hier nicht haben. Das schreit sie ihnen auch hinterher.
Im Netto am Marktplatz von Fürstenberg hat Luna bei den Sonderangeboten Linseneintopf in Dosen gefunden. Sie hat schräg stehende Katzenaugen, das Haar fällt ihr über die Schultern, ein hübsches Mädchen, das sich ihrer Wirkung noch nicht bewusst ist. Sie ist mit drei von den Jungs einkaufen. Ben, Johni und Jakob schlittern mit dem Einkaufswagen durch die Gänge. Vor der Abreise hat Luna mit ihrem Vater, einem Arzt, Einkaufen geübt. Sie haben über Kohlenhydrate und Proteine gesprochen, über Energieverbrauch und darüber, wie lange die Lebensmittel halten. Jetzt rechnet Luna aus, dass alle von den acht Linseneintopfdosen zweimal satt werden. Außerdem hat sie in den Einkaufswagen gelegt: Zwanzig Packungen Spiralnudeln, zwei Flaschen Ketchup, acht Tüten Haferflocken, vier Packungen Pumpernickel und bestimmt 200 Teebeutel. Überhaupt ist Luna die Einzige, die versucht, etwas System in die Sache zu bekommen. Als Älteste von drei Schwestern ist sie es gewohnt, dass man auf sie hört. Die Jungs schleppen Süßigkeiten an, Cola, Fruchtzwerge und Spielzeug. Luna schickt sie immer wieder zurück. Nach der zwölften Diskussion gibt sie auf.
»Leute, hier gibt es so was Ähnliches wie YumYum, vier für siebzig Cent!«, ruft Ben.
»Nein! Das macht nicht satt«, sagt Luna.
»Doch!«
»Du denkst nur, dass du satt wirst. Aber du warst an der Luft, du hast Sport gemacht. Glaubst du wirklich, dass du von diesen kleinen Nudelchen satt wirst?
»Ja! Die sind so lang! Außerdem: Wir sind in der Überzahl.«
»Was soll das heißen?«
»Demokratie!«
Es ist später Nachmittag, noch immer weiß die Gruppe nicht, wo sie die erste Nacht verbringen soll.

Genau davor hatten die Eltern Angst, Demokratie. Unter Kindern. Die sieben haben von praktischen Dingen bisher wenig Ahnung, woher auch? Die Elterngeneration heute umsorgt ihre Kinder zu sehr, kritisieren Pädagogen: Kaum einer müsse mehr bei der Hausarbeit mithelfen, nicht einmal ihre Fehler würden Eltern ihre Kinder selbst machen lassen. Viele versuchen, ihnen Anstrengung, schlechte Gefühle und Misserfolge im Leben zu ersparen. Sie, die immer später Eltern werden, sind fürsorglich, engagiert, stellen ihre Kinder über alles und muten ihnen wenig zu – aber sie trauen ihnen auch wenig zu. Insofern markiert die »Herausforderung« der Berliner Reformschule eine neue Erfahrung. Man könnte sie mit »Weniger ist mehr« beschreiben. Viele Eltern haben nun doch verstanden, dass eine »Helikopter-Erziehung« ihre Kinder daran hindert, sich zu selbstständigen, verantwortlichen jungen Erwachsenen zu entwickeln.
An der Kasse will jeder der vier die Geldscheine halten, die sie für den ersten Einkauf eingesteckt haben. 185 Euro – so viel hat noch keiner in der Hand gehabt. Sie haben keine Ahnung, wie viel sie bezahlen müssen. Öl zum Kochen, Milch, Butter und Wasser liegen nicht mit auf dem Band. Trotzdem: Die Kinder sind zufrieden, vor allem, weil sie nur 70 Euro ausgeben. Als sie in Richtung Zeltplatz abziehen, bleibt der Kassiererin, die Luna und die Jungs die ganze Zeit misstrauisch beobachtet hat, ein Fragezeichen im Gesicht stehen. Genau wie der Frau von der Campingplatz-Rezeption.
Es ist später Nachmittag, noch immer weiß die Gruppe nicht, wo sie die erste Nacht verbringen soll. Sie haben die Netto-Tüten zum Gepäckberg am Campingplatz geschleppt, Bruno, Luna und Ben sitzen drauf.
»Ich hasse solche Leute, die gleich was gegen Kinder haben«, sagt Ben.
»Nee, gegen Jugendliche, weil die immer Scheiße bauen«, sagt Bruno. »Und es stimmt ja auch.«
»Aber wo soll man denn auf dem Campingplatz Scheiße bauen?«
»Na ja, nachts rumschreien.«
»Oder Zelte aufschlitzen.«
Fabian, der einzige 14-Jährige, hat im vergangenen Jahr schon eine »Herausforderung« überstanden. Ihn beunruhigt das Schlafproblem nicht. Er kickt eine leere Dose herum, Johni, ein sportlicher Typ, kickt zurück. Jakob, der am reifsten wirkt, weil er so ruhig und ernst ist, blickt auf den See. Und Francis, der Clown, der auf der Fahrt die meisten Sprüche gemacht hat, sagt nichts.
Sie waren so stolz, dass sie alles allein regeln dürfen, jetzt wünschen sie sich Hilfe von ihrer Notfallbetreuerin.
Romy Schwarz hat die Szene mit der überforderten Campingplatzbesitzerin mitbekommen. Sie ist vierzig, hat keine Kinder und ist gelernte Intensiv-Krankenschwester. Zehn Jahre hat sie in Guinea gearbeitet, jetzt studiert sie auf Lehramt. Eine Frau, die zupackt und gern Verantwortung übernimmt. Romy Schwarz hat sich fest vorgenommen, nicht einzugreifen. Jetzt fällt es ihr schwer, vor allem, als die Kinder so ungerecht behandelt werden. In Afrika hat sie viele Kinder im gleichen Alter gesehen, die ganz selbstverständlich den Haushalt machen müssen. Da würden die sieben niemandem auffallen. In Deutschland sieht man immer seltener Kinder allein auf der Straße, ihr Aktionsradius ist seit den Siebzigerjahren auf ein Minimum geschrumpft. Das zeigt sich zum Beispiel am Schulweg. 1970 liefen neunzig Prozent der Erstklässler selbstständig zur Schule, heute sind es nur noch 17 Prozent. Meistens bringen die Eltern sie sogar bis vors Schultor, wie eine Forsa-Umfrage 2012 ergab. Reagieren Erwachsene wie die Campingplatzbesitzerin deswegen so misstrauisch? Weil Freiheiten für Kinder so knapp geworden sind?
Romy Schwarz tritt nah an den Tresen und redet mit der Frau. Die Gruppe darf bleiben.
Als die anderen Jungs unter einem Haselnussstrauch das erste Zelt aufbauen, zieht Ben den Reißverschluss seines Seesacks auf. Den hingestylten Pony muss er dabei immer wieder aus den Augen wischen. Unter Gummibärchen und Brausebonbons, die seine Mama ihm zur Überraschung eingepackt hat, wühlt er einen Schlafsack, einen Klappspaten, Funktionskleidung, ein Klappmesser, ein Reisekissen, ein Küchenset und einen Kulturbeutel hervor. Alles Markenprodukte, alles neu. Das Zelt hat er zum Geburtstag bekommen. Die anderen testen das Kissen, probieren den Funkenschläger aus, dann laufen sie runter zum See. Das Wasser ist schon zu kalt zum Baden. Am Abend beschließen sie, nicht zu kochen. Dafür gibt es Bens Süßigkeiten und den Zitronenkuchen, den Francis Mutter mitgeschickt hat.
An den folgenden Tagen regnet es. Der Sprühregen durchweicht die Wasserwegekarte und überzieht Haare und Gepäck mit einer nassen Schicht. Die Kinder haben vier Kanus geliehen, bisher ist nur Jakob ins Wasser gefallen. Unter der Funktionskleidung sind alle noch trocken. Täglich passieren sie Schleusen, einmal mussten sie die vier voll beladenen Kanadier über eine Straße tragen. Dabei ist einer umgekippt, weshalb sie sich heftig angeschrien haben. Das erste Mal.
Gerade steht die Sonne im Zenit über dem Wasser des Pälitzsees. Das einzige Geräusch kommt von den Paddeln, die rhythmisch ins Wasser stechen. Der See liegt in einem Laubwald, durch den die Grenze von Mecklenburg zu Brandenburg verläuft. Von den Booten aus halten die Kinder Ausschau nach einer Übernachtungsstelle. Ein Biwakplatz, flach, baumfrei und trocken, nach der Erfahrung mit der Campingfrau haben sie keinen Zeltplatz mehr aufgesucht. Auf der Brandenburger Uferseite ist es erlaubt, eine Nacht wild zu campen. Das wissen die Kinder, seit sie ein Ranger aus Mecklenburg-Vorpommern frühmorgens beim Frühstück erwischt hat. Zum Glück hatten sie die Zelte gerade abgebaut, weshalb er ihnen die Geldstrafe erließ.
Bruno, Francis und Ben teilen sich einen der Kanadier, grün mit Holzbänken, auf denen fünf Mann Platz hätten, wäre da nicht das Gepäck. Die Jungs sitzen nun am liebsten mit nacktem Oberkörper im Boot. Bruno ist der Antrieb, er paddelt backbord mit einer Ausdauer und Kraft, die bei den schmalen Armen überrascht. Francis steuert. Zwischen Bens Knien klemmen Seesäcke und eine pralle Plastiktüte, in die Luna die liegen gebliebenen Sachen vom letzten Schlafplatz gestopft hat: nasse Socken, eine Badehose, eine Gabel, die Wäscheleine, einzelne Schuhe, eine Zahnbürste, einen Kapuzenpulli. Ein paar Dinge sind schon verloren gegangen, Lunas Taschenmesser, die Heringe von Bens neuem Zelt.
Drei bis vier Stunden paddeln sie jeden Tag. Eigentlich wollten sie von der Seenplatte über die Wasserstraßen der Havel Berlin erreichen. Stattdessen kreuzen sie nun seit zehn Tagen ziellos über die Seenlandschaft. Sie genießen es, keinen Plan zu haben, keinen getakteten Tagesablauf, einfach mal frei zu sein. Erst wenn sie müde werden, schauen sie auf der Karte nach, wo sie sind. Heute erreichen sie fast wieder den Ort, von dem sie am ersten Tag aufgebrochen sind.
Längst haben sich die Kinder der Natur angepasst. Wenn es dunkel wird, legen sie sich schlafen, ohne dass jemand sie auffordern müsste. Mit der Morgendämmerung wachen sie auf, was allerdings nicht bedeutet, dass sie gleich zusammenpacken und aufbrechen. Das zieht sich oft bis zum Mittag. Mittlerweile trägt jeder nur noch ein Outfit. Die Jungs Badeshorts zu einem sehr grau gewordenen Shirt, das sie auch gern weglassen. Luna eine Trainingshose, über die sie einen übergroßen flaschengrünen Sweater zieht. Der Rest der Kleidung muffelt feucht in den wasserdichten Taschen vor sich hin. Manchmal putzen Luna und Francis noch ihre Zähne, die anderen suchen ihre Zahnbürsten schon gar nicht mehr. Morgens waschen sie sich im See, weshalb sie wild aussehen, aber erstaunlich frisch. Luna, die anfangs noch versucht hat, ein wenig System in die Tour zu bringen, hat inzwischen ihre Autorität verloren. Die Spaßmacher haben jetzt Oberwasser. Es punktet, wer laut furzen kann, Gruselgeschichten gut erzählt und sich immer wieder neue Spiele in der Natur einfallen lässt.
Zum Beispiel, wie man fürs Abendessen eine Ente mit der Axt erlegt. Sie campen auf einer einsamen Insel, an die sie sich später als »Kackinsel« erinnern, weil überall Klopapier herumliegt. Sie zerhacken mit einer Axt einen Baumstumpf, bis Fabian, der Älteste und Kräftigste von ihnen, die Enten entdeckt. Da haben sie schon tagelang nur Nudeln mit Ketchup gegessen. Mit der Axt über der Schulter pirschen sie sich an.
»Die arme Ente!«
Die Stimme der Vernunft. Romy Schwarz, die Betreuerin, ruft, scheucht die Enten auf.
Was wäre eigentlich passiert, hätte sie nicht eingegriffen? Hätten die Kinder, sich selbst überlassen, die Ente wirklich getötet und gegessen? Wann würde ihre anarchische Seite durchbrechen, wie William Golding sie in Herr der Fliegen beschreibt? Golding glaubt nicht an eine kindliche Unschuld. In seinem Roman überlebt eine Gruppe Jungs einen Flugzeugabsturz, die dann einander in der Wildnis umbringen wollen.
Jetzt, als die Jäger von Romy ermahnt werden, fällt ihnen ihre Tierliebe wieder ein, ach ja, die arme Ente. Pädagogen, die häufig Kinder und Jugendliche auf Gruppenreisen in die Natur begleiten, beobachten, dass Kinder, die autoritär erzogen werden und kaum Freiräume kennen, viel eher über die Stränge schlagen und frei drehen, wenn niemand sie zurückhält. Kinder dagegen, die von zu Hause gewohnt sind, mit Freiraum umzugehen, müssen Lücken nicht ausnutzen. Sie sind vernünftiger, einfühlsamer, haben die Regeln des Zusammenlebens verinnerlicht. Auch die sieben aus der Kanugruppe scheinen ziemlich gefestigt. Sie streiten und diskutieren viel. Aber aggressiv ist keiner, niemand hat bisher zugehauen.
Am späten Nachmittag erspähen die Kinder eine Biwakstelle und gehen an Land. Äste von alten Buchen überdachen eine flache Stelle am Ufer, Vorgänger haben volle Müllsäcke, Glasflaschen, aber auch eine Feuerstelle hinterlassen. Mit ihren Töpfen schöpfen die Kinder Seewasser, um Nudeln aufzusetzen. Sie hocken neben den beiden Gaskochern auf dem schwarzen Waldboden, der an allem klebt, nicht nur an den nackten Füßen.
»Wir machen die Augen zu beim Essen, es gibt eh jeden Tag das Gleiche«, sagt Luna. Sie taucht den Aluteller in den See, aber der Fettfilm lässt sich mit kaltem Wasser nicht abwaschen. Sie und die Jungs, die zu Hause einen Löffel nicht zweimal benutzen, sind jetzt abgehärtet. Als die Packung platzt und die Nudeln auf den Waldboden fallen, werfen sie sie samt Stöckchen und Blätterresten ins kochende Seewasser.
Die Euphorie der Anfangstage ist verflogen. Immer dasselbe zu essen nervt, dazu die Diskussionen, ob das Wasser schon kocht, wie hoch die Gasflamme stehen soll, wer zuerst die Ketchupflasche bekommt, und ob der Fruchtaufstrich wohl schimmelt. Vom ersten Tag an essen die Kinder Haferflocken mit angerührtem Milchpulver zum Frühstück, mittags und abends Nudeln oder Brot. Zweimal hatten sie ein wenig
Abwechslung: Einmal gab es Wienerwürstchen aus dem Glas und einmal Linsensuppe aus der Dose. Aus Angst, dass das Geld ausgeht, haben sie beim Einkauf gespart. 354 Euro von ihren zusammengenommen 1050 Euro sind jetzt noch übrig; das meiste Geld ist für die Leihgebühr der Kanus und die Zugtickets draufgegangen. Eigentlich hätten sie noch genug. Aber der nächste Stopp am Supermarkt ist erst in ein paar Tagen.
Deshalb hat Luna die Mischbrotscheiben aus der Plastikpackung rationiert. Vier Scheiben pro Tag darf jeder essen, jeder weiß jederzeit ganz genau, wie viele Scheiben ihm noch zustehen.
»Aber ich verstehe das nicht. Wenn ich an einem Tag drei esse, kann ich doch am anderen vier, äh, fünf essen«, sagt Francis. Er schaut Luna an. »Aber du sagst, das geht nicht. Warum nicht?«
»Dann musst du dir das Brot wegnehmen und selber aufsparen«, sagt Luna. »Aber es ist doof, wenn das Brot in der Packung dann knapp wird und du sagst, ich habe gespart, und nimmst dir alle.«
»Aber genau das war meine Taktik.«
»Aber eben deswegen machen wir das ja nicht.«
»Wir verbringen den Großteil unserer Zeit damit, ihn zu trösten«

Die Nudeln sind weich. Jetzt das Sieb, Salz oder Öl aus einem der Säcke zu kramen – zu viel Aufwand. Die Kinder löffeln sie wässrig und ungesalzen. Sie sind es leid. Der Hunger macht sie reizbar. Als Luna Francis zum Spaß schubst, haut er genervt mit einer Plastikflasche nach ihr.
Es ist nach diesem Abend, als Ben um fünf Uhr morgens im Zelt anfängt zu weinen.
Bruno wacht auf, legt Ben die Hand auf den Arm. Es ist nicht das erste Mal, aber so laut geschluchzt hat er bisher noch nicht. Ben will nach Hause, die »Herausforderung« abbrechen. Schon in den vergangenen beiden Tagen war er mit seinen Gedanken woanders gewesen. Wenn die anderen Kniffel spielten oder den Fußball kickten, den sie aus Gras und Klebeband gebastelt hatten, hockte er daneben und starrte vor sich hin. Ben hat Heimweh.
Am Morgen ziehen die ersten Ruderer Linien in die Wasseroberfläche, auf der die Sonne ruht. Bruno sitzt auf einem umgedrehten Obi-Eimer, quetscht Honig in seine Haferflocken und löffelt müde den Brei in den Mund. Francis klatscht eine Portion auf seinen Teller, Fabian hockt sich dazu. Bruno klingt genervt. »Wenn das Heimweh nur zwei-, dreimal auf der Herausforderung wäre, okay. Aber wir verbringen den Großteil unserer Zeit damit, ihn zu trösten«, sagt er.
Bens Heimweh belastet die ganze Gruppe. Romy Schwarz, die Betreuerin, hat schon in der Schule nachgefragt, ob das geht: abbrechen. Die Schule ist dagegen. Sie würde nur im Notfall dazu raten, wenn das Kind körperliche Symptome entwickelt. Einmal war das so: Bei einer anderen »Herausforderung« löste das Heimweh bei einem Jungen Asthmaanfälle aus.
Alle sind zu kleinen Psychologen geworden. Bruno hat ihm ausgemalt, was die jüngeren Schüler über ihn denken werden. Fabian und Johni haben aufgezählt, was er alles verpassen würde, und ihm gesagt, dass er es später bereuen werde. Alle haben auf ihn eingeredet, ihn in den Arm genommen, ihn abzulenken versucht, ihn in Ruhe gelassen. Nichts hat geholfen. Ben wiederholte immer nur, er wolle seine Mutter anrufen. Aber die anderen befürchteten, das Heimweh würde dadurch schlimmer. Dann hatte Francis, der sonst am liebsten jede Situation mit einem coolen Spruch löst, die Idee, Ben telefonieren zu lassen und die Stimme der Mutter dabei auf einem MP3-Player aufzunehmen. Seitdem hört Ben ihre Mutmachsätze jeden Abend vor dem Schlafengehen. Das ging ein paar Tage gut, eines Nachts dann aber der Rückfall.
Beim Frühstück isst Ben nichts. In der Gruppe haben sie beschlossen, dass er jetzt entscheiden soll, ob er da bleibt oder abreist. Er darf das Notfallhandy der Betreuerin nehmen, sucht eine Stelle, wo der Balken Empfang anzeigt, setzt sich ins hohe Gras und wählt die Nummer von zu Hause.
Als er zurückkommt, sagt er, dass er bleibt. Sein Vater, das sagt er auch, sei stolz auf ihn. Für den Rest des Tages summt Ben vor sich hin. »Es ist weg, weg, weg! Jede Zelle meines Körpers ist glücklich«, singt er noch am Abend und muss dabei immer wieder in die Höhe hüpfen. Er ist wie ausgewechselt.
Was hat geholfen? Der Zuspruch der anderen? Die Sorge, in der Schule gehänselt zu werden? Oder ist Ben in der Herausforderung über sich hinausgewachsen? Wir schwächen unsere Kinder, schreibt Polly Young-Eisendraht, eine kanadische Therapeutin und Buchautorin, »indem wir ihnen die Steine aus dem Weg räumen und immer versuchen, sie vor den Schwierigkeiten des Lebens und ihren eigenen Verletzlichkeiten oder Begrenzungen zu schützen«. Dadurch würden höchstens die Eltern immer stärker. Ziel aber müsse sein, die Kinder zu selbstsicheren, verantwortungsbewussten, mitfühlenden jungen Erwachsenen heranzuziehen, die ihre Stärken und Schwächen realistisch einordnen können. Ben hat gemerkt, dass er sich ohne seine Eltern schlecht fühlt, er es aber aushalten kann, auch mal traurig zu sein – und dass die anderen ihn trotzdem noch mögen.
Ganz zum Ende wird das Wetter wieder besser. Die Kinder haben Spaß, als sie sich von einem Seil, das sich über einen Fluss spannt, ins Wasser stürzen. Sie schreiben eine Flaschenpost, in der sie ihre Reise mit Zeichnungen beschreiben und ihre Namen und den der Schule daruntersetzen. Einmal schläft Bruno auf dem Kanu ein. Bis er wieder aufwacht, paddeln die anderen im Boot ein ganzes Stück für ihn mit, durch Seerosen hindurch. Und in Hammelspring bei Templin fallen sie auf wie Zirkuskinder, als sie Brötchen holen: Barfuß laufen sie in den Supermarkt, ihre Trainingshosen hängen tief, weil auch der Dreck inzwischen einiges wiegt.
Ausnahmsweise haben sie sich noch mal Süßigkeiten geleistet, abends lassen sie die Marshmallows über angespitzten Stöcken im Feuer schmelzen. Die Füße in der Asche am Rand der Feuerstelle, wo es nicht so heiß ist, sitzen sie im Kreis. Sie haben einander, aber auch sich selbst gut kennengelernt: bei Diskussionen im Supermarkt, beim Zeltaufbau, beim Kochen, in Bens Krise und während sie stundenlang auf dem Wasser trieben. Auch wenn sie nun Dinge wissen, die am anderen nerven: Keiner wird ausgegrenzt. Auch ein richtiger Anführer hat sich nicht herausgebildet. Alle scheinen gewachsen. Ben, der erst in sich zusammenfiel und den das Heimweh dann nur noch selten packt. Luna, die Organisierte, die gelernt hat, loszulassen. Bruno, der zäh ist und seinen klaren Verstand in jeder Situation behielt. Francis, der zuvor vor allem den Spaß im Kopf hatte und nun für die anderen mitdenkt.
Tag 18 ist ein Freitag. Noch eine halbe Stunde, bis Jakobs Vater mit seinem Bus kommt und alle zurück nach Berlin fährt. Für die letzte Nacht haben Luna, Bruno, Ben und die anderen nicht einmal mehr die Zelte aufgebaut. Mit ihren Isomatten liegen sie auf dem Gras, die Schlafsäcke bis unters Kinn zugezogen, aber sie können die Sterne sehen. Die Seesäcke und Taschen, die vor knapp drei Wochen noch wie neu aussahen, sind geschunden. Die meisten Sachen stecken jetzt in Obi-Eimern und Plastiktüten, ohnehin ist einiges verloren.
Es gibt keine große Abschiedszeremonie. Luna und Bruno holen sich vom nahen Kiosk ein Eis, Ben und Johni schaukeln, die anderen drei sind am Steg. Bestandsaufnahme:
Restgeld: 22 Euro.
Verluste: Zeltheringe, zwei Taschenmesser, Pullover, T-Shirts, Jacken, Löffel, Socken, Zahnbürsten, Unterhosen.
Verletzungen: zwei Brandblasen, kleinere Schnittwunden, Zeckenbisse.
Sie werden vieles vermissen, am meisten den Zusammenhalt, aber jetzt freuen sie sich auf eine Dusche, ein Klo und ein Bett.
Fotos: Fabian Zapatka