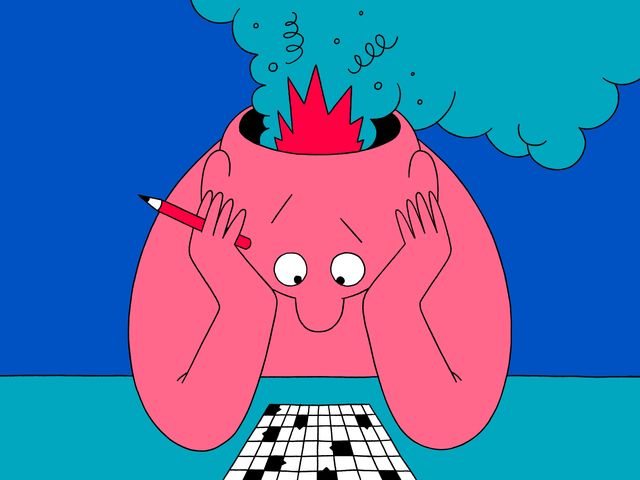Um zu verstehen, wie lange die Entstehung der Elbphilharmonie gedauert hat, muss man sich in Erinnerung rufen, dass anfangs Johannes B. Kerner um Spenden dafür warb. Der war 2006 ein bekannter Fernsehmoderator. Danach wurde das nötige Geld anders eingetrieben: über den Hamburger Landeshaushalt. Als der Bau immer teurer wurde, die Pannen immer peinlicher, die Stillstände beim Bau immer länger, das Vorgehen des Senats immer dilettantischer.
Zehn Jahre lang kannte ich niemanden in Hamburg, der sich auf die Eröffnung der Elbphilharmonie freute. Was für eine Geldverschwendung. Was für ein Elitending. Was für ein Subventionsprogramm für Baukonzerne. Was für ein, wie man hier oben sagt, Schiet. Das war der gängige Sound. Der hat sich in Teilen bis heute gehalten. Die preisgekrönte Krimiautorin Simone Buchholz etwa beschreibt in ihrem aktuellen Roman Beton Rouge, der 2017 spielt, ganz en passant, dass der Bau der Elbphilharmonie abgebrochen und auf dem Kaispeicher stattdessen ein Skaterpark errichtet wurde. Darüber hätten sich viele sehr gefreut. Was man mit dem Geld alles hätte machen können!
Ich fand die Elbphilharmonie vor allem von Anfang an hässlich. Es gibt in Hamburg ein Bedürfnis nach Architektur, die ihre Umgebung doppelt moppelt: ein Bürohaus am Wasser, das aussieht wie ein großes Boot, denn schau, hier fahren Boote. Zwei Hochhäuser an der Reeperbahn, die »Tanzende Türme« heißen, denn schau, hier tanzen Menschen. Und die Elbphilharmonie mit ihrem wellenartigen Dach, weil: Elbe, Wasser, Wellen.
Die Elbphilharmonie steht auf meinem Weg zur Arbeit wie ein Deko-Glas aus einem Geschenkeladen der Achtziger. Aber als die Eröffnung näher rückte, ertappte ich mich bei einer gewissen Neugier, die ich nur durch eine biografische Prägung erklären kann – ich war und bin aktuell eher kein Klassik- oder Baukonzern-Fan, doch während meiner Kindheit in Westberlin zwangen unsere Eltern meine Schwester und mich bei jeder Gelegenheit in die Scharoun-Philharmonie. Klassische Musik galt bei uns als wertvollstes Kulturgut, meine Eltern besaßen nicht einmal eine Beatles-Platte. Ich wehrte mich durch Sekundenschlaf, Programmheft-Origami und kindliche Vorformen der Meditation (fest an Playmobil denken). Offenbar konnte ich bei aller Langeweile nicht verhindern, dass die Konzertsaal-Besuche im Laufe der Zeit meine DNS umbildeten. Ich merkte, dass ich mich darauf freute, die Elbphilharmonie meinen Eltern zu zeigen. In Umkehr der alten Rollen: Jetzt nehm’ ich euch mal mit.
Oft bin ich am falschen Ort, wenn Geschichte gemacht wird. Als die Mauer fiel, stand ich allein in einer zugigen Fußgängerzone in Norddeutschland. Diesmal würde ich dabei sein. Anfangs war es sehr leicht, Karten zu bekommen, das Interesse war im Vergleich zu heute mini. Ich sicherte meinem Vater und mir preiswerte Karten für eines der Eröffnungskonzerte (scheidungsbedingt meiner Mutter und mir für etwas später). Mein Vater geht immer noch jeden Monat in die Berliner Philharmonie, darum fürchtete ich sein Urteil: Unsere Elbphilharmonie scheppert ein bisschen, das liegt daran, dass die Akustik so gut ist. Es ist kompliziert!
Aber kaum hatten wir die Media-Markt-Rolltreppe und die Bausparerbacksteine des Eingangsbereichs hinter uns gelassen, erfüllte mich eine ausgelassene Heiterkeit, wie ich sie das ganze Jahr 2017 an öffentlichen Orten sonst nie erlebt habe. Es war, als schlösse sich ein Lebenskreis, ich war Kind und Erwachsener zugleich, Vater und Sohn in einem, und für ein paar Momente Mendelssohn sah ich Sinn in allem, und mein Vater drückte mir die Hand auf dem Knie wie vor vierzig Jahren, damals wie heute in einer Mischung aus Dankbarkeit, Zuversicht, Rührung und Anerkennung, die ich immer von ihm lernen will, und jetzt, in diesem Elbphilharmonie-Moment im Januar 2017, gelang es. Dass das nun fast eine Milliarde Euro gekostet hat, ist aus meiner Sicht nicht zu teuer.
Foto: dpa