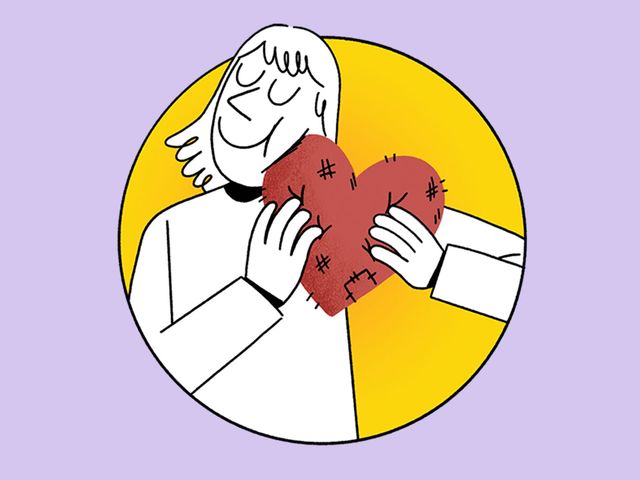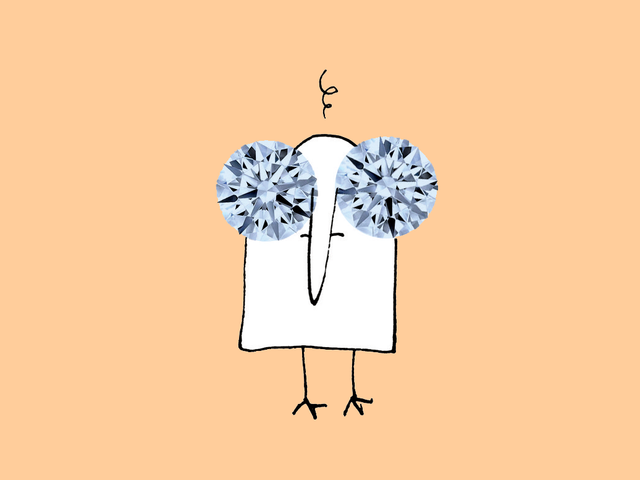Folge 135: Der Bic-Kugelschreiber
Vielleicht liegt es daran, dass ich in der Waldorfschule dazu verdammt wurde, mit dicken, weichen Wachsmalstiften das Schreiben zu lernen, dass ich heute genau das Gegenteil von einem Schreibwerkzeug erwarte. Der »Bic Kugelschreiber Cristal Original, Gehäuse transparent, Schreibfarbe blau« ist der dünnste, der härteste und vermutlich auch der billigste Kuli in der Geschichte des Kulis. Das macht ihn fabelhaft.
In der siebten Klasse wollte ich nichts mehr als eine einheitliche Druckschrift wie die Mädchen auf dem Gymnasium – eine, in der das »a« und das »o« ganz bauchig sind und alle Buchstaben in Reih und Glied stehen. Meine Schrift ist eher uninspirierend. Aber mit dem Bic, da mag ich sie – zart und ein bisschen verwunschen. Wenn ich mein Geschriebenes ansehe, habe ich Lust weiterzuschreiben.
Bis heute plagt mich der Aberglaube, ich könne gute Leistung ausschließlich mit einem dünnen Stift vollbringen. Kein Wunder also, dass ich meine Statistikklausur erst bei Versuch Numero 3 bestanden habe, schließlich war ich bei den beiden vorherigen Versuchen nicht entsprechend ausgestattet.
Das Tolle am Cristal Original ist, dass er durch sein Gehäuse ein echtes Federgewicht ist, leichtfüßig spaziert er übers Papier. Und hat er seine Arbeit verrichtet, schmeißt man ihn zu den fünf anderen seiner Art in die Handtasche, wo er sich unauffällig im Futter verkriecht. Denn ein Cristal Original will gar nicht beweihräuchert werden wie so ein teurer Füller, er will einfach nur seinen Nutzen erfüllen. Man darf ihn auch mal verlieren, immerhin kostet er nur 19 Cent – und dann irgendwann wieder finden. Einen unter der staubigen Kommode, einen beim halbvollständigen Kniffelset. Bei jedem Fund ein kleines Glück. Denn wo dieser Kuli ist, da sind auch Kreativität und Produktivität. Charlotte Haug
Folge 134: Maggi-Fix
Ich koche gerne. Und glaubt man meinen Gästen, gar nicht mal so schlecht. Geschmack bekomme ich an meine Gerichte, indem ich zum Beispiel Zwiebeln und Knoblauch mit einem Lorbeerblatt in reichlich Olivenöl anschwitze. Oder Rotwein über Stunden reduzieren lasse. Mein Gewürzregal ist voll und frische Kräuter wie Koriander, Petersilie oder Dill verwelken nur selten im Kühlschrank.
Doch ich muss gestehen, ich führe ein Doppelleben. Neben meinem Gourmetdasein hege ich noch eine geheime Obsession: Ich liebe Maggi-Fix-Produkte. Diese in Tüten abgepackten, pulverisierten Glutamatexplosionen, die jedem Essen eine gewisse Würze verleihen. Der Klassiker ist das Maggi-Gewürz. Erfunden hat es Ende des 19. Jahrhunderts der Schweizer Julius Maggi. Was genau in der braunen Flasche mit dem gelbroten Etikett ist, bleibt bis heute Firmengeheimnis. Doch an Salz und Geschmacksverstärkern wurde hier sicherlich nicht gespart. Bei meiner Oma stand das Fläschchen immer auf dem Mittagstisch. Damit würzte sie hartgekochte Eier oder ihren Linseneintopf. Tröpfchenweise kam auch ich auf den Geschmack. Maggi gibt es aber schon seit Jahrzehnten nicht mehr nur als braunes Elixier, sondern auch in Form von Tütensuppen und Gewürzmischungen. Heute koche ich Bolognese über Stunden selbst ein, aber das Aroma von Maggi-Fix für Spaghetti-Bolognese würde ich unter tausenden Saucen erkennen. Es ist der vertraute Geschmack meiner Kindheit.
Und wenn mich die Sehnsucht packt, dann reiße ich auch heute noch eine Tüte auf. Rühre Pulver in Sahne, lasse es einmal aufkochen und gieße das Ganze in eine kleine Auflaufform, gefüllt mit rohen Nudeln und Kochschinken. Anschließend ein wenig Käse drüber reiben und ab in den Ofen damit. Maggi-Fix für Schinken-Nudel-Gratin ist mein absolutes Comfortfood. Ich bereite es nur zu, wenn ich allein bin, nur für mich. Für mich ist es der Inbegriff von Selbstliebe – und zwar in geschmacksverstärkter Form. Verena Haart Gaspar
Folge 133: Der Käsehobel
Der Käsehobel war ein Geschenk einer Freundin. Wir studierten zusammen im ersten Semester Politikwissenschaften und hatten uns gleich zu Beginn kennengelernt. Wie das im Studium so ist, waren wir einander innerhalb kürzester Zeit zur Familie geworden. In den Seminaren saßen wir Seite an Seite, zwischen den Vorlesungen tranken wir Automaten-Kakao, in der Bibliothek hielten wir uns Plätze frei und nach Partys übernachteten wir beieinander.
Alles war aufregend und neu. Den Campus betreten und dazugehören zu dieser gleichsam verheißungsvollen und einschüchternden akademischen Welt. Weit weg von den Eltern leben, endlich. Freisein. Erwachsensein, oder es zumindest werden. Wenn wir ehrlich waren, jagte uns diese Freiheit auch ein bisschen Angst ein. Genießen ließ sie sich am besten in der Nähe unserer Freunde. Irgendwer hatte immer Zeit für ein Bier, irgendwo lief immer Musik und ein großer Topf verkochter Pasta stand auch meist auf einem Herd. Sonntags saßen wir stundenlang am Frühstückstisch zusammen. Wir aßen – viel Käse – und lachten und redeten über alles und nichts.
Das Märchen vom Studium als schönste Zeit des Lebens finde ich kitschig und zurück würde ich auch nicht wollen, dennoch vermisse ich dieses unendliche Beisammensein. Den Käsehobel in meiner Küchenschublade werde ich für immer verbinden mit der Wärme von Freundschaft und dem jugendlich-überheblichen Gefühl, auf Erden ewig zu währen. Nele Sophie Karsten
Folge 132: Das ungleiche Paar Handschuhe
Stolz bin ich nicht, wenn ich sie trage. Aber zumindest sind meine Hände warm, die linke in einem braunen Handschuh mit flauschigem Innenfutter, das sich leider langsam auflöst, und die rechte in einem schwarzen Handschuh, ohne besonderes Innenfutter. Es sind zwei billige Kunstlederprodukte, gekauft vor mehr als 25 Jahren, ich erinnere mich nicht mehr daran, wo. Der braune war zuerst da, er hatte einst ein gleichfarbiges Gegenstück. Das ist lange her. Der schwarze war auch mal zu zweit. Doch nun bilden sie zusammen eine schwarzbraune Schicksalsgemeinschaft.
Ich lasse nämlich ständig irgendwo irgendwas aus Versehen liegen, meistens im Zug oder in der S-Bahn: Kopfhörer, Jutebeutel, ganze Rucksäcke, Mützen, sogar Bücher bleiben manchmal zurück, und im Winter eben besonders häufig Handschuhe. Fast jedes Jahr verliere ich einen oder ein ganzes Paar, und ich habe es längst aufgegeben, mir hochwertige Stücke zu kaufen: Es lohnt sich ja doch nicht. Doch dann gibt es da diese beiden Handschuhe, die offenbar von einer höheren Macht geschützt werden. Sie sind unverlierbar.
Ich bin wirklich nicht abergläubisch oder sonst irgendwie spirituell. Aber die Beständigkeit, mit der die zwei abgewetzten Kunstlederteile seit 20 Jahren immer zur Stelle sind, wenn ich sie brauche, muss ich als Zeichen für irgendeine Art von kosmischer Ordnung sehen. Die beiden haben sich gefunden. Und mich. Dabei ziehe ich sie nur an, wenn mir nichts anderes übrigbleibt: Meine eigentlichen Handschuhe liegen im Lastenrad, mit dem gerade meine Frau unterwegs ist? Schwarz und braun sind zur Stelle. Ich muss in fünf Minuten am Bahnhof sein und kann meine schönen, neuen Handschuhe grad nicht finden? Schwarz und braun warten natürlich im Schrank. Nach dem Umzug sind leider alle meine Handschuhe noch in irgendwelchen Kartons? Nein, schwarz und braun sind – für mich völlig unerklärlich – bereits ausgepackt und warten darauf, angezogen zu werden. Jedes Jahr, wenn es warm wird, räume ich sie in den Keller und hoffe ein bisschen, dass ich sie im nächsten Winter nicht brauchen werde. Aber das passiert ja doch nie. Wolfgang Luef
Folge 131: Die Instant-Suppe
Sie ist zwar nur eine Suppe, aber da sie mich seit Jahrzehnten wärmt, ernährt und sogar Trost spendet, scheint das Wort Beziehung dann doch wieder zu passen. Einen Topf Wasser aufsetzen, kochen lassen, die Instant-Nudeln rein und das hocharomatisierte Pulver dazu schütten, nochmal aufkochen, fertig. Was gibt es Besseres nach fünf Stunden Zug mit zwei Stunden Verspätung, wenn man um halb eins durchgefroren und genervt doch noch zuhause ankommt? Oder nach dem Feiern? Oder wenn das Kind »JETZT!« Hunger hat? Wer mehr Muße hat, verfeinert mit Frühlingszwiebeln, Pilzen und Ei. Ich kaufe ständig asiatische Nudelsuppen und probiere viele aus – sei es im Urlaubssupermarkt, im deutschen Asiashop, im Internet. Die Beste ist die »Saimin«-Suppe von Longlife. Gibt’s im niederländischen Onlinesupermarkt orientalwebshop.nl, wo man übrigens auch allerhand andere spezielle asiatische Lebensmittel bekommt. Allein der Reiter »Kruiden«, also Kräuter, ist ein tagesfüllender Spaß. Produkt finden, in den »winkelwagen« legen und »nu bestellen en betalen« – kriegt man auch mit Deutschkenntnissen ganz gut hin. Lara Fritzsche
Folge 130: Bibi Blocksberg
Ich bin 34 und ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich zum Einschlafen immer noch wahnsinnig gerne Bibi Blocksberg höre. Seit Kindertagen begleitet mich die kleine Hexe aus Neustadt. Und auch wenn die Hörspiele objektiv betrachtet keine besonders gute Einschlafatmosphäre kreieren – sie sind weder monoton noch langweilig, es wird oft laut geschrien, Fensterklirren, Hex-Hex, Pling-Pling, all die wirklich komischen Sprüche wie »Na hör mal!« oder »Ach papperlapapp« – es funktioniert einfach. Es ist, als wäre es ein uraltes Programm in meinem Kopf, was anspringt, sobald das Bibi Blocksberg-Lied angeht. Sieben Minuten bis zum Tiefschlaf.
Meine Lieblingsfolgen: »Im Dschungel«, »In der Ritterzeit«, »Als Prinzessin«. In der Weihnachtszeit natürlich »Die Weihnachtsmänner«. Meine Schwester und ich hatten früher einen richtigen Kassetten-Koffer und es gab eine Zeit, in der wir wirklich alle bis dato rausgekommenen Bibi Blocksberg-Kassetten darin versammelt hatten. Immer, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, durften wir uns eine neue Kassette wünschen und haben sie dann im Auto mit unseren Eltern gehört. Ich glaube, diese Urlaubsfahrten und der Wunsch meiner Eltern nach Abwechslung waren auch der Grund, warum ich irgendwann eine Kassette von Die drei ??? bekam. Aber keine Chance, viel zu gruselig für mich.
Diese typische Neustadt-Atmosphäre mit den immergleichen Charakteren, die teilweise sehr lustige Probleme haben, beruhigt mich hingegen. Manche Geschichten sind nicht gut gealtert, das muss ich zugeben. Aber der Hauch von Kindheit, die damit verbundene Geborgenheit, und die Wuseligkeit der Geschichten bringt mich und mein Gedankenkarussell sehr zuverlässig dazu, innenzuhalten.
Das Schöne ist, dass mich diese Atmosphäre wirklich überall abholt, einen Kassettenrekorder brauche ich dank Spotify auch schon lange nicht mehr. Zu Hause, in Hotelzimmern – oder im Zelt eines Surfcamps. Ich war mit ein paar Freundinnen dort und unserer Surflehrer erzählte eines morgens, dass ganz in seiner Nähe seines Zelts scheinbar ein Kind immer Bibi Blocksberg zum Einschlafen hört, das Hex-Hex sei immer so laut. Nun ja, ich habe zugegeben, dass das aus meinem Zelt kommt. Etwas, was ich mit 34 Jahren endgültig gelernt habe: Sieben Minuten bis zum Tiefschlaf sind einfach ein unschlagbares Argument. Dana Packert
Folge 129: Die Sitzheizung
1997 habe ich meinen Führerschein gemacht, aber erst seit 2024 habe ich ein Auto mit Sitzheizung – 27 verschenkte Jahre! Hätte ich gewusst, wie großartig, tröstend, fast lebensrettend so ein beheizter Fahrersitz ist, hätte ich schon als Schüler alles Geld zusammengekratzt, um damals in meinen uralten VW Polo so ein Ding nachträglich einzubauen.
Schon seit 1966 gibt es Sitzheizungen – auch die PKW meiner Kindheit hätten also warme Sitze haben können, aber ich mache meinen Eltern (fast) keinen Vorwurf. Denn die Sitzheizung wird eigentlich nie irgendwo beworben – dass es weder Songs noch Gedichte noch Hymnen über die Sitzheizung gibt, ist mir rätselhaft. Dabei hat sie für mich therapeutische Wirkung. Wenn die Welt düster, kalt und grau ist: Sitzheizung auf Max. Wenn der Rücken zwickt, man erkältet ist: Sitzheizung auf Max. Die Radionachrichten beginnen mit Trump, Wirtschaftskrise oder Putin? Sitzheizung auf Max. Schon nach Sekunden spüre ich leichte Wärme im Rücken, am Po, an den Beinen – in der Seele.
Keine zwei Minuten und es ist richtig warm, fast heiß. Erstaunlich, wie geborgen, beschützt, umarmt ich mich fühle von so ein paar Heizdrähten unterm Sitzpolster. Als würde jemand sagen: »Alles wird gut.« Und ja, in meiner Beziehung ist alles ok, ich werde auch daheim umarmt, sehr schön, aber die Sitzheizung ist immer für einen da und für Stunden. Sie schaltet sich zwar nach etwa zehn Minuten von Maximal auf Medium, lässt sich aber direkt wieder auf Max umstellen. Ihre Wärme ist fast grenzenlos und fordert keine Gegenleistung, außer Benzin wohl (ich traue mich nicht, herauszufinden, wie sehr die Heizung den Verbrauch erhöht).
Besonders schön ist die Sitzheizung auf Fahrten alleine durch kalte, melancholische Winternächte. Aber meine Familie schaltet die Sitzheizung mittlerweile selbst im August ein – Frau und Kind sind ebenso große Fans. Erst 20 Grad frühmorgens auf dem Weg zur Schule? Sitzheizung an!
Jetzt, im Januar, ist Sitzheizung-Hochsaison. In unserem Auto sind leider nur die Vordersitze beheizt, wer hinten sitzt (Kind, Hund), hat verloren. Wobei das Kind gerne zum Auto rennt und einfach als Erster am Beifahrerplatz einsteigt. Wir sind sitzheizungssüchtig, befürchte ich. Ich habe neulich gegoogelt, ob man Bürostühle beheizen kann. Marc Baumann
Folge 128: Der Jutebeutel
Ohne jemals die Grünen gewählt zu haben, laufe ich seit Jahren mit einem Jutebeutel durch die Gegend, auf dem sich ein Frosch und eine Schildkröte einen Kuss geben, darunter der Schriftzug: »Schützt unsere Umwelt!« Offen gestanden handelt es sich gar nicht um einen Jute-, sondern einen Baumwollbeutel, aber aus irgendeinem Grund, den ich mir nicht erklären kann, sagen alle Jutebeutel dazu.
Ich kann mich nicht erinnern, wie diese Stofftasche in meinen Besitz gekommen ist, gekauft habe ich sie definitiv nicht. Ich gehe davon aus, dass jemand etwas, ein Buch oder einen Kochtopf vielleicht, in ihr zu mir transportiert und sie dann vergessen hat. Irgendwann muss ich sie das erste Mal benutzt und liebgewonnen haben, jedenfalls habe ich sie danach jahrelang zu Terminen und auf Reisen mitgenommen, um mein Notebook, meinen Notizblock sowie einige Kaugummis und Stifte darin zu verstauen. Ich war mit dieser Tasche in Brasilien und Indien, in Ruanda und Vietnam, in Indonesien und Hongkong, wo sie mich zur Cocktailparty in die herrschaftliche Wohnung des deutschen Generalkonsuls begleitet hat – ein Abend, an dem ich intensiver als sonst darüber nachdachte, was eigentlich mit meinen Steuern alles so geschieht. Es ist immer so bei mir: Wenn ich einen Gegenstand über mehrere Jahre benutzt habe, möchte ich nicht mehr auf ihn verzichten, ja manchmal fühlt es sich an, als wäre er zu einem Teil von mir geworden. Ich bin ein sentimentaler Mensch, kann schlecht Abschied nehmen, schwer loslassen. Mein letztes Auto habe ich so lange gefahren, dass ich es am Ende für 50 Euro an einen zwielichtigen Händler verscherbelt habe; selbstverständlich kaufe ich Schallplatten und CDs.
Dabei ist dieser Stoffbeutel nicht einmal praktisch, im Gegenteil, er ist ganz und gar unpraktisch. Es gäbe wesentlich sinnvollere, rückenschonendere Umhängetaschen, womöglich mit Zwischenfächern oder Reißverschlüssen. Bei Regen wird mein Notebook nass, wenn ich ihn mit einer Reisetasche oder einem Rollkoffer kombiniere, binde ich ihn umständlich an das größere Gepäckstück, so dass er beim Gehen hin- und herbaumelt. Aber all das hat mich nie so gestört, dass ich auf eine andere Tasche umgestiegen wäre. Irgendwann ging es freilich nicht mehr. Die Tasche hatte Löcher und hässliche braune Flecken, beim Gehen verlor ich Stifte, die Träger saßen nicht mehr hundertprozentig, irgendwann würden sie reißen. Ich legte die Tasche schweren Herzens zur Seite, denn wegwerfen, das konnte ich mir nicht vorstellen. Danach versuchte ich es eine Weile mit einer anderen, aber es war nicht dasselbe.
Und dann passierte etwas Wundervolles: Ich hatte im Sommer Geburtstag, der fünfzigste. Mein Gott, was habe ich alles bekommen, Bargeld, Champagner, Bücher, Ausflüge, Gutscheine. Und dann lag da auf meinem Gabentisch auf einmal diese Tasche, nur eben in neu. Da waren sie wieder, meine zwei Freunde, der Frosch und die Schildkröte. Ich war gerührt, ich war fassungslos. Ein ganz besonderer Mensch hatte sie mir geschenkt, ohne dass ich ihm jemals ausführlicher von meinem Verhältnis zu ihr erzählt hatte. Es war nur so, dass er sie auf alten Reisefotos entdeckt hatte und irgendwie lustig und großartig fand. Und dann habe sie (denn selbstverständlich handelte es sich um eine Frau) eben gedacht, dass diese Tasche ein tolles Geschenk sein könnte, und was soll ich sagen, über keines habe ich mich mehr gefreut. Tobias Haberl
Folge 127: Der Milchaufschäumer
Wenn ich abends ins Bett gehe, gilt mein letzter Gedanke oft dem Kaffee, den ich mir in ein paar Stunden machen werde. Und selbst wenn ich am nächsten Morgen viel zu früh aufstehen muss, wenn es draußen dunkel und in der Wohnung kalt ist, stört mich das nicht: Ich kann ja endlich wieder Kaffee trinken! Es gibt keinen besseren Grund, das Bett zu verlassen.
Genau genommen geht es um Milchkaffee. Der bittere Kaffee und die süße, weiche Milch – das ist eine der besten Geschmackskombinationen, die der Mensch ersonnen hat: warm, sanft, tröstend. Dafür ist ein guter Milchschaum wichtig. Den mache ich seit einem Vierteljahrhundert mit demselben Milchaufschäumer: einem kleinen Topf samt Stempelsieb, das man auf und ab bewegt. Elektro-Quirls oder die Dampfdüsen an Siebträgermaschinen erzeugen oft einen zu grobporigen Schaum. Der aus meinem Topf ist perfekt. Fein und cremig, an jedem Morgen wieder.
Das Ganze funktioniert nur, wenn die Milch eine gewisse Füllhöhe hat. Deswegen macht man eigentlich immer mehr Schaum, als man für eine Tasse bräuchte. Aber das ist ja nur ein weiterer Vorteil: So wird man sanft überredet, noch einen weiteren Kaffee zuzubereiten, für sich selbst oder, noch besser, für einen Mitmenschen. Gekauft habe ich den Topf für meine erste WG. Ein großer Freundschaftsbeweis bestand darin, sich morgens einen Milchkaffee ans Bett zu bringen. Die WG bestand 15 Jahre. Vielleicht auch wegen des Milchaufschäumers. Jakob Schrenk
Folge 126: Der hässlichste Weihnachtsbaum
Ich freue mich jedes Jahr auf Weihnachten, und jedes Jahr fürchte ich mich vor Weihnachten. Weil ich mir an dem Tag wünsche, das alles in meinem Leben gut ist. Aber wann ist im Leben denn alles gut? Ich vermisse Menschen, die nicht mehr da oder zu weit entfernt sind. Ich spüre manchmal mehr Angst als Zuversicht, wenn ich an die Zukunft denke. Und ich spüre diese Widersprüche in mir, wenn ich in den Wochen vorher an Weihnachten denke.
Es gibt aber eine Weihnachtstradition, die mir hilft, die Widersprüche besser auszuhalten: Ich kaufe mir grundsätzlich den hässlichsten Weihnachtsbaum, den ich finden kann. Ich verbringe Stunden damit, mit meinem Mann die Stände abzuschreiten und zu perfekte Bäume auszusortieren. Die dickbauchige Edel-Tanne findet mit ihren kräftigen Zweigen bestimmt ein Zuhause. Ich will hingegen den Baum finden, der ohne meine Liebe für Krummes übrig bleiben würde.
Seit Jahren tragen mein Mann und ich also einen windschiefen, verdörrten oder halbseitig kahlen Baum nach Hause. Dann umwickeln wir ihn mit einer Lichterkette und schmücken die Äste mit den wenigen Kugeln, die sie tragen können. Und wenn wir an Weihnachten auf den krummen Baum mit festlicher Dekoration schauen, erinnere ich mich daran, dass im Leben wirklich nichts perfekt sein muss, weil das Unperfekte so viel rührender ist.
Ich liebe das schiefe Lächeln meines Mannes, das alles so leicht werden lässt in mir. Ich liebe es, auf dem viel zu harten Schlafsofa meiner Großmutter zu übernachten und sie am nächsten Morgen Kaffee kochen zu hören, wenn ich mit Rückenschmerzen aufwache. Ich liebe es, in zu kaltes Wasser zu waten und ich liebe, wie gut eine meiner Freundinnen über Ungerechtigkeiten schimpfen kann.
Es mag nur ein Baum sein, aber ich finde die Erinnerung daran sehr wichtig: Das Leben ist nicht schön, weil es perfekt ist. Sondern weil es unperfekt ist. Dorothea Wagner
Folge 125: Die NEIN-Kette
Ich habe eine goldene Kette, so wie Carrie Bradshaw aus Sex and the City. Bei mir baumelt nicht mein Name um den Hals, sondern »NEIN«. Die Buchstaben sind nicht verschnörkelt, statt Schreibschrift sind es vier Blockbuchstaben, allesamt groß, so wie damals die Kette des Modern Talking-Sängers Thomas Anders, der als Liebesbeweis eine »NORA«-Kette trug. Den Namen seiner Freundin. Eine Liebeserklärung, das ist meine Kette auch.
Auf sie werde ich immer wieder angesprochen. Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich, fast gegensätzlich. Ein Nein polarisiert. Da gibt es die, die sie überhaupt nicht gut finden. »Ganz schön negativ«, kommentierte mal ein Bekannter. Nein, meinte eine Kollegin, sei das erste Wort ihres rebellischen Sohnes gewesen.
Ich glaube, dass diejenigen, die so abwehrend reagieren, Nein-Sager sind, die gerne mehr Ja-Sager wären. Und es gibt die, die meine Kette am liebsten gleich selbst anlegen würden. Das sind Ja-Sager, die nicht häufig genug Nein sagen. Zu denen zähle ich auch. Seitdem ich die Kette trage, habe ich das People Pleasing nicht vollständig abgelegt, aber ich bin definitiv besser geworden, Grenzen zu ziehen.
Eine kurze Zeit, das war 2018, wurde angenommen, dass die Kette Ausdruck von Aktivismus sei. Ein politisches Statement. Damals sollte das Polizeiaufgabengesetz in Bayern verschärft werden, Studierende der Münchner Kunstakademie bildeten die Polizeiklasse, organisierten Demos und Partys und druckten Sticker, auf denen »Nein« stand. In diesem Sommer klebte auf jedem zweiten Laptop oder Strommast im Univiertel ein »Nein«. Kein Wunder, dass man meine Kette damit in Zusammenhang brachte. Aber, nun, nein, das hatte nichts miteinander zu tun.
Die Kette löst eine Sehnsucht aus. Meiner Cousine habe ich zum 21. Geburtstag eine geschenkt. Etwa in diesem Alter habe ich auch meine bekommen. »Ich sag’s dir ehrlich, ich ziehe die wirklich nicht mehr aus, ich schlafe mit der, ich verbringe meinen Tag mit der und ich lebe mit ihr«, sagt sie. Was sie so gerne an ihr mag? Das »Nein«, sagt sie, sei ihre kleine, glänzende Rebellion. Stefanie Witterauf
Folge 124: Die Lost-in-Translation-DVD
Als Jugendliche verbrachten meine Freundinnen und ich viel Zeit auf einer Website, die heute kaum noch jemand nutzt: Tumblr. Man kann sie sich vorstellen wie Pinterest, aber statt einer eigenen Pinnwand hatte jeder Nutzer ein Blog, das er mit Fotos, Videos und Zitaten füllte, aus Filmen, Serien, Songs, Büchern. Um welche zu finden, die uns gefielen, scrollten wir dort ewig durch ebensolche Einträge. Als ich 14 oder 15 war, stoppte ich bei einem Foto von einer jungen Frau, sie sitzt auf einer tiefen Fensterbank vor einer riesigen Fensterfront, die Beine zu sich herangezogen. Aus einem schwindelerregend hohen Stockwerk blickt sie auf eine Stadt. Es war Scarlett Johansson in einer Szene des Films Lost in Translation von Sofia Coppola. Irgendwas an dem Foto faszinierte mich. Also kaufte ich mir die DVD.
Eigentlich kann ich Filme nicht mehrmals gucken. Diesen könnte ich wahrscheinlich jeden Abend ansehen. Vielleicht ist es die oft schleichende Erzählweise, vielleicht die Wucht von Tokio, auf das Johannson aus dem Fenster sieht, vielleicht die Orientierungslosigkeit, die alle Charaktere in sich tragen. Vielleicht auch das Gefühl, in der Jugend etwas zu entdecken, das exakt den eigenen Geschmack trifft, obwohl man bis dahin noch gar nicht wusste, was ihn ausmacht.
Die DVD steht noch heute eingereiht neben meinen Büchern. Obwohl ich schon lange keinen Laptop mit CD-Laufwerk mehr besitze, keinen DVD-Player oder irgendein anderes Gerät, dass den Film abspielen könnte. Brauche ich auch nicht. Ich muss nur die Verpackung sehen und die erste Szene läuft in meinem Kopf. Trisha Balster
Folge 123: Der Norwegerschal
Mein liebstes Winteraccessoire ist 170 Zentimeter lang und hat ein Norwegermuster. Und obwohl der Schal nun schon seit 30 Jahren in meinem Kleiderschrank hängt, gehört er nach wie vor Christina. Wenn mich in der Vergangenheit das schlechte Gewissen plagte, weil ich mir ihren Schal ausgeliehen und nie zurückgeben hatte, beruhigte ich mich damit, dass sie ja zum Glück nicht nachtragend sei. Meine Freundin hatte den Kopf voller Ideen und meistens blendende Laune. Ich dagegen war schüchtern, ruhig, und, ich gebe es zu, ziemlich modeversessen. Als Christina also mit ihrem neuen, bunten Schal in die Schule kam, war es gleich um mich geschehen: Limonengrün, maisgelb, petrolblau, türkis, rot und auberginelila leuchtete er gegen das Grau des Wintermorgens an. Und anders als manche Erinnerung sind seine Farben nie verblasst.
Den Schal einfach nachzukaufen, fand ich mit 19 uncool. Umso mehr freute ich mich, als Christina mir anbot, ihn auszuleihen. Meine Freundinnen und ich machten das oft. Weil wir die Klamotten von anderen grundsätzlich toller fanden als die eigenen, kamen unsere Jacken, Pullis und T-Shirts in den Neunzigerjahren ganz schön herum. Dass der Schal nicht zu Christina zurückfand, war keine Absicht: Nach dem Abi zogen wir in unterschiedliche Städte, und wenn wir uns danach mal sahen, dann oft im Sommer, wenn Winterklamotten kein Thema waren. Über die Jahre hat sich der Schal mehrere kleine Löcher zugezogen. Trotzdem entfaltet er beim Tragen bis heute zuverlässig Superkräfte: Er verbindet mich mit einer Zeit, in der Liebeskummer maximal drei Tage dauerte und jede Party noch lustiger war als die davor. Ich fühle mich dann selbstbewusster, unbeschwerter, fröhlicher. Ein bisschen wie Christina. Franziska Gerlach
Folge 122: Die Bank
Die Bank ist eine von vielen an der Elbe, aber ich betrachte sie inzwischen als »meine Bank«. Wenig finde ich beruhigender, als dort aufs Wasser zu gucken, und wenig macht meinen Kopf klarer. Überhaupt bin ich eine von denen, die Wasser glücklich macht – irgendwann mal eine Weile am Meer zu leben, ist ein alter Traum von mir. Hat bisher leider nicht geklappt, aber dafür lebe ich jetzt schon ziemlich lange in Hamburg und dort in Altona, also: nahe der Elbe. Wobei »Elbnähe« vielleicht nach Villa am Elbufer klingt. In meinem Fall bedeutet es, dass man hinter vielen Häuserreihen die Spitze eines Hafenkrans sehen kann, wenn man sich aus dem Wohnzimmerfenster reckt. Immerhin! Ich bin jedenfalls in fünf Minuten am Wasser – was für ein Glück. Dort laufe ich seit vielen Jahren die immer gleichen Wege. Um kurz Luft zu tanken oder auch Sonne, wobei die in Hamburg nicht allzu oft scheint. Und auch, um meine Gedanken zu sortieren – was mich wieder zurück zur Bank bringt. Das erste Mal war es Zufall, dass ich mich hinsetzte, es ist jetzt schon fast zehn Jahre her. Ich grübelte seit Tagen über eine Sache und war seit Stunden an der Elbe herumgelaufen, aber noch immer hatte ich keine Lösung für mein Problem. Also setzte ich mich auf die Bank und guckte aufs Wasser. Und wusste irgendwann, was ich tun würde. Seitdem ist es zur Gewohnheit geworden, dass ich mich von Zeit zu Zeit auf die Bank setze, wenn ich Entscheidungen treffen muss. Oder auch nur so. Nicola Meier
Folge 121: Der Wäscheständer
Warum sagt man, wenn einen etwas stört, es sei einem »ein Dorn im Auge«? Viel besser wäre doch »ein Wäscheständer im Auge«. Gibt’s einen nervigeren Haushaltsgegenstand? Selbst in der Edel-Variante »Nussbaumholz mit handgewebter Alpaka-Leine« aus Reiche-Leute-Läden wie Manufactum bleibt ein Wäscheständer ein Gestell für Feinripp und Löcherjeans, für Sport-BH und Leggins, kurz: ein Trum mit Zeug dran, das im Weg steht. In engen Stadtwohnungen ist das nochmal augenscheinlicher als im Vorstadt-Eigenheim, wo man derlei Dinge in einen Hauswirtschaftsraum verbannen oder die Aufbewahrung zumindest mitplanen kann.
Unser Wäscheständer hängt von der Decke, er hat einen schönen weißen Holzrahmen und knallrote Schnüre und Seile, an denen er mittels Flaschenzugs bei Bedarf auf- und abgelassen werden kann. Es kam so: Eine Zeitlang war es eine Art Hobby von mir gewesen zu überlegen, wie man unsere Wohnfläche optimieren und Stauraum gewinnen kann. Abgehängte Decken, Küchenschränke bis nach oben – viele dieser Ideen muss man maßfertigen lassen, und Schreinern ist teuer. Die vielleicht einfachste Art, die Wohnfläche bestmöglich zu nutzen, ist der schwebende Wäscheständer. Man zahlt schließlich auch Miete für den Raum hoch über dem eigenen Kopf. Über der Badewanne, wie in unserem Fall.
Hängt keine Wäsche dran, scheppert das Gestell nicht hinter der Tür, wo seine Vorgänger ihr Dasein fristen mussten, um aus dem Weg und dem Sichtfeld zu sein, sondern hängt formschön in der Gegend rum. Mit etwas Geschick kann man sich den Wäscheständer aus Baumarkt- Materialien selbst bauen. Oder man kauft einen fertigen Bausatz. Dem Münchner Startup, von dem wir unseren haben, ist es gelungen, aus etwas Hässlichem etwas zu machen, das man gerne anschaut, und das seine Funktion auch noch besser als herkömmliche Modelle erfüllt. Wegen der Thermik trocknet die Wäsche unter der Decke merkbar schneller, und es schweben oben auch nicht so viele Staubpartikel wie in Bodennähe.
Nein, man muss nicht den Vermieter fragen. Ja, das geht auch bei abgehängten Decken. Nein, dadurch steigt nicht das Schimmelrisiko. Und: Man kann dem Kind gleich mal ein bisschen Physik erklären: Jede lose Rolle, guck hier, halbiert das Gesamtgewicht. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind noch beim Haarewaschen und: »Mama, ich hab Angst, dass das in den Augen brennt.« Ich sage: »Schau mal hoch und zähle alle unsere Unterhosen« – während ich in Ruhe den Schaum auswasche. Annabel Dillig
Folge 120: Der olivgrüne Parka
Der Parka hängt schon seit Jahren im Keller, in dem einen Schrank, in dem die ganzen Sachen lagern, die ich eigentlich nicht mehr brauche, von denen ich mich aber doch nicht trennen will. Es ist ein ganz normaler Parka in Olivgrün. Ich habe ihn vor Ewigkeiten in einem dieser komischen Army Shops gekauft, die es früher gab (was wurde eigentlich aus denen?), ich bin mir nicht mal mehr sicher, wo genau. Das Innenfutter ist inzwischen ziemlich zerfetzt, die Außentaschen löchrig, ein paar von den Knöpfen an den Ärmeln sind längst abgehauen, der Parka hat Flecken, ich werde ihn vermutlich nie mehr anziehen. Warum ich ihn trotzdem aufhebe? Weil ich ihn viele Jahre lang immer anhatte, wenn es darauf ankam, und er mir dann immer Glück brachte. Bei Job-Gesprächen (mit Parka: Job bekommen), bei schwierigen Reportagen (mit Parka: Dann doch genau die richtigen Leute gefunden), bei Dates (mit Parka: Wir haben uns bald wiedergetroffen). Ich würde immer behaupten, ich bin kein Mensch, der an Glücksbringer oder Amulette glaubt. Aber ja, wenn ich in meinen Kellerschrank schaue, muss ich zugeben, bin ich halt doch total. Mein Glücksbringer ist kein Stein an einer Kette, kein Armreif, mein Glücksbringer ist olivgrün und ziemlich zerknittert und macht seine Arbeit vom Keller aus. Ich muss ihn nicht mal mehr tragen, er sorgt auch von da unten für gute Schwingungen. Und wenn irgendwas in meinem Leben mal wirklich, wirklich schwierig werden sollte: Dann kann ich ihn ja wieder hochholen. Beruhigend. Max Fellmann
Folge 119: Der Diakoffer
Erst vor kurzem habe ich ihn wieder von einer Ecke in der Wohnung in die andere geräumt. Zum zigsten Mal. Im Keller war er auch schon ein Jahrzehnt, bis ich mich seiner erbarmte und ihn hoch in den Kreis der Familie holte. Jetzt befindet er sich auf dem obersten Fach meines Bücherregals, knapp unter der Zimmerdecke. Da kann er jetzt wieder zehn Jahre liegen, bis ich wieder an ihn denke. Er misst etwa 30 mal 15 Zentimeter und ist nur knapp 5 cm tief. Ein kleines Köfferchen aus Edelstahl, mit Tragegriff sogar. Darin: alte Dias meines Vaters aus einer Zeit, als Dias das Nonplusultra der Hobbyfotografen waren, also aus den Siebzigerjahren. Sie sind fein säuberlich in kleine Halteschlitze gesteckt, allerdings unsortiert. Sie zeigen meine sehr jungen Eltern, mich, wie ich einen Schlitten ziehe im Wald, Oma als Nikolaus verkleidet, solche Sachen.
Immer wenn ich den Diakasten aufmache, halte ich ein paar Dias gegen das Licht und denke, wie schön sie aussehen, welch kleines Wunderwerk sie sind, durchscheinende Miniaturen der eigenen Geschichte, kleine Fenster in die Vergangenheit. Das Problem mit den Dias ist, dass man einen Diaprojektor braucht, um sie in voller Farbenpracht zu bewundern. Solche Dias aus den Siebzigerjahren sehen eigentlich immer aus wie Fotos des amerikanischen Fotokünstlers William Eggleston. Die Farben knallen, alles ist in ein warmes, tröstendes Licht getaucht.
Als ich Kind war, hat der Vater eine Leinwand aufgebaut und dann surrte der Projektor. Mit jedem Klippklapp-Geräusch kam ein neues Bild. Für uns Kinder war so ein Diaabend ein feierlicher, inniger Moment. Ein Kino der Familie. Einen Diaprojektor besitze ich sogar. Flohmarktfund. Neulich holte ihn aus dem Keller, einen schweren, mechanischem Apparat. Ich brachte ihn nicht zum Laufen, schraubte ihn auf, bestellte ein neues Lämpchen im Internet. Er blieb schwarz. Schließlich bat ich einen Freund um Hilfe. Der sah sich das Ding kurz von allen Seiten an und knipste mit gezieltem Griff den unsichtbaren Kippschalter am Boden des Geräts an. Jetzt benötige ich nur noch die sogenannten Diakassetten, denn ohne die ist der Projektor nicht zu betreiben. Das wird mein Projekt für die nächsten Jahre. Hoffentlich finde ich dann den Diakoffer wieder. Thomas Bärnthaler
Folge 118: Das Küchenradio
»Do you really want to live forever?«, fragt das kleine Digitalradio. Hinten rechts in der Küche meiner Eltern, dort, wo die Küchenrolle hängen könnte, klemmt es. Es hat eine Antenne, die mein Bruder und ich als Kinder ein und ausfahren ließen – wir hofften auf einen noch besseren Empfang, um dann zu merken, dass es keinen Unterschied machte. Früher strahlend weiß, ist es heute vergilbt, das Kabel zur Steckdose immer ein bisschen verheddert. Die Uhrzeit stimmt nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie je gestimmt hätte.
»Forever?«, antwortet mein kleiner Bruder und sieht mich an, während er an dem Lautstärkeregler dreht. Der Sound ist blechern, das blaue Display zeigt die Frequenz von einem der vier Radiosender, die wir ohne Rauschen empfangen. Der runde Aux-Anschluss erinnert an die Zeit, als die Handys und iPods noch verkabelt waren – eine Zeit vor Spotify und einem Algorithmus, der mich heute mit immer gleich klingenden Liedern füttert. Damals lauschten wir im Halbstundentakt den Nachrichten im Wechsel mit flachen Moderatorinnen-Witzen und der neuen Single von Bruno Mars. Es ist zehn Jahre her, dass mein kleiner Bruder auf der Arbeitsfläche am Fenster saß und dabei zusah, wie ich Eier aufschlug, rührte und Teig in die Pfanne goss. Wir perfektionierten hauchdünne Crêpes und Werbesprüche von Bayern 3. Wir wussten, welches Müsli für Bergsteiger geeignet war, welches Möbelhaus den XXL-Schlussverkauf ankündigte und bei welchem Supermarkt freitags schon gespart werden konnte – »Framstag bei Penny« eben.
»Weißt du noch?«, hat mein Bruder gerade gefragt. Jetzt muss er nicht mehr auf der Arbeitsfläche sitzen, um mir in die Augen zu schauen. Er ist siebzehn und einen Kopf größer als ich. „Carglass repariert...” -
»Carglass tauscht aus.«
Wir grinsen wie die Kinder, die wir in diesem Haus immer bleiben werden. Die Küche ist kleiner geworden und der Horizont, der unsere Informations- und Musik-Auswahl bestimmt, auch. Wir leben in virtuellen Blasen. Ob im Auto oder unter der Dusche, auf dem Weg in die Arbeit und in der WG-Küche – wir hören Podcasts und Playlists, die uns gefallen. Wo hören wir noch Radio außer in der Küche meiner Eltern?
Hier werde ich überrascht von fremden Problemen und Meinungen – und Musik, über die ich den Kopf schütteln kann. Manchmal auch von JAY-Z, der fragt, ob wir den Moment leben wollen. »I wanna be forever young«, schreien wir der Welt zum Trotz, während wir auf den Fliesen tanzen, auf denen wir groß geworden sind. Lucia Theiler
Folge 117: Die Pileapflanze
Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen grünen Daumen habe. Es gibt Menschen, die mich um Blumengießdienst bitten, wenn sie in den Urlaub fahren, und ich habe viele Pflanzen – aber es kriselt eben auch manchmal mit ihnen. Dieses Jahr musste ich mich von einigen trennen, unter anderem einer Alocasia Zebrina, die einmal richtig groß war, aber in den letzten zwei Jahren nur noch geschrumpft ist und sehr traurig endete.
Aber es gibt eine Pflanze, die mich noch nicht enttäuscht hat (vielleicht habe auch ich sie noch nicht enttäuscht, das ist Ansichtssache): meine Pilea, eine Pilea peperomioides, um genau zu sein. Ich war gerade in eine neue Stadt gezogen und entdeckte sie in einem kleinen Laden. Sie war winzig, vielleicht fünf Blätter, jedes so klein wie ein 20-Cent-Stück, und dass sie so klein (und süß!) war, war das größte Kauf-Argument.
Sie war meine erste grüne Mitbewohnerin in meiner neuen, ersten richtigen Erwachsenen-Wohnung. Am Küchenfenster wuchs sie schnell aus ihrem kleinen Topf heraus, ich topfte sie um, irgendwann kamen kleine Mini-Pilea aus ihrem Stamm heraus, die ich abschnitt und großzog und verschenkte. Dann schoß sie richtig in die Höhe, war bestimmt 40 cm hoch – und brach eines Tages einfach ab. Es tat mir leid, sie so zu sehen – mein grüner Stolz und die Mutter aller Pilea.
Und dann lernte ich eine neue Superkraft dieser Pflanze kennen: Der entzweite Stamm lebt einfach weiter – in zwei getrennten Töpfen. Der untere Teil ist überwuchert von vielen kleinen Pilea, der obere Teil hat sich ein neues Fundament geschaffen – und wächst wieder.
Inzwischen werde ich die kleinen Ableger nicht mehr los, mein Freundeskreis ist wundersamerweise übersättigt von Pilea-Ablegern, also habe ich jetzt nicht nur die geteilte Mutter-Pflanze, sondern auch viele kleine Nachkommen. Sie sind so unterschiedlich, wie Kinder es auch sind: Manche wachsen schnurgerade nach oben, manche in einer lustigen Kurve vom Regal herunter, manche haben irre lange Stängel, manche schon große runde Blätter und manche strahlen mich wie kleine Sonnen mit ausgestreckten Armen an, als möchten sie »Guten Morgen!« rufen.
Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob ich einen grünen Daumen habe – aber was ich habe, ist eine kleine, unverwüstliche Pilea-Familie, die mir genug verzeiht, damit wir hoffentlich noch lange zusammenleben können.
Folge 116: Die Pfeffermühle
Ich weiß gar nicht, wie lange ich meine Pfeffermühle schon habe. Zwanzig Jahre, vielleicht sogar dreißig? Den Mann, der sie fertigt, kenne ich jedenfalls schon seit frühester Jugend. Moose ist mein Freund. Sein eigentlicher Beruf ist KFZ-Elektriker, er repariert Autos. Irgendwann hat er angefangen, lustige Dinge zusammenzuschweißen, Lampen zu entwerfen und dann eben Pfeffermühlen zu bauen. Die Freundschaft zu ihm wäre noch lange kein Grund für mich, seine Mühlen zu lieben. Natürlich finde ich die Form schön. Ein Zylinder mit einem schwarzen Punkt oben, wenn man den oberen Teil dreht, taucht eine Öffnung auf, durch die man die Pfefferkörner einfüllt. Auf dem Deckel ein Bügel, den man dreht, damit unten der Pfeffer rauskommt. Natürlich finde ich die Mühle auch praktisch. Ich fasse sie auch gerne an. Edelstahl mit zwei verschiedenen Oberflächen, feingeschliffen und »trovaliert«, aber ich habe mir immer noch nicht gemerkt, was das heißt. Ich kaufe immer nur feingeschliffen. Ja, ich verschenke sie auch regelmäßig. An meine Kinder, die engsten Freunde, meine Freundin, meine Ex-Frau, zu Geburtstagen oder Hochzeiten. Es ist ein schönes Geschenk, alles andere als preisgünstig. Die Materialien werden ständig teurer, sagt Moose. Ich hätte von Anfang an zwanzig, dreißig kaufen sollen, um stets Geschenke auf Reserve zu halten. Naja. Der wahre Grund, warum ich meine Mühle so liebe, dürfte sein, dass ich mich zuhause fühle, wann immer ich sie sehe. Andere haben dafür das Bild eines röhrenden Hirsches über dem Sofa hängen, ich habe meine Pfeffermühle in der Küche stehen. Lars Reichardt
Folge 115: Die fliederfarbene Tasche
Es gibt Dinge, die nach Oma und Opa riechen. Nach frisch gebratenen Reibekuchen, Traubenschorle, „Mensch ärgere dich nicht" an verregneten Nachmittagen oder dem feuchten Gras beim Ostereiersuchen im Garten. Für mich ist auch die fliederfarbene Tasche meiner Oma eines dieser Dinge.
Die Oberfläche der Tasche besteht aus großen, lilafarbenen Kreisen, die sich wie Schuppen überlappen. Der Griff ist dick und mit Holzkugeln geschmückt - als hätte Oma eines ihrer Perlenarmbänder recycelt und einfach drangehängt. Abgesehen von ihrem 70er-Jahre-Charme ist das eigentlich Bemerkenswerte an dieser Handtasche, dass sie extrem unpraktisch ist. Sie ist zu klein für meinen Laptop, aber zu groß, um nur Handy, Portemonnaie und Lipgloss mitzunehmen. Außerdem droht der Henkel jeden Moment abzufallen und schon von weitem hört man mich damit ankommen, weil die Kugeln aneinander klackern. Auch das grelle Lila ist keine Farbe, die sich leicht kombinieren lässt. Doch genau deswegen liebe ich diese Tasche. Sie ist kein Gegenstand, der mein Leben einfacher macht, sondern einer, der mich an meine Oma erinnert. An ihr lautes Lachen, an ihr wiederkehrendes »Ach, nimm einfach alles mit, was du auf dem Dachboden findest« und an ihren auffälligen Modestil. Jedes ihrer Outfits wurde von der passenden Tasche begleitet. Auch eine große, imposante Kette durfte nie fehlen. Ich denke, dass ich ihretwegen bis heute hin und wieder zu auffälligen Statement-Pieces greife. Ihr Stil hat mir früh gezeigt, dass Mode Spaß machen darf.
Ich trage die Tasche oft, und jedes Mal fühlt es sich an, als würde ich ein kleines Stück meiner Oma bei mir tragen. Als säße sie lächelnd neben mir, voller Freude, dass ich ihrer alten Tasche neues Leben eingehaucht habe. Felicia Schamuhn
Folge 114: Das Hackebeilchen
Meine Großmutter starb, kurz bevor ich auszog. Als jüngste Enkelin übernahm ich dankbar ihren ganzen Haushalt. Ich schraubte die Küchenunterschränke ab, baute sie in meine erste Wohnung ein und legte alles, was darin enthalten war, zurück in die Schubladen. Darunter war ein Wetzstahl, der aussieht wie ein Dolch, und ein winziges Hackebeilchen, das nicht länger ist als ein Gemüsemesser. Die Klinge misst nur sechs Zentimeter.
Ich konnte meine Omi nicht mehr fragen, was sie mit dem Hackebeilchen eigentlich gehackt hat. Aber jedes Mal, wenn ich die Küchenschublade öffne und das Beilchen dabei in seinem Kästchen verrutscht, weil es keinen Besteckkasten gibt, in die so eine Art Werkzeug passt, denke ich daran, wie sie erzählte, dass sie als junge Frau einmal ein Huhn geschlachtet hat. Es war Krieg, sagte sie, und es musste nunmal sein. Also griff sie das flatternde, gackernde Ding, drückte es auf den Schlachtklotz und hackte ihm den Kopf ab. Doch das Huhn sprang auf, kopflos, und lief einfach davon. Ich habe das als Kind nicht in Frage gestellt, jetzt aber habe ich doch mal gegoogelt und es ist tatsächlich wahr, Hühner können auch ohne Kopf noch kurz weiterleben. Die Neuronen im Rückenmark feuern weiter, solange Sauerstoff vorhanden ist. Manchmal ist auch einfach noch ein Teil vom Hirn dran, das sitzt bei Hühnern recht tief im Nacken.
Wenn ich heute das Hackebeilchen am Wetzstahl schärfe, bin ich dankbar, dass ich nie ein Huhn töten musste, dass ich einen Kühlschrank habe, dass ich in jedem Supermarkt Tofu kaufen kann. Manchmal denke ich daran, dass die Bedrohungen, mit denen meine Großmutter lebte, realer waren als meine, es waren analoge Ängste, die man im Körper spürte, wie Hunger oder Ekel. Wenn ich schlecht Luft kriege oder mir übel wird, weil ich ängstlich bin, weiß ich manchmal gar nicht, warum. Die Auslöser sind unsichtbarer geworden. Sie marschieren nicht durch meinen Hinterhof, eher durch meinen Hinterkopf. Meine Großmutter hätte gesagt »Mach dir keen Kopp«. Irgendwie geht das oft nicht. Aber eines beruhigt mich immer: Kochen.
Meine Mutter sagt, das Beilchen eigne sich sehr gut, um Suppenhühner zu zerlegen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch kein ganzes Suppenhuhn gekauft. Höchstens Hähnchenbrustfilet aus der Frischetheke. Trotzdem liebe ich das Beilchen. Ich hacke damit am liebsten Petersilie. Die streue ich dann über meine Möhrensuppe und denke daran, dass mir die Hühnersuppe von meiner Oma jetzt eigentlich lieber wäre. Lisa McMinn
Folge 113: Die Probiergrößen
Meistens bekomme ich sie von der Apothekerin, manchmal von der Friseurin: kleine Tuben oder Tiegel mit einer Creme oder Spülung, die ich mal ausprobieren soll. Oder noch öfter: mit der Creme oder Spülung, die ich gerne verwende. Denn sie wissen, dass der wahre Zweck von Probiergrößen für mich nicht ist, Neues zu entdecken, sondern Altbekanntes mit auf Reisen nehmen zu können.
Ich freue mich jedes Mal. Und dann sammeln sich die kleinen Tuben und Tiegel in meinem Regal, bis ihr Inhalt schlecht wird. Denn meistens sind sie mir zu schade, um sie anzubrechen. Ach, denke ich, wenn ich mit dem Zug verreise, kann ich doch das große Shampoo einpacken. Ach, in meinem Rucksack ist doch noch Platz für die normale Cremedose, ich hebe die kleine auf, bis ich sie wirklich brauche. Schön doof.
Es ist wie mit den zierlichen Vintage-Cocktailgläsern, für die mir der Anlass selten gut genug ist, oder meinem Lieblingspulli, den ich im Homeoffice nicht trage. Viel zu oft warte ich auf den richtigen Zeitpunkt – und mache alltägliche Momente so kleiner, als sie sein müssten. Manchmal warte ich sogar so lange, dass die Dinge, die ich bewahren wollte, ihren Zauber verlieren – bis die Kosmetik abgelaufen ist und der Pulli mir gar nicht mehr so gut gefällt.
Letztens habe ich wieder einmal aussortiert. Die Probiergrößen, die noch gut waren, werden nun im Nachtzug mit mir nach Ungarn, Rumänien und Kroatien fahren, egal, wie leer der Koffer ist, einfach, um mein Leben in dem Moment ein bisschen besser zu machen. Ich werde neue geschenkt bekommen. Und manche der Behälter kann ich sogar nachfüllen. Mit einem kleinen Gesichtswasser-Fläschchen mache ich das schon so. Agnes Striegan
Folge 112: Die Kastanien
Meine Großmutter war eine nüchterne und dennoch lustige Person, die stets einen flotten Spruch auf den Lippen hatte. Wenn sie eines nicht war, dann abergläubisch. Zur Verwunderung meiner Mutter und mir glaubte sie jedoch, dass es Glück bringe, wenn man immer ein paar Kastanien in seinen Taschen mit sich herumträgt. Als ich im Teenager-Alter war, erzählte mir meine Mutter davon und zog eine Kastanie aus ihrer Tasche, um sie mir zu zeigen. Dann verstaute sie die Kastanie wieder fein säuberlich in ihrer Tasche, dass sie ihr auch ja Glück bringe. Ich übernahm diesen Brauch und konnte es kaum abwarten, bis es Herbst wurde und ich meine Taschen mit glückbringenden Kastanien füllen konnte. Diese Tradition besteht bei den Frauen in unserer Familie also generationsübergreifend und wir stellen das gar nicht mehr in Frage, so selbstverständlich sind die Kastanien schon in unseren Taschen. Im Herbst kommt gelegentlich eine frische, noch glänzende Kastanie hinzu, die in den Untiefen unserer Taschen mit der Zeit hutzelig wird. Meine Großmutter ist vor ziemlich genau zehn Jahren gestorben. Manchmal, wenn ich eine besonders hutzelige Kastanie in einer meiner Taschen finde, stelle ich mir vor, dass sie schon zu ihren Lebzeiten darin lag. Das gibt mir ein warmes Gefühl in der Brust. Katrin Börsch
Folge 111: Die Papirossa-Zigaretten
Alle wollten westwärts, was Sprachen anging. Eine Woche Französisch, aber in Frankreich, im Austausch. Ein Sommer lang Englisch, aber in England, als Sprachschüler. Ein einziger von uns Freunden wandte sich damals, Anfang der 1990er Jahre, als auf einmal die ganze Welt offenlag, nach Osten. Er ging über die Fachoberschule in die Sowjetuni... – nein, damals hatte sich die Sowjetunion gerade aufgelöst: Nach Russland ging er. Russland, das klang damals nach Aufbruch, einem neuen Anfang, einer großen Chance für Frieden, Demokratie, Freiheit. Als er vom Abenteuer dieses Austausches zurückkam, brachte er für jeden von uns ein Geschenk mit – eine Packung Papirossa, mit grobem Machorka gefüllte Zigaretten, Marke »Belomorkanal«. Die Packung enthielt 25 Stück. Die erste dieser Ungetüme probierten wir gleich, eine extreme Erfahrung, weil der Tabak schwindelerregend stark war. Seitdem überdauert die Packung in meiner Schreibtischschublade. Ich habe es bis heute nicht übers Herz gebracht, sie wegzuwerfen, keine Ahnung, warum. Aber wer weiß, vielleicht stecke ich mir eine an, wenn Russland wieder nach Frieden, Demokratie, Freiheit klingt. Roland Schulz
Folge 110: Die Fossilien
In den Augen meiner Freundin sind meine Fossilien nur drei Gesteinsklumpen. Sie wiegt sie in den Händen, streicht über ihre geriffelten Oberflächen und legt sie schleunigst zurück ins Regal. Ich bereue fast, sie ihr gezeigt zu haben, denn für mich sind diese drei Ammoniten mit ihren geschneckten Strukturen nicht nur Zeugnisse prähistorischen Lebens, für mich stoßen sie auch das Tor in meine Kindheit auf. Solange ich denken kann, lagen die Fossilien bei meinen Großeltern in der Vitrine, streng bewacht von meinem Großvater, einem zurückgezogenen Mann, der mit großer Andacht seine Leidenschaften pflegte: Fossilien, Münzen, Briefmarken, seine Modelleisenbahn, außerdem züchtete er in seinem norddeutschen Garten riesige Agaven. Ich sehe ihn genau vor mir, im Dreiteiler am Esstisch sitzend, in der Hand eine Lupe, wie er die Fossilien untersucht, mir erklärt, wie alt sie sind, wo sie herkommen, wie sie bei ihm gelandet sind. Hätte ich ihm nur besser zugehört! Wie gern wüsste ich all das jetzt, wo die Fossilien nach dem Tod meiner Großeltern bei mir gelandet sind. Ich dachte immer, mein Onkel würde sie bekommen, der ist Geologe. Er wollte sie nicht. Ich wollte sie unbedingt. Eben weil sie von Vorzeiten erzählen, den Vorzeiten der Menschheit, den Vorzeiten meines Großvaters und auch von meinen eigenen – von den Zeiten nämlich, in denen wertvolle Stunden mit meinen Großeltern für mich Alltag waren und nichts, was ich versteinern und für die Ewigkeit haltbar machen möchte. Was für schöne, unbeschwerte Zeiten. Mareike Nieberding
Folge 109: Die Gartenschere
Über das Gärtnern ist wahrscheinlich alles schon längst gesagt, nur noch nicht von jedem. Im deutschsprachigen Raum ist die Frankfurter Schriftstellerin Eva Demski das Maß aller klugen Garten-Gedanken. Sie schreibt ganz grundsätzlich über das Pflanz- und Buddel-Glück: »Der Garten ist der letzte Luxus unserer Tage, denn er fordert das, was in unserer Gesellschaft am kostbarsten geworden ist: Zeit, Zuwendung und Raum.« Und über sich selbst und zugleich über viele von uns Gartenbuchbesitzer: »Inzwischen habe ich genug Gartenratgeber gelesen oder auch nur gekauft und ins Regal gestellt, dass mein Bedarf an Literatur, die mich sachlich beim Gärtnern unterstützt mehr als gedeckt ist. Ich weiß welche Pflanzen essbar sind – und kaufe den Salat dann meist doch beim REWE.«
Außer Demski verehre ich noch Niwaki. Das ist eine vor fast zwanzig Jahren von einem Engländer gegründete Firma, die japanische Gartenwerkzeuge herstellt. Sieht alles fantastisch aus, japanisches Design halt. Die Newsletter sind mit viel Schwung geschrieben, englischer Humor halt. Die für mich beste Gartenschere aller Zeiten: Niwaki GR Pro Secateurs – es gibt sie für Rechts- und für Linkshänder. Der Onlineshop von Niwaki ist toll, aber die Zollgrenze zwischen EU und England führt leider zu langen Lieferzeiten und hohen Nebenkosten. Doch gar nicht so selten finden sich Niwaki-Scheren auch in deutschen Gartengeschäften. Sofort für sich selbst kaufen oder für ein Geschenk zusammenlegen, es wird ewig halten. Timm Klotzek
Folge 108: Der Lidstrich
Ich schminke mich nicht gerne. Nicht, weil ich nicht möchte, ich kann es einfach nicht. Und selbst, wenn es jemand anderes bei mir macht, jemand, der weiß, was er tut, finde ich, ich sehe immer angemalt aus. Ich beneide Menschen, die sich so schminken können, dass es gut aussieht. Es ist eine Gabe (und viel Übung, ich weiß). Eine frühere Kollegin verwendete Lippenstift so selbstverständlich, wie man sich morgens eine Unterhose anzieht. Bei mir dagegen sehen rote Lippen nur gut aus, wenn ich Sonnenbrand drauf habe, weil man den nicht verschmieren kann; ist praktisch, zieht aber leider auf der Haut. Denn ein weiterer Grund, warum ich nicht zum Schminken geeignet bin (obwohl ich nicht immer makellose Haut habe, wirklich nicht): Ich stütze oft den Kopf in die Hände oder habe meine Finger irgendwo im Gesicht.
Aber es gibt (natürlich!) eine Ausnahme. Seit 20 Jahren ist sie mir so selbstverständlich wie anderen der Lippenstift: die Augenlinie. Meine Freundin N. hat sie mir beigebracht, als ich 15 war und sie 17, und sowieso alles cool, was ich von ihr an Schmink- und Styletipps bekam. Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich sie nicht auftrage: eine hauchdünne, braune Linie am unteren Lid, so nah am Wimpernkranz, dass selbst ich mit meiner Gesichtsfassmanie sie nicht einfach so abwische. Früher habe ich sie mit Lidschatten und einem Wattestäbchen getupft, seit ein paar Jahren verwende ich einen weichen Kajalstift, das ist noch idiotensicherer und dauert fünf Sekunden. Wenn ich in den Spiegel sehe und die Linie nicht da ist, fühlt sich mein Gesicht fast ein bisschen nackt an. Die Augenlinie ist, wie meine Freundschaft zu N., eine Konstante für mich. Sie macht mich wach, zaubert mich nicht auf einmal wunderschön, aber, viel wichtiger, sie macht mich zu allem bereit: meine Lebenslinie. Theresa Hein
Folge 107: Das Rennrad
Dunkelblauer Lack, ein gelber Retro-Schriftzug und Klickpedale – »Cannondale, das ist noch ein echtes CAD 3«, murmelt der Fachverkäufer, als er mir hilft, die Klickschuhe auf meinem Rennrad einzustellen. »Ist von meiner Mama«, sage ich stolz.
Das Prachtexemplar, das bis dato in der Garage hing, wurde verbissen unter uns Geschwistern verhandelt. »Na, dann viel Spaß! Klicker sind eingestellt«, sagt der Mann aus dem Fahrradladen. Ich grinse, setze meine schnelle Brille auf – und los geht‘s, raus aus der Studentenstadt, die mir irgendwie zu klein geworden ist.
Fahrtwind übertönt die Zweifel in meinem Kopf, was zur Hölle ich nach meinem Bachelor überhaupt machen will, kann, soll. Das Rennrad ist die Flucht nach vorne und mit meinen Schuhen in den Klick-Pedalen fühle ich mich weniger, als würde ich auf der Stelle treten. Das Cannondale begleitet mich sogar auf mehrere Rennrad-Dates, die alle mit einem Lächeln und schwitzigen Umarmungen, aber immer beim Kaffee enden. Ich will davonfahren – und niemanden finden, der mich zum Bleiben überredet.
Einen Sommer später hieve ich das Rennrad am Hamburger Hauptbahnhof aus dem ICE. In der Großstadt, in der ich niemanden kenne, grüßen mich nun wenigstens die Rennradfahrerinnen. Keine Steigung weit und breit hier, nur Gegenwind, auf der Ebene und im Job. Ich demontiere es zwei Monate später wieder und quetsche es über Umzugskartons in den Autohimmel.
Und jetzt? Das Rennrad fährt nun Halbkreise um den Gärtnerplatz und weicht in Schlangenlinien den Münchner Tram-Spuren und Kopfsteinpassagen aus. Steht im WG-Zimmer, liegt manchmal an der Isar. Fährt zur Arbeit, zu Freunden und am liebsten abends durch den Olympiapark.
Es fährt viel hin und her, aber nicht mehr davon. Lucia Theiler
Folge 106: »Drachenreiter«
Dinge, die ich aus meiner brennenden Wohnung retten würde: Meinen Kuschelbär und das Buch »Drachenreiter« von Cornelia Funke. Natürlich könnte ich das Buch nachkaufen, doch dann wäre es nicht mehr mein Exemplar, das ich seit zwanzig Jahren habe.
Es ist dick, hat einen leuchtend blauen Einband und sichtliche Spuren von den vielen Reisen, die wir zusammen unternommen haben: Die Seiten sind gewellt von Pooltagen, an denen ich mit nassen Händen darin las. Sand hat die Ecken des Covers abgeschliffen, Meerwasser an der Seite einen Salzrand hinterlassen. Es ist mit Abstand das schönste Buch, das ich besitze.
In meiner ersten Erinnerung an das Buch liegt mein Vater abends im großen Bett zwischen meinem Bruder und mir, während er uns die Geschichten vom Drachen vorliest. Mein Bruder schläft ein, ich lausche gespannt Papas Stimme.
Weil das Buch mir so gut gefiel, las ich es das nächste Mal selbst, diesmal im Sommerurlaub. Ich fühlte mich während des Lesens geborgen und sicher und so las ich es auch im nächsten Sommer. Und in dem darauf. Heute – etwa zwei Jahrzehnte später – ist der »Drachenreiter« fester Bestandteil meines Sommerurlaubes.
Ich finde, das Schönste am Sommer ist das »Wieder«: Endlich wieder das Meer sehen, endlich wieder im Sand liegen. Endlich wieder Drachenreiter lesen. Jeden Sommer aufs Neue weckt er eine warme Nostalgie und ich fühle mich wieder wie ein sorgenloses Kind. Am liebsten liege ich am Strand neben Papa. Nur, dass heute ich lese und er schnarcht. Linn Petersen
Folge 105: Das Gemüsemesser
Immer, wenn ich Kartoffeln schäle, denke ich an meine Großmutter. Meine Großeltern Lisa und Fritz besaßen einen Bauernhof in der Eifel, Kühe, Schweine, Gemüsegarten, ein paar Heufelder, einen Kartoffelacker. Sie hatten vier Kinder, die auf den Feldern mithalfen – drei Jungs, das letzte war ein lang ersehntes Mädchen, meine Mutter. Meine Großeltern bauten ihre Kartoffeln hinterm Haus an, daneben Kopfsalat, Wirsing, Erbsen, Bohnen, Stachelbeer- und Johannisbeersträucher, ein Birkenwäldchen, ein glucksender Bach. Meine Oma grub jeden Tag ihre Hände in die Erde, um die Kartoffeln frisch aus dem Grund zu holen. Sie hatte immer Erde unter ihren Fingernägeln. Sie schälte die Kartoffeln mit einem kleinen, sehr scharfen Messer, so schnell, so geschickt, dass die Schale in einem Stück hauchdünn herabfiel. Ich sah ihr gern beim Kartoffelschälen zu. Sie erzählte dazu auf Eifler Plattdeutsch von ihren zehn Geschwistern, ihren Brüdern, die im zweiten Weltkrieg gefallen sind, »jefallen im Kriesch«, in Russland, in Italien. Sie erzählte, wie in den letzten Kriegsjahren die Hungernden nachts über ihren Kartoffelacker huschten, um etwas zu essen zu besorgen, und wie sie ihre Eheringe gegen eine Kartoffel tauschen wollten. Sie nahm nie einen an, sondern steckte ihnen Kartoffeln in ihre Jackentaschen, die an ihren dünnen Körpern schlackerten. Kartoffeln nannte sie auf Eifler Platt: Jerompere. Uns Enkelkinder holten die Großeltern für die Sommerferien in der Eifel mit dem Zug aus München ab, zehn Stunden hin, zwei Tage später wieder zurück. Dabei hatte sie immer einen mit Kartoffeln gefüllten Koffer dabei. Sie wäre nie ohne ihre eigenen Kartoffeln verreist.
Das Messer, das sie damals nutzte, war das schärfste kleine Messer, das ich kenne. Als der Sparschäler aufkam, tat sie das als neumodischen Kram ab, sie schälte bis zu ihrem Lebensende mit diesem kleinen scharfen Messer. Ich weiß nicht, was mit dem Messer passiert ist, als meine Großeltern starben, wurde der Bauernhof verkauft. Ich vermute, es wurde entsorgt. Vor zehn Jahren habe ich in der Markthalle neun in Berlin bei einem Messerstand dasselbe Modell endlich wiedergefunden: Es ist ein Windmühlenmesser von Robert Herder, Solingen, mit einer kleinen Windmühle darauf. Es gibt das Gemüsemesser »Klassik« und »Mittelspitz«, ich glaube, sie hatte den Klassiker. Ich schäle mit diesem Messer heute selten Kartoffeln, dafür nehme ich einen Sparschäler, aber Zwiebeln, Knoblauch und alles andere, was Präzisionsarbeit benötigt. Und dabei denke ich an meine Oma Lisa, wie ihr kleines, scharfes Windmühlenmesser wie das Lichtschwert eines Jedi-Ritters um die Kartoffel saust, und wie sie dabei erzählt von ihrer Zeit, vom Krieg, von ihren Kartoffeln, und dann fühle ich Liebe und Dankbarkeit, dass dieses kleine Messer mich in Gedanken durch die Generationen zu ihr bringt, aber vor allem, dass ich den Krieg nur aus ihren Geschichten kenne und nicht selbst erleben musste, so wie viele andere Menschen auf dieser Welt. Kerstin Greiner
Folge 104: Die Schlafbrille
Im unruhigen Halbschlaf merke ich manchmal, warum mein Halbschlaf ein unruhiger ist: Ich lege mir immer wieder den Unterarm über die Augen, rutsche ab, lege ihn über die Augen, rutsche ab … An jenen Tagen, an denen ich nicht sowieso mit der Sonne aufstehen muss, greife ich dann zur Schlafbrille. Dank ihr finde ich kurz später sogar zurück in den Tiefschlaf. Denn ich kann nur schlafen, wenn es dunkel ist (und still), daher kommt ja auch meine uralte Angewohnheit mit dem Unterarm über den Augen – die Gewohnheit stammt aus der Zeit, in der mir die Segnungen der Schlafbrille noch nicht bewusst waren. Dass es diese Zeit gab, macht mich heute selbst fassungslos. In den vergangenen rund 15 Jahren habe ich viele verschiedene Schlafbrillenmodelle ausprobiert, da waren diese Gratisdinger von den Fluggesellschaften ebenso dabei wie etwas teurere Exemplare. Meine liebste heißt »Manta Sleep«. Sie begleitet mich nun schon viele Jahre, mit ihr kann ich den Tag zur Nacht machen wie mit keiner anderen, zum Beispiel wenn ich vorher ausnahmsweise mal die Nacht zum Tag gemacht habe. Ich setze die Brille immer erst frühmorgens auf. Sie sitzt dann so fest, dass sie nicht runterrutscht, aber nicht so fest, dass sie lästig wäre. An den Augen gibt es Hohlräume, damit nichts auf die Augäpfel drückt, der Stoff ist wolkenweich, und so kann ich mich nochmal umdrehen und vielleicht ein bisschen von den Dingen im Leben träumen, die ich mir noch ersehne. Eine neue Schlafbrille gehört nicht dazu. Marc Schürmann
Folge 103: Das Eischnittchen
Es war vier Uhr morgens, als meine Eltern mich weckten. Als Kind war mir der Schlaf zwar noch nicht so heilig wie heute, doch auch damals hätte ich mich zu einer solchen Uhrzeit normalerweise lieber noch einmal umgedreht. Nicht an diesem Tag. Schon in der Sekunde, in der meine Mutter die quietschende Klinke meiner Zimmertür herunterdrückte, war ich hellwach. Es ging in den Sommerurlaub nach Italien! Weil meine Eltern den riesigen Stau auf der Autobahn gen Süden vermeiden wollten, fuhren wir traditionell besonders früh los. Da die schönste Zeit des Jahres für mich gar nicht früh genug starten konnte, kam mir das gerade recht.
Ein Teil der Vorfreude wurde schon beim Frühstück an der ersten Raststation erfüllt. Vermutlich hat jede Person ihren eigenen ultimativen Reiseproviant, nach dem sie sich schon beim Start des Motors sehnt. In meinem Freundeskreis schwört einer auf Schnitzelbrötchen, eine andere nascht Studentenfutter und wiederum eine weitere knabbert gerne eine Selleriestange. Für mich konnte es nur eines sein: Das Eischnittchen! Die Verniedlichungsform offenbart, mit welcher Wärme und Hingabe mein Vater jeden Abend vor einer Urlaubsfahrt für meine Mutter, meine beiden Schwestern und mich Spiegeleier von beiden Seiten briet, in zusammengeklappte Brote legte und diese in Alufolie verpackte. Eigentlich eine ganz normale Stulle, aber in mir wird sie immer das Gefühl von Heimat und zugleich Fernweh hervorrufen. Eischnittchen gibt es nämlich nur auf dem Weg in die Ferien.
Mittlerweile sind meine mitreisenden Eltern und Schwestern meiner mitreisenden Freundin gewichen, und abends brät nicht mehr mein Vater die Spiegeleier, sondern ich. Die Tradition lebt weiter. Auch, wenn meine Familie und ich nun mehrere hundert Kilometer entfernt wohnen. Florian Nübel
Folge 102: Die Geschirrtücher
In meiner Küche liegen drei Leinengeschirrtücher. Sie sind ganz unauffällig, rot-weiß gemustert. Aber sie stehen für mich dafür, dass Liebe nie an formale Beziehungen geknüpft sein muss.
Mein Mann David hat Großeltern. Aber er hat auch Menschen, die er seine Großeltern nennt, obwohl sie das eigentlich gar nicht waren. Stattdessen waren sie die Eltern einer kinderlosen Freundin der Familie, die sich in seiner Kindheit ebenfalls so viel um David kümmerte, dass er sie seine Patentante nennt, obwohl sie das gar nicht ist.
Ulrike und ihre Eltern Anneliese und Ewald waren für ein Kind da, das nicht ihres war. Sie schenkten meinem Mann ihre Zeit und einige seiner schönsten Kindheitserinnerungen. Als Kind rannte er durch den Garten von Anneliese und Ewald, Anneliese kochte sein Lieblingsessen, Ewald baute für ihn ein Baumhaus und legte einen Teich an. An runden Geburtstagen saß David direkt neben ihnen, als wäre er ihr Enkel. Und war er das nicht auch, irgendwie?
Vor zwei Jahrzehnten starb erst Ewald, vor ein paar Jahren dann Anneliese. Als Ulrike das Haus auflöste, fand sie die unbenutzten Leinentücher, die Anneliese wohl immer zu gut fand, um mit ihnen Geschirr abzutrocknen. An Weihnachten überreichte Ulrike uns die Tücher und sagte, dass sie sich ja nicht sicher sei, ob uns sowas freuen würde.
Immer, wenn ich eines davon aus dem Schrank nehme, erinnert mich das Tuch daran, dass man seine Liebe großzügig verteilen kann, auch wenn es keinen familiären Anlass dafür gibt. Dass man nicht zwingend eigene Kinder oder Enkel haben muss, um Kinder oder Enkel zu haben, sondern dass es auch wertvoll sein kann, sich um die Menschen zu kümmern, die schon da sind. Liebe braucht keinen Grund, sie hinterlässt auch so ihre Spuren. Dorothea Wagner
Folge 101: Der Flutschfinger
Wir leben in einer Welt der Warnungen und Mahnungen. Allein heute habe ich schon mindestens drei fragwürdige Entscheidungen getroffen. Ich bin nach der Mittagspause nicht zu Fuß in den neunten Stock gestiegen (Integrieren Sie Bewegung in Ihren Alltag!), ich habe nach Feierabend ein Glas Riesling getrunken (Es gibt keinen risikoarmen Konsum von Alkohol!), ich habe meine zehnjährigen Söhne auf einem mobilen Endgerät »Brawl Stars« spielen lassen (Smartphones verderben die Jugend!) und wegen all meiner Verfehlungen habe ich jetzt auch noch ein schlechtes Gewissen (Wo bleibt meine Selbstakzeptanz!)
Wohin ich auch schaue, wird mir ein erhobener Zeigefinger entgegengestreckt – zumindest metaphorisch. Dabei muss die Geste kein Symbol der Zurechtweisung sein. Für mich steht sie viel mehr für Köpper vom Einmeterbrett und flirrende Gefühle im Juli, für heiße Nachmittage im Englischen Garten und Schuhe, aus denen abends der Sand rieselt. Der erhobene Finger, er will nicht Recht haben, sondern den Weg weisen. Auf das was kommt, wenn der Sommer geht: ein neues Schuljahr, der Beginn eines Studiums, vielleicht sogar ein anderes Leben. Die Zeit flutscht einem nur so durch die Finger.
Was bleibt, ist die Liebe zu einem rot-orange-gelben Wassereis am Stiel, in Form einer geballten Faust mit ausgestrecktem Zeigefinger und erfrischend künstlicher Aromatik. Der Geschmack des Sommers – gestern, heute, immer. Verena Haart Gaspar