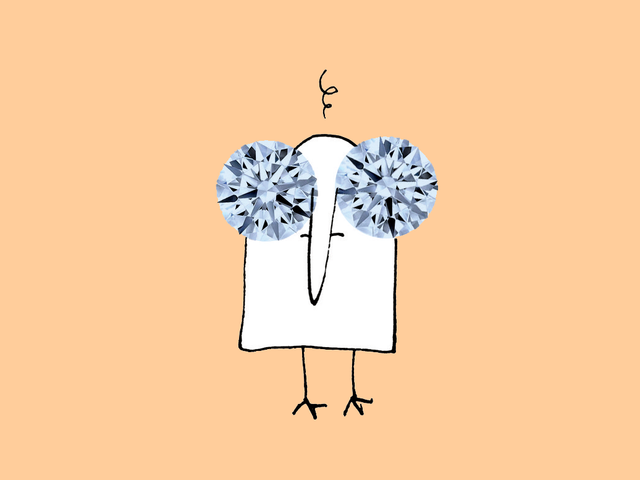Meine Zweifel am Konzept Freundschaft wurden durch zwei Dinge ausgelöst: einen Artikel des US-Schriftstellers Richard Ford in der Londoner Tageszeitung Guardian und eine WhatsApp-Nachricht eines ehemaligen Kollegen. Ich liebe meine Freunde und versuche, ihnen ein guter Freund zu sein, frage mich nun aber, ob ich zusammen mit vielen anderen Menschen womöglich einer idealisierten, der Zeit nicht mehr angemessenen Variante von Freundschaft nachhänge, die sich am schauerlichsten jeden Abend in der Bierwerbung manifestiert. Ist es schon allein deswegen an der Zeit, sich vom herrschenden Freundschaftsideal zu verabschieden?
Der Text von Richard Ford ist überschrieben mit Wer braucht Freunde?, und vor allem fragt sich Ford darin: »Ich bin absolut für menschliche Intimität, aber kann ich nicht die ganze Welt mögen?« Er schreibt, er sei im Grunde kein guter Freund und habe auch keine wirklich besten Freunde, da ihm das ganze Konstrukt nicht behage: die Vorstellung, dass man sich ausschließlich einer ganz kleinen Gruppe von Menschen öffnet, die man dann den Rest seines Lebens mit sich schleppt. Ford bemüht einige prominente Kronzeugen, etwa den englischen Schriftsteller C. S. Lewis, von dem die Beobachtung stammt: »Zu sagen, ›Das sind meine Freunde‹, bedeutet: Und die anderen sind es nicht.«
Ford stört genau dieses Ausschließende, Trennende an der Idee der Freundschaft: Warum sind unsere Freunde etwas so Besonderes, dass wir ihnen unsere ganze Aufmerksamkeit, unser Vertrauen schenken? Ob Ford tatsächlich Tag für Tag die Welt umarmt oder in seinem Text nur die eigene Aversion gegen zu viel freundschaftliche Nähe theoretisch überhöht, weiß ich nicht. Unabhängig davon ist die Frage berechtigt: Wäre es nicht besser, die ganze Welt als etwas Besonderes zu sehen und unsere Nähe und unser Vertrauen viel demokratischer zu verteilen?
Natürlich drängt sich die Frage auf: Wäre es auch möglich? Nun, man muss sich ja nicht vorstellen, dass wir alle als freundlich grinsende Schön-ist-es-auf-der-Welt-zu-sein-Trottel durch die Gegend laufen, einander an Bushaltestellen wildfremd in tiefe Gespräche verwickeln und uns beim Aussteigen mit großzügig verteilten Wangenküssen verabschieden. Aber könnte es nicht sein, dass der Mangel an Freundlichkeit in der Welt ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir uns zu sehr zurückgezogen haben auf die paar guten und engen Freundschaften, deren Pflege so viel Energie kostet?
Richard Ford beschreibt, wie ihm ein Bekannter von jemandem erzählt, mit dem er sich eigentlich gut verstehen müsste, die beiden sollten sich doch mal treffen. Fords Antwort passt eigentlich nicht zu jemandem, der mit der ganzen Welt befreundet sein möchte, aber sie ist sehr einprägsam: »Nein danke, ich habe genug Freunde.« Daran musste ich denken, als ich kurz nach der Ford-Lektüre eine Nachricht von einem alten Kollegen bekam, dem ich alle paar Jahre über den Weg laufe. Nach der vorigen Begegnung schrieb er, es sei schön gewesen, mich zu sehen, aber er müsse immer daran denken, wie ich vor vielen Jahren, als wir beide bei derselben Zeitschrift arbeiteten, nach einem Mittagessen mal gesagt hätte, ich hätte einen »Aufnahmestopp« für Freundschaften. Was ihn damals sehr verwundert habe.
Im Nachhinein bin ich erschrocken über diese Formulierung. Vermutlich hatte ich gerade mehrfach vergeblich versucht, das Kind im Fußballverein oder beim Ballett anzumelden, deshalb lag mir wohl der »Aufnahmestopp« auf der Zunge. Und genau das war das Thema: Der Kollege und ich hatten darüber gesprochen, wie schwierig es ist, ab einem gewissen Alter neue Freunde zu finden. Ich hatte das Gefühl beschreiben wollen, zwischen Job und Familie schon den alten Freunden nicht mehr gerecht werden zu können und daher keine Kapazitäten für neue zu haben. Die Wissenschaft bestätigt: Die meisten Freunde haben Menschen mit etwa fünfundzwanzig Jahren, danach sinkt die Zahl kontinuierlich. Und, andere Studie, ähnliches Ergebnis: Fast alle Menschen, die einem im Leben nah sind, lernt man im Alter von unter dreißig Jahren kennen.
Natürlich hat das ganz praktische Gründe. Die Soziologin Rebecca Adams von der University of North Carolina nennt drei Voraussetzungen, unter denen sich Freundschaft entwickelt: räumliche Nähe; wiederholte, ungeplante Begegnungen; und ein Setting, das Menschen dazu ermutigt, sich einander anzuvertrauen. Man kann das schnell prüfen: Ja, meine Freunde habe ich in der Schule, an der Uni, als Anfänger im Job und dann zuletzt, als die Kinder klein waren, gefunden. Aber die Gelegenheiten, bei denen die drei Faktoren Nähe, Wiederholung und Öffnung gegeben sind, werden weniger, sobald man genug Routine entwickelt hat, um sich im Job nicht mehr erschüttern zu lassen, und die Kinder nicht mehr wollen, dass man sie zu Verabredungen begleitet. Und wenn man ganz ehrlich ist, liegt dieses fürchterliche Aufnahmestopp-Gefühl, das sich dann einstellt, vielleicht viel weniger daran, dass man zu viele Freunde hat, mit denen man wahnsinnig tolle Dinge erlebt, sondern eher daran, dass man abends immer so müde ist und tagsüber eigentlich auch.
Hat mich der Gedanke von Richard Ford, man müsste doch aller Welt Freund sein, deshalb so erschüttert? Weil ich in Wahrheit zu bequem geworden bin, mich den paar Freundinnen und Freunden zu widmen, die ich noch von früher habe? Zu bequem, um mich auf neue einzulassen, geschweige denn um der ganzen Welt ein freundliches Gesicht zu zeigen?
Ja, schon. Aber es ist nicht nur das. Vor allem merke ich, dass ich nicht mehr mag, was ich vor mir sehe, wenn die Welt von Freundschaft spricht. Da hat sich etwas verändert im Lauf der vergangenen Jahre. Als ich aufwuchs, erlebten Freunde zusammen Abenteuer. Egal übrigens, ob es Freunde oder Freundinnen waren oder gemischt. Winnetou und Old Shatterhand, Thelma und Louise, Maja und Willi. Freunde hatte man, um der Welt nicht allein gegenübertreten zu müssen.Heute hat man Freunde, um sich nicht allein vor der Welt zurückziehen zu müssen.
Ich sprach eingangs schon über Bierwerbung. Das Bild ist heute, dass Männer Freundschaften haben wie in der Bierwerbung und Frauen wie in der Proseccowerbung. Du kommst in die Kneipe, da stehen deine Freunde alle schon am Tresen, sie haben dir auch schon ein Bier bestellt, und ihr bildet so eine kleine, ganz dichte Traube, die verhindert, dass jemand Fremdes sich dazustellt, dass die Welt irgendwie da eindringen könnte. Ein Hoch auf uns! Oder du liegst halt mit deinen Freundinnen auf dem Sofa, und ihr kichert und macht eine Kissenschlacht oder lackiert euch die Nägel. Und wenn ihr eine gemischte Freundesclique seid, dann klaut entweder einer die Chips, unerhört, oder bringt Küsschen mit, toll, aber der Blick geht nach innen, in die Tüte, das Glas oder die HD-Glotze. Im Grunde ist Freundschaft nur noch Hygge mit Ersatzfamilienanschluss.
Die Freundschaftsforscherin Beverley Fehr von der Universität Winnipeg sagt, dass »Selbstoffenbarung« der Kern einer Freundschaft sei: Wechselseitig gehen Menschen ein gewisses Risiko ein, um dem anderen zu signalisieren, schau, ich erzähl dir ein kleines Geheimnis nach dem anderen, ich vertraue dir, also kannst du auch mir vertrauen. Genau, sagt der Berliner Freundschaftsforscher Wolfgang Krüger, Autor des Buches Freundschaft: Beginnen, verbessern, gestalten. Wer die traditionelle Freundschaft so kritisch hinterfrage wie Richard Ford, müsse erstens ein sehr »beschädigtes Vertrauen in andere Menschen« haben (was Ford in seinem Text auch so beschreibt) und außerdem eine entsprechende familiäre Prägung (auch das beschreibt Ford, dessen Buch Zwischen ihnen über seine Eltern gerade erschienen ist: dass seine Eltern keine Freunde hatten außer einander und dass sie ihn immer von seinen fernhielten). »Freundschaft gelingt im Gespräch«, sagt Wolfgang Krüger: »Indem ich dem anderen nach und nach einen tiefen Blick in mein Lebensgefühl gewähre, lerne ich, mich ihm zuzumuten.«
Das finde ich ebenso nachvollziehbar wie bemerkenswert: das Risiko, das man eingeht, und den Mut, den man braucht – denn der steckt im »Zumuten« genau wie die Zumutung, die man selbst ja eben auch ist.
Wenn aber die Freundschaft von vornherein so viel Mut erfordert, wenn sie solch ein Risiko ist – dann ist es doch ein Jammer und eine Schande, all den Mut nur zu nutzen, um so was bräsig Bierseliges daraus zu machen, die Freundschaft als Entmüdungsbecken, in dem man sich wieder Kraft holt für die nächste Runde in der Disziplin, sich von der feindlichen Welt die Fresse polieren zu lassen. Oft habe ich gelesen, ein gutes Gespräch mit Freunden diene dazu, »wieder aufzutanken« oder »die Batterien aufzuladen«. Sogar der Spiegel feierte vor drei Jahren in einem großen Artikel den »Wohlfühl-Effekt von Freundschaften«, weil sie »Stress abbauen und die Abwehrkräfte von Körper und Seele« stärken würden. Leistet das nicht auch ein heißer Tee oder ein strammer Herbstspaziergang? Dieser seltsam nutzwertige Sauna-Blick auf die Freundschaft ist in der Freundschaftsforschung keine ganz neue Tendenz, die deutsche Psychologin Ann Elisabeth Auhagen sagte schon 1993, Freundschaft sei »ein Rückzugsraum«. Liegt ein Unbehagen an der gegenwärtigen Idee von Freundschaft vielleicht daran, dass wir uns jetzt wirklich lange genug zurückgezogen haben?
Natürlich reden wir in meinen Freundschaften über große, bedrohliche Dinge wie die Trennungen, die Ängste vorm wirtschaftlichen Abstieg, das Leiden am Älterwerden. Wir trösten einander, und wir unterstützen uns auch. Aber womöglich nur darin, das alles besser auszuhalten, darüber hinwegzukommen, es durchzustehen oder es für einen Abend oder ein Wochenende zu vergessen. Das ist schön und sowieso schon viel zu selten und kostbar, aber: Warum nicht noch viel mehr wollen?
Vielleicht könnte ein Mittelweg gelingen zwischen der freundschaftslosen Allerwelts-Freundlichkeit, die Richard Ford sich erträumt, und der zurückgezogenen, weltabgewandten Freundschaft, wie sie im Moment das Ideal der brutalen, unnachgiebigen Zeit ist. Nämlich so, dass Freundinnen und Freunde wieder gemeinsam rausgehen, um die Welt zu verändern und zu verbessern, als Abenteuer, wie damals. Warum ist das gegenwärtige Ideal der Freundschaft das gemeinsame Wochenende im Spa, warum nicht die gemeinsame Beschwerde beim cholerischen Chef, die gemeinsame Konfrontation mit dem sexistischen Bekannten, das gemeinsame Sortieren von Kleiderspenden? Jene, die die Welt gerade schlechter machen, nutzen ihre Freundschaften genau dafür, das zu tun. Gemeinsam machen sie Landstriche und Straßenzüge für Andersdenkende unbewohnbar, und wenn es heißt, sie rotten sich zusammen und organisieren sich, dann bedeutet das eigentlich: Sie holen ihre Freunde. Warum sollen wir unsere Freundschaften nur nutzen, uns davor zu verkriechen?
Traditionell gilt die Familie als kleinste Zelle der Gesellschaft. Aber wie oft ist uns vorgebetet worden, dass Freunde die neue Familie seien. Vielleicht müssen wir inzwischen sagen: Die Freundschaft ist die kleinste Zelle der Gesellschaft, und von ihr aus fangen wir an, die Gesellschaft so zu machen, dass wir uns nicht mehr so sehr von ihr erholen müssen.