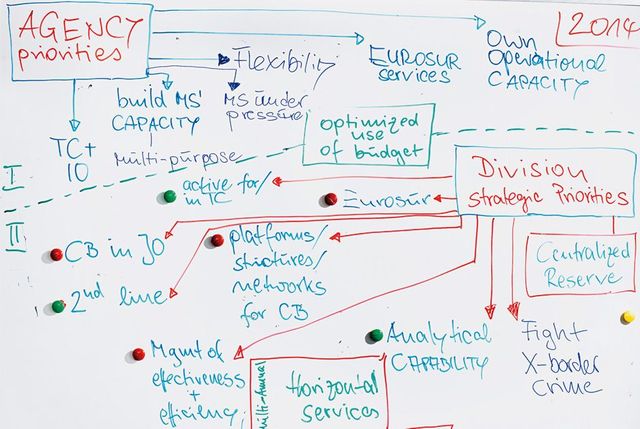Wenn Manuel Mohr im Lagezentrum von Frontex auf Europa schaut, sieht er kleine grüne Punkte auf einer Landkarte. Sie leuchten auf einem leinwandgroßen Monitor vor ihm, der den Mittelmeerraum zeigt. Er sieht Punkte die ganze türkische Küste entlang, ein Band mit Punkten an der bulgarisch-griechischen Grenze. Zwischen Libyen und Sizilien, wo Lampedusa liegt, ballen sich Dutzende zu einem dichten Teppich.
Es ist das Bild eines Kontinents, der sich bedroht fühlt. Eine riesige Insel der Glückseligen, umzingelt von Instabilität, Unruhen und Hoffnungslosigkeit. Ein sicherer Hafen für die, die drin sind. Ein gelobtes Land für jene, die rein wollen. Und rein wollen immer mehr.
»Das sind allein die Vorfälle der letzten sechs Wochen, seit unsere Operation Hermes läuft«, sagt Mohr, der vor drei Jahren von der deutschen Bundespolizei hierher entsandt wurde. Er ist der Einsatzleiter im Lagezentrum, zuständig für die Kommunikation zwischen Frontex und den Einsatzgebieten. Vorfälle, so nennen sie hier Flüchtlinge, die versuchen, die europäische Außengrenze illegal zu übertreten. Jeden dieser Punkte kann Mohr auf seinem Rechner, der das gleiche Bild wie auf den Monitoren zeigt, heranzoomen wie bei Google Earth. Klickt er einen an, dann öffnet sich eine Maske, die ihm verrät, was vorgefallen ist: 24 Flüchtlinge auf Boot aufgegriffen, Zeitpunkt, Koordinaten, Nationalitäten an Bord – alles fein säuberlich aufgelistet. Grenzschützer vor Ort haben die Daten über eine Software eingepflegt, meistens binnen Stunden. So weiß Mohr hier in Warschau immer, was los ist an den Grenzen.
Gerade ist mal wieder jede Menge los.
Es ist Sommer. Hochsaison für Bootsflüchtlinge. Jetzt, wenn das Meer ruhiger ist und wärmer, die Stürme seltener, stechen sie wieder zu Tausenden in See. Syrer, Eritreer, Somalier. Menschen, die ihr Leben riskieren für eine bessere Zukunft. Auf überfüllten Schlauch- und Holzbooten, in die sie für viel Geld von Schleusern gesetzt wurden. Fast täglich ertrinken Menschen bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren. Nach Angaben von Gabriele del Grande, Italiens führendem Menschenrechtsaktivisten, waren es zwischen 2004 und 2013 mehr als 6200 Tote, Dunkelziffer unbekannt. Die Nachrichten sind voll davon. Die meisten Boote aber werden von der Küstenwache entdeckt und abgefangen. Dann leuchtet bei Manuel Mohr auf seinen Monitoren ein neuer grüner Punkt auf.
Das Lagezentrum, der situation room, befindet sich im 22. Stock eines gläsernen Hochhauses in Warschau. Es ist ein Raum ohne Fens-ter, getaucht ins blaue Licht der Bildschirme. Fünf bis sechs Beamte gehen hier still ihrer Arbeit nach. Es ist das Auge von Frontex, die Alarmanlage Europas. Hier laufen die Informationen von den Grenzen zusammen, außerdem von angeschlossenen Nachrichtendiensten und Europol: Berichte, Satellitenbilder, Migrantenprofile, Wettervorhersagen und vieles mehr. Von hier aus organisiert das reiche Europa seine Abwehrstrategie gegen den Ansturm der Armen.
Natürlich: Es gibt eine europäische Asylpolitik. Den von Bürgerkrieg und Diktatur Vertriebenen sollen Europas Türen offen stehen. Es gibt Aufnahmerichtlinien, Verfahrensrichtlinien, Qualifikationsrichtlinien und die Europäische Menschenrechtskonvention. Das ist die hehre Theorie.
Und dann gibt es die Praxis: Ein Afghane hat laut Tom Koenigs, Sprecher für Menschenrechtspolitik von Bündnis 90/Die Grünen, in Griechenland eine Ein-Prozent-Chance, als Asylsuchender aufgenommen zu werden. In Deutschland sind es neunzig Prozent. Familien werden auseinandergerissen, Flüchtlinge werden ins Gefängnis gesteckt, nach Wochen der Haft willkürlich ausgesetzt oder noch an der Grenze mit Gewalt zurückgedrängt. Europa hat ein Problem mit Migration. Und Europas Antwort darauf ist ein stetig wachsender Überwachungsapparat. Eine technische Antwort.
»Je mehr Informationen, desto besser das Lagebild, je besser das Lagebild, desto effizienter können wir arbeiten«, sagt Mohr. Er muss wissen, wo sich neue Lecks auftun, welche Routen die Boote nehmen, wo Verstärkung für die lokalen Grenzschützer gebraucht wird.
2004 wurde die Agentur Frontex auf Beschluss des europäischen Rates ins Leben gerufen, um auf die neuen Herausforderungen zu reagieren, die das Schengener Abkommen mit sich brachte. Durch den Wegfall der innereuropäischen Grenzkontrollen wurde Grenzschutz plötzlich Sache jener EU-Länder am Rande Europas. Gut für Länder wie Deutschland, die keine europäische Außengrenze haben, schlecht für Griechenland, Spanien oder Italien.
Der offizielle Auftrag von Frontex lautet, Grenzstaaten zu unterstützen, die besonders stark von Kriminalität wie Menschenhandel oder Schmuggel, vor allem aber vom »Migra-tionsdruck« betroffen sind. Dann schickt Frontex Verstärkung: Grenzschützer aus anderen EU-Ländern oder Flugzeuge und Nachtsichtgeräte. Bestand das Team in der Zentrale im Gründungsjahr noch aus rund 20 Mitarbeitern, sind es heute schon über 300 – hauptsächlich abgesandte Grenzpolizisten aus anderen EU-Ländern. Sie steuern die Einsätze und erstellen aufwendige »Risikoanalysen«, um vorherzusehen, an welchen Grenzen es die nächsten Probleme geben wird. Es ist ja auch viel passiert seitdem: Der Sturz Gaddafis, der arabische Frühling und zuletzt der Bürgerkrieg in Syrien haben die Situation an den Südgrenzen Europas verschärft. Allein von Januar bis Mai dieses Jahres kamen rund 40 000 Menschen auf dem Seeweg nach Italien. Grenzschutz heißt für Frontex deshalb schon lange in erster Linie Migrationsverhinderung.
Auch aus diesem Grund will die Kritik an Frontex nicht verstummen. Menschenrechts-organisationen sehen Frontex als Instrument einer zynischen Abschottungspolitik. Maßlos im Streben nach Überwachung, aber selbst kaum zu überwachen. Nicht wenige würden Frontex am liebsten abschaffen. Dabei machen sie doch nur ihren Job, den Brüssel ihnen aufgetragen hat. »Zäune und Patrouillen verhindern keine Migration«, sagt Mohr. »Da ist andere politische Arbeit gefordert. Dann müssten sich nicht mehr so viele ins Boot setzen und ihr Leben riskieren.«
Wer die Büros von Frontex im 22. und vier weiteren Stockwerken hoch oben über den Geschäfts- und Bankenvierteln Warschaus besucht, muss eine Grenze überwinden. Sie besteht aus einem Ganzkörper- und einem Gepäckscanner, einem diskreten Wachmann und einer Sicherheitsschleuse. Landkarten hängen an den Wänden der Einzelbüros. In einem Gang sind die Gewinner eines internen Fotowettbewerbs unter Grenzsoldaten ausgestellt: ein Grenzpfosten in sonnengegerbtem Gras, ein Patrouillenfahrzeug vor Küstenlandschaft. Menschen sind auf den Fotos nicht zu sehen.
Hier, zwischen den Rechnern und Monitoren, den Pinnwänden, Strategiecharts und gerahmten Polizeiurkunden, wirkt das Drama an Europas Grenzen weit entfernt. Manchmal wird es spürbar, etwa wenn Mohr erzählt, wie einmal sein Notfallhandy um zwei Uhr nachts klingelte: Vor der griechischen Küste war ein Flüchtlingsboot im Begriff zu sinken. Passagiere hatten per Handy Verwandte in Deutschland angerufen, die wiederum die Polizei anriefen. Die rief bei Mohr an, der rechtzeitig die griechische Küstenwache informierte. Alle 87 Flüchtlinge, hauptsächlich Syrer, wurden gerettet und den örtlichen Behörden übergeben.
Mohr sieht stolz aus, als er das erzählt. Dann spricht er aber lieber wieder von den »Produkten«, die seine Abteilung »erstellt«: Lagebilder, Analysen und Berichte. Und von »Eurosur«, dem jüngst eingeführten europäischen Überwachungsnetz, in das Daten der internationalen Schiffsüberwachung, von Drohnen, Radaranlagen und Bewegungssensoren einfließen. So haben alle Grenzschutz-Lagezentren der Mitgliedsstaaten das gleiche Bild auf ihren Monitoren, und Europa rückt noch ein Stück näher zusammen im Kampf gegen die, die rein wollen, aber nicht dürfen. Das Bild muss schärfer werden, immer schärfer. Die perfekte Grenze ist die, die man zu hundert Prozent im Blick hat.
Von den »Push-back«-Aktionen, dem ungesetzlichen Zurückdrängen von Einwanderern in Grenznähe, auf hoher See, für die Frontex immer wieder kritisiert wird, erzählt Mohr nicht. Doch ein Blick an die Pinnwand hinter Mohr verrät, dass sie hier sehr wohl wissen, dass es passiert. Wozu sonst hängt dort ein kleiner Zettel, auf dem eine neue Sprachregelung notiert ist: Für »Push-back« steht dort »nicht abgewickelte Rücksendung«, das Wort »Zaun« wird durch »technisches Hindernis« ersetzt, und statt »Abschreckung« soll es »Prävention« heißen. Man weiß bei Frontex um das schlechte Image. Da möchte man wenigs-tens etwas gegen die bösen Wörter tun.
»Die Flüchtlinge, die wir aufspüren, bleiben die Benachteiligten dieser Geschichte«, sagt Klaus Rösler, Mitte 50, eckige Brille, hohe Geheimratsecken. »Aber wenn wir tatenlos bleiben, schaffen wir weitere Anreize für Schlepper. Es ist eine intellektuelle Verkürzung, immer nur kritisch auf die Grenzpolizisten zu zeigen. Wir setzen nur geltendes EU-Recht durch.«
In Röslers Büro gibt es gleich mehrere Europakarten. Auf einer hängt seine deutsche Dienstmarke – genau dort, wo München ist. Der gebürtige Franke war 40 Jahre lang Bundespolizist, zuletzt in München, bevor er 2008 zu Frontex kam. Dort ist er Direktor für die operativen Abteilungen, zu der auch Mohrs Lagezentrum gehört. Unter Röslers Leitung laufen die mehrmonatigen Patrouillen, die Frontex zusammen mit Grenzschützern von Mittelmeerstaaten durchführt. Die Einsätze tragen Namen wie Poseidon, Hera, Nautilus, Hermes. Wo sie laufen, legt Frontex auf Basis der Risiko-analysen fest. »Wir können nicht nur darauf warten, bis ein Mitgliedsstaat laut ›Hilfe‹ schreit«, sagt Rösler. »Wir müssen ganz genau wissen, wo unsere Unterstützung gebraucht wird, vor allem, wo sie möglichst effizient ist.« Effizienz ist ein Wort, das man hier oft hört.
Frontex wolle nicht nur Feuerwehreinsätze machen, sagt Rösler: »Wir wollen nachhaltige Strukturen aufbauen, Kapazitäten stärken, Abläufe harmonisieren, Informationsnetzwerke aufbauen.« Er klingt jetzt wie ein Unternehmensberater, und er patscht mit der flachen Hand rhythmisch auf den Tisch, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen.
»Da fast jedes Flüchtlingsboot überfüllt ist und damit rechtlich als seeuntauglich gilt, wird es gerettet, sobald wir es entdecken«

Das »gesamteuropäische Grenzmanagement«, wie es Rösler vorschwebt, müsste so effizient sein, dass es nur noch eine »Teilfilterrolle« spielt: Kriminelle und »Illegale« würden draußen bleiben, und alle »Menschen mit berechtigten Schutzinteressen« bekämen ein geordnetes Asylverfahren. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus, das weiß auch Rösler.
Einwanderung verläuft nicht in geordneten Bahnen. Sie sucht sich den Weg des geringsten Widerstands: Schließt Frontex eine Grenze, tut sich anderswo ein neues Schlupfloch auf. Oft sind die neuen Routen für die Migranten gefährlicher als die alten. Der Weg der Flüchtlingsströme ist ohnehin komplex und schwer vorhersehbar. Er ist abhängig von der Taktik der Schleuser und von neuen Krisenherden. Es kann passieren, dass sich Beamte an der bulgarisch-türkischen Grenze Asylsuchenden aus der Dominikanischen Republik gegenüber sehen, die mit dem Flugzeug über Amsterdam in die Türkei eingereist sind.
Zurzeit ist Libyen das größte Problem für Frontex. Die 2000 Kilometer lange Küste des instabilen Landes wird kaum noch kontrolliert. Deshalb die vielen grünen Punkte zwischen Sizilien und Libyen auf den Karten im Lagezentrum, wo Frontex den Fortgang der Operation »Hermes« verfolgt. Hermes, so heißt in der griechischen Mythologie der Schutzgott der Diebe, aber auch der Reisenden und des Verkehrs.
Frontex, eine Schutzmacht? Für Béatrice Comby, Direktorin der Abteilung Kapazitätsaufbau, scheint das kein Widerspruch zu sein. Allein im Jahr 2013 habe Frontex an Seerettungen von 37 000 Menschen mitgewirkt, sagt sie. Die Französin kümmert sich darum, für Einsätze das richtige Personal und die nötige Ausrüstung bereitzustellen.
Tatsächlich zwingen das internationale Seerecht und das Völkerrecht alle Grenzschützer, Menschen in Seenot sofort zu retten und an den nächstgelegenen Hafen zu bringen. In der Praxis hieß das für manche Flüchtlinge aber, dass sie wieder dahin gebracht wurden, wo sie aufgebrochen waren. Oder an einen Ort, an dem ihnen Verfolgung drohte. Im europäischen Abwehrkampf gegen illegale Einwanderer wird geltendes Recht schnell zur Auslegungssache. Deshalb gilt bei Frontex-Operationen seit diesem Sommer eine neue EU-Verordnung: Flüchtlinge in Seenot dürfen nur noch in das EU-Land gebracht werden, in dessen Hoheitsgebiet die Operation stattfindet. So werden aus Grenzschützern immer öfter Seeretter. Manchmal sogar unfreiwillig Verbündete im zynischen Kalkül der Schleuser. »Da fast jedes Flüchtlingsboot überfüllt ist und damit rechtlich als seeuntauglich gilt, wird es gerettet, sobald wir es entdecken«, erklärt Comby. »Das ist ein Automatismus, den auch die Schleuser in Libyen mitbekommen haben.« Die können ihre Flüchtlinge nun mit gestiegenen Erfolgschancen locken. Bisher hatten sie nicht einmal davor zurückgeschreckt, Flüchtlingsboote zu zerstören, wenn die Küstenwache sich näherte – so wollten sie die Rettung erzwingen. Zu Combys Aufgaben in Warschau gehört auch, Entwicklungen wie diese in Kurse und Workshops einfließen zu lassen, damit ihre Eingreiftruppen auf dem neuesten Stand sind. »Wir müssen agil bleiben«, sagt sie, »die Situation ändert sich täglich.«
Auf ihrem Tisch liegt ein Handbuch für Kursleiter zum Thema »Menschenrechte für Grenzschützer«. Das Coverfoto zeigt zwei Boote auf hoher See: links einen überfüllten Kahn mit Dutzenden Flüchtlingen, die ihre Arme hilfesuchend in die Luft recken, rechts ein winziges Beiboot der Küstenwache mit vier Grenzschützern, die eine Plastikflasche mit Wasser hinüberwerfen. Es ist ein treffendes Bild für die Überforderung einer Institution, die in der Zwickmühle ist: Menschen abwehren, aber bitte möglichst menschlich – wie soll das gehen?
»Frontex ist als Institution eine Fehlkonstruktion«, meint Tom Koenigs, Menschenrechtsbeauftragter von Bündnis 90/Die Grünen: »Weil man sich nicht traut, die Verantwortung für den Schutz der Flüchtlinge zu übernehmen, statt allein für den Schutz der Grenzen.« Nach Jahren harter Kritik werde in der Chefetage von Frontex heute viel über Menschenrechte gesprochen. Früher unterstrich Frontex seine effiziente Arbeit, indem die Agentur regelmäßig die Zahl zurückgeschobener Flüchtlinge meldete. Inzwischen rede man lieber über die Zahl aus Seenot geretteter Menschen.
»Frontex stellt sich heute dar wie eine Organisation, die Decken verteilt und Menschen rettet«, sagt Hagen Kopp vom Netzwerk »Welcome to Europe«, das Migranten auf ihrer Flucht unterstützt. In Wahrheit setze Frontex nach wie vor alles daran, das Abschieberegime möglichst effizient auszubauen – und das nicht nur an Europas Grenzen.
Frontex koordiniert auch in Europas Binnenstaaten die Deportation von Flüchtlingen, die nach EU-Recht als illegal gelten. Die Abschiebehäftlinge werden auf europäischen Flughäfen eingesammelt und per Charterflug in Drittstaaten gebracht. Vom Flughafen Düsseldorf gehen regelmäßig Flüge nach Serbien und Mazedonien ab. Durch hartnäckige Lobby-arbeit sorgten Organisationen wie Pro Asyl und Amnesty International dafür, dass Menschenrechte ein Teil der Grundsätze von Frontex wurden, ebenso der Zurückweisungsschutz für Flüchtlinge.
Karl Kopp von Pro Asyl wirft Frontex aber vor, sich oft nicht einmal an die eigenen Regeln zu halten. Artikel 3 (1a) der Frontex-Verordnung vom 25. 10. 2011 verpflichtet Frontex, gemeinsame Aktionen auszusetzen oder zu beenden, wenn es dabei zu schwerwiegenden oder anhaltenden Verstößen gegen die Menschenrechte kommt. Genau das, sagt Kopp, passiere aber seit Jahren immer wieder im Grenzgebiet zwischen Griechenland und der Türkei: »Die Ägäis ist zu einer menschenrechtsfreien Zone geworden.« Pro Asyl hat für die Region rund 2000 Fälle von illegalen Push-backs im Jahr 2013 dokumentiert. Dabei mache sich Frontex die Finger nicht selbst schmutzig, sondern gebe sich als sauberer Dienstleister und überlasse »die Drecksarbeit dem griechischen Grenzschutz mit seinen Rambo-Methoden«.
Wenn es um die Verantwortung für konkrete Unglücksfälle geht, schieben sich Frontex und lokale Behörden laut Kopp gerne gegenseitig den schwarzen Peter zu. Bis heute ist zum Beispiel nicht geklärt, wie es am 20. Januar 2014 zum Kentern eines Flüchtlingsboots vor der griechischen Insel Farmakonisi kam; drei Mütter und acht Kinder aus Afghanistan starben. Pro Asyl fordert, dass alle Informationen über die Frontex-Operation »Poseidon« öffentlich werden – und dass Frontex seine Arbeit in der Ägäis einstellt. »Wir sagen nicht, dass das Frontex-Beamte waren«, erklärt Kopp. »Aber wenn man zusammen loszieht, kann man nicht so tun, als hätte man nichts damit zu schaffen.«
Im vergangenen Jahr haben der Ministerrat und das Europäische Parlament der Agentur Frontex eine Menschenrechtsbeauftragte an die Seite gestellt. Inmaculada Arnaez ist eine kleine, aber resolut wirkende Baskin, die im Gespräch schon mal laut werden kann. Sie hat davor für die UN und die OSZE gearbeitet. In Kolumbien vertrat sie politisch Verfolgte und half NGOs, nach Vermissten zu suchen. Dass Frontex für viele NGOs ein rotes Tuch ist, stört sie nicht: »Man kann Dinge nur ändern, wenn man sich einbringt und mit den Institutionen zusammenarbeitet. Es ist effektiver, als draußen zu stehen und Kritik zu üben.«
Inmaculada Arnaez schreibt Richtlinien für Frontex-Operationen fest und schult die daran beteiligten Grenzschützer. Ihre Mission: Beamte sensibilisieren für die menschlichen Fragen ihrer Arbeit. Sie reist viel. Vor allem zu Einsatzgebieten, aus denen von Push-back-Aktionen, Misshandlungen, schlechter Unterbringung oder inakzeptablem Krisenmanagement berichtet wird. Nicht jeder kleine Grenzposten sei auf den plötzlichen Ansturm von Hunderten Menschen vorbereitet, sagt Arnaez.
»Manchmal ist das größte Problem, Windeln an einen Grenzposten zu schaffen, für die Mütter mit Babys, die dort Asyl suchen.« Dann muss sie auch schon mal einen Polizeioberst zusammenfalten, weil jede hochschwangere Asylsuchende »verdammt noch mal in 30 Minuten in einem Krankenhaus zu sein hat«. Arnaez ist Pragmatikerin, sie findet auch nichts dabei, auf Massenabschiebeflügen dabei zu sein, die Frontex durchführt. Sie hat die Gesetze nicht gemacht, die da umgesetzt werden. Aber sie will dafür sorgen, dass die Menschen mit Würde und Respekt behandelt werden, mit so wenig Zwang wie möglich.
»Ach, Inmaculada«, sagt Karl Kopp seufzend – und schiebt sofort hinterher, wie sehr er die Menschenrechtsbeauftragte als Person schätze. »Aber eine Person bei Frontex kann die Menschenrechte nicht allein retten. Sie ist dort angestellt und läuft Gefahr, ein Feigenblatt zu werden.«
Am Ende bleibt die Frage, wie sich all das mit dem europäischen Geist verträgt. Oder ob er nur bis zur Grenze reicht.
»Wir haben an unseren Grenzen Monster geschaffen, und Frontex ist Teil dieser monströsen Strukturen«, sagt Tom Koenigs. Für Karl Kopp zeigt Frontex, wie desaströs die europäische Flüchtlingspolitik ist – und dass die EU unfähig ist, gemeinschaftlich Verantwortung zu übernehmen: »Schon das Wort ›Agentur‹ ist so ein Entlastungswort: Wir koordinieren ja nur.«
»Die europäische Staatengemeinschaft hat sich nun mal dafür entschieden, Kontrollen an ihren Außengrenzen nicht abzuschaffen«, sagt Klaus Rösler von Frontex, »sondern illegale Aktivitäten zu bekämpfen. Dazu zählt auch die unerlaubte Einreise.«
Also machen sie alle weiter ihren Job: die Schlepper in Afrika, die Küstenwächter im Mittelmeer, die Grenzschützer an den Landgrenzen und die Beamten bei Frontex in Warschau. Die Punkte auf Manuel Mohrs Bildschirmen werden nicht weniger.
(Fotos: Julian Röder / Ostkreuz)
Fotos: Julian Röder