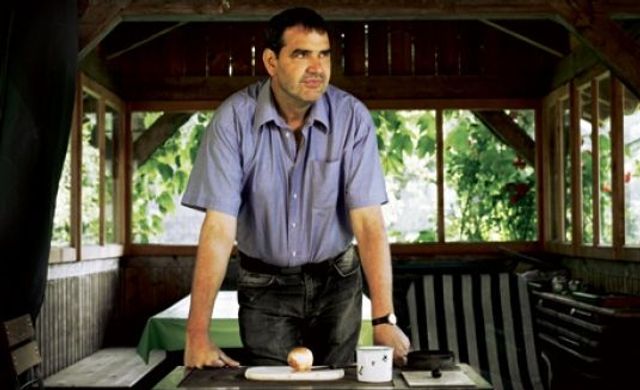SZ-Magazin: Herr Daxenberger, wie geht es Ihnen?
Sepp Daxenberger: Ich bin jetzt wieder einigermaßen stabil, trotz des kleinen Schlaganfalls, den ich vor Kurzem hatte. Das war Ende Mai anders. Da hatte ich Chemotherapie, gleichzeitig bin ich bestrahlt worden und habe auch noch sogenannte Immunsuppressiva bekommen. Nach zwei, drei Chemos sind solche Probleme aufgetreten, dass ich kaum mehr aus dem Bett rausgekommen bin. Ich habe mich zusammenreißen müssen, mir die Zähne zu putzen.
Das sieht man Ihnen jetzt nicht an.
Ich habe die Chemo abgebrochen. Ich werde sie in ein paar Wochen wieder anfangen, die brauche ich schon, um die Krebszellen in Schach zu halten. Aber als es mir so dreckig gegangen ist, habe ich die endgültige Entscheidung getroffen, den Fraktionsvorsitz im Landtag abzugeben. Ich will kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn ich mich mal zwei Stunden hinsetze oder mir die Fußball-WM anschaue. Oder mit Freunden in den Biergarten gehe. Wie sieht Ihre derzeitige Therapie aus?
Ich bekomme Infusionen, um meine Knochen zu stärken. Und ich werde bestrahlt, punktuell. Mein Krebs frisst mir ja Löcher in die Knochen. Diese Stellen werden bestrahlt, damit dieser Prozess gestoppt wird. Bei mir sind das die Schulter und der dritte Lendenwirbel.
Was passiert, wenn sich der Prozess nicht stoppen lässt?
Dann brechen die Knochen ein. Eine Bekannte, die an der gleichen Krebsform leidet, ist in den letzten Jahren um zehn Zentimeter kleiner geworden, weil die Wirbel einbrechen. Man kann das stabilisieren, aber man verliert an Beweglichkeit.
Sie haben immer gesagt, Politik sei für Sie die beste Therapie. Hat diese Therapie Sie wirklich weitergebracht?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Aus diesem Grund gehe ich ja auch nicht ganz aus der Politik raus. Im Moment macht mir die Kommunalpolitik viel Spaß. Ich kümmere mich schon noch um Sachen. Landespolitik fällt mir im Moment schwer. Die Wertigkeiten haben sich verschoben. Ich kann mich nicht so über Dinge aufregen wie früher. Ich schau mir noch die Nachrichten an. Aber früher habe ich mich sofort gefragt: Was musst du jetzt tun? Auf was reagieren? Jemanden anrufen? Das ist jetzt weg.
Andere Krebspatienten sagen: Der Beruf ist das, was mich so aufgerieben hat. Haben Sie darüber mal nachgedacht?
Ja. Es gibt auch Leute, die das anschneiden. Ich habe das mit den Ärzten besprochen. Wenn sie der Meinung sind, dass ich aufhören muss, um bessere Heilungschancen zu haben, muss ich mich damit beschäftigen. Bis jetzt habe ich das noch von keinem gehört. Ein bisschen reduzieren, ja – aber nicht aufhören.
Viele denken: Warum lässt er es denn nicht ganz? Warum macht er sich nicht noch eine gute Zeit?
Das war schon vor Jahren so: Da haben die Leute gesagt, ich solle doch reisen, mir die Welt anschauen. Aber ich bin doch zufrieden mit dem Leben, das ich habe. Ich will doch nichts anderes machen. Ich mag eigentlich gar nicht rumfahren, was soll ich denn auf den Malediven? Und ich mag die Politik. Ohne Politik werde ich unruhig.
Sie waren mal ein Hundertkilomann, Schmied, Fußballer, Feuerwehrmann. Wie sehr hat Sie der Krebs geschwächt?
Sehr, und das nervt mich furchtbar. Vor allem auf dem Hof. Das sind oft so Kleinigkeiten: Im Kälberstall hat sich ein Wasserfass verschoben, das müsste ich aufheben. Sechzig, achtzig Kilo. Früher war das kein Problem, da bist mit dem Fuß reingefahren und hast es hochgestemmt. Jetzt schaff ich es nicht mehr, ich darf es nicht mehr. Das ärgert mich. Vom Selbstbewusstsein her belastet es mich eigentlich nicht. Das wäre vor zehn, 15 Jahren anders gewesen. Damals habe ich mich damit identifiziert, stark zu sein. Jetzt bin ich schwach. Aber das lastet mir niemand an, wegen der Erkrankung. Ich bin ja nicht faul.
Haben Sie Schmerzen?
Ich habe keine Schmerzen. Nur in der Schulter beim Autofahren oder beim Arbeiten auf dem Hof. So wenn es bleiben würde, wäre es gut. Aber ich weiß, dass es nicht so bleibt.
Warum? Schlagen Ihre Therapien nicht an?
Die Therapie, die ich im Februar und März im Krankenhaus gemacht habe, hat nur sehr kurz angeschlagen. Aber meinen Ärzten fällt alle paar Wochen was Neues ein: Erfolgreich war zum Beispiel, als ich vor drei Jahren Stammzellen von einem Spender in England bekommen habe. Das war aber auch sehr heftig.
Wie muss man sich das vorstellen?
Stammzellen transplantiert zu kriegen ist, wie eine neue Niere oder ein neues Herz zu bekommen. Das neue Organ heißt Immunsystem. Ich habe zum Beispiel eine andere Blutgruppe als vorher – die von meinem Spender. Das Komplizierte ist: Das neue Immunsystem und der Körper passen nicht zusammen. Da laufen Abstoßungsreaktionen ab.
Was genau bedeutet das?
Oft wird ja eine Niere abgestoßen, und bei mir hätte es sein können, dass der ganze Körper abgestoßen wird. Das heißt: Tod. Deswegen bekomme ich Immunsuppressiva, die das unterdrücken und die ich lebenslang nehmen muss. Gefährlich wurde es, als sie ganz langsam ausgeschlichen wurden, damit sich das Immunsystem und der Körper aneinander gewöhnen. Man hat kein Immunsystem, ist also furchtbar anfällig für Infektionen und wird gleichzeitig noch geschwächt durch die Chemotherapie. Ich habe mich dann auch tatsächlich angesteckt, mit dem Epstein-Barr-Virus.
(Lesen Sie auf der nächsten Seite: Die halbe CSU hat vor dem Sepp
Daxenberger gezittert, die andere Hälfte wollte Sie am liebsten in den eigenen Reihen haben)
Das ist eine Infektion, die immungeschwächte Patienten fürchten. Wie haben Sie die überstanden?
Es war kritisch. Ich war fast fünf Monate im Krankenhaus. Ich bin im März 2007 aus dem Krankenhaus gekommen und habe nicht mehr gehen können, ich bin nur noch mit dem Rollator gefahren, Treppen gingen nur mit Krücken. Da war ich noch Bürgermeister in Waging. Aber ich habe schnell wieder angefangen zu arbeiten, zwei, drei Stunden am Tag. Die Therapie hat damals angeschlagen.
Nun haben Sie den Posten des Fraktionschefs abgegeben.
Im letzten Herbst sind die Krebswerte wieder gestiegen, da habe ich dann Blutplasma vom Spender bekommen, im November, Dezember und Januar. Das soll im Körper eine Abwehrreaktion bewirken, damit das Immunsystem sich neu ausrichtet. Es gibt Patienten, die mit dieser Methode fünf, sechs Jahre keinen Rückfall mehr haben. Ich habe zwar alle Nebenwirkungen gehabt, aber keine Wirkung. Die Werte sind nur kurzfristig gefallen und sofort wieder gestiegen. Die Chemotherapie hab ich zurzeit abgebrochen.
Ist das nicht gefährlich?
Es hilft mir doch nichts, wenn meine Ärzte sich zig Therapien einfallen lassen, damit ich noch möglichst lange lebe, ich aber vom Leben nichts habe. Aus der Palliativmedizin kommt der Satz: Man muss den Tagen viel Leben geben und nicht dem Leben viele Tage. Wenn ich nur zwischen Schlafzimmer und Kanapee hin und her wackle, nicht ans Telefon gehen kann, nicht essen kann, bringt das doch nichts.
Ärgern Sie sich eigentlich: Die halbe CSU hat vor dem Sepp
Daxenberger gezittert, die andere Hälfte wollte Sie am liebsten in den eigenen Reihen haben. Ohne Krankheit hätten Sie vielleicht erster grüner Umweltminister in Bayern werden können?
Momentan eigentlich nicht. Ich bin ein optimistischer Mensch. Ich bin jetzt 48, wenn ich auf dem Level weiterarbeiten kann, habe ich noch Perspektiven. Momentan juckt mich eine landespolitische Karriere nicht so, aber in vier Jahren sind Kommunalwahlen. Wenn ich halbwegs fit bin, dann überleg ich mir das.
Wie weit können Sie Ihr Leben planen? Die Wahl in vier Jahren – das hört sich gut an. Hat Ihnen Ihr Arzt etwas über Ihre Lebenserwartung gesagt?
Die Frage krieg ich nicht beantwortet. Die Krebserkrankung, die ich habe, kann nicht geheilt werden. Im Vergleich zu manch anderem Krebs ist meiner nicht aggressiv. Man stirbt nicht schnell, aber die Lebensqualität sinkt kontinuierlich, weil die Knochen porös werden und die Schmerzen stärker. Man kann mit diesem Krebs auch alt werden.
Wie sieht eine optimistische Prognose aus?
Wer vier Jahre nach der Behandlung noch lebt, ist für die Ärzte ein Erfolg. Für mich ist aber die Frage, wie ich lebe. Ein guter Bekannter, der zwei Jahre jünger war, ist vor drei Monaten gestorben. Der hat im Krankenhaus mein Bett gekriegt. Als ich rausgekommen bin, ist er reingekommen. Der hat im Schnelldurchlauf alle Behandlungen durchgemacht, aber bei dem hat einfach nichts angeschlagen. Er wollte nur noch sterben. Der hat selber drei Kinder, noch kleinere als meine Frau und ich. Und die Ärzte haben trotzdem gesagt: Das ist doch ein Erfolg, dass der so lange überlebt hat. Das trifft einen schon, wenn man sehen muss, dass gar nichts hilft.
Wie schützt man sich gegen solche Hiobsbotschaften?
Ich habe da eine ganz gute Verdrängungsstrategie, und ich versuche auch, mich nicht ständig mit dem Krebs zu beschäftigen. Ich habe eine Menge Fachbücher, aber ich lese das nicht dauernd. Ich war vor zwei Jahren im Krankenhaus, und neben mir lag einer, der hatte eine ähnliche Krebserkrankung wie ich. Der hat den ganzen Tag rumgegoogelt in seinem Laptop. Und dann ist seine Frau gekommen und die Familie, und sie haben sich die ganze Zeit nur über die Krankheit unterhalten. Ich habe zu ihm gesagt: Du, jetzt gehen wir raus und trinken ein Bier miteinander. Das hilft dir mehr.
(Lesen Sie auf der nächsten Seite: "Es gab Situationen, da habe ich gedacht: Wenn ich jetzt einschlafe und wache nicht mehr auf, ist es mir auch recht.")

Foto: dpa
Will man denn in so einer Situation nicht einfach alles über seine Krankheit erfahren, in der Hoffnung, keine Heilungschance auszulassen?
Schon, aber zu viel Information bringt einen auch nicht weiter. Als in der Zeitung gestanden ist, ich hör auf, da habe ich 200 Mails und 50 Briefe bekommen und Telefonanrufe. Das freut einen, und das ist gut gemeint, aber jeder Zweite hat auch irgendeinen Tipp: Viele kennen einen Arzt, das geht bis zum Geistheiler. Problematisch wird es, wenn die Leute drauf beharren, dass ich das tue, was sie mir raten. Ich könnte aus 100 Therapien auswählen. Ich sage dann: Ich habe mich entschieden, und das zieh ich jetzt durch. Ich kann ja auch nicht jede Woche meine Partei wechseln.
Ihre Frau hat auch Krebs, Brustkrebs, seit eineinhalb Jahren. Wie geht es ihr?
Sie hat die letzten Jahre Chemo bekommen, dann war es gut. Zu unser aller Entsetzen kam der Krebs aber im Januar wieder. Er hat abgestrahlt in die Lunge. Sie wurde operiert, hat wieder Chemo gemacht. Damit hat sie aber jetzt aufgehört. Was genau sie jetzt weiter macht, weiß ich gar nicht. Da frage ich auch nicht. Ich warte, bis sie es mir erzählt.
Jeder macht die Krankheit mit sich selbst aus?
Genau. Es ist auch eine Form von Selbstschutz. Aber natürlich hat jeder von uns ein offenes Ohr für den anderen.
Was macht so eine Krankheit mit einem Paar?
Es führt einen schon enger zusammen. Aber wenn wir uns über Krebs unterhalten, dann reden wir geschäftsmäßig darüber. Das hilft uns. Wir unternehmen auch wieder mehr miteinander. Mal am Sonntag ein Ausflug. Und die Kinder sollen ihr Leben ganz normal weiterleben. Die merken es schon, wenns der Mama schlechtgeht, dann gehen sie zum Mittagessen zur Oma.
Wie kommen Ihre drei Kinder damit klar, dass ihre Eltern so krank sind?
Die helfen alle mit auf dem Hof. Ich will nicht, dass sie jetzt Rücksicht nehmen. Die sollen nicht das Gefühl haben, hier ist eine halbe Leichenhalle. Sie sollen ganz normal aufwachsen.
Wie haben Sie es ihnen beigebracht?
Ich habe gesagt, dass ich in nächster Zeit öfter nicht gut beieinander sein werde, dass ich öfter ins Krankenhaus muss. Aber ich habe auch gesagt, dass alles wieder gut wird, dass sie keine Sorgen haben müssen, dass ich sterbe. Übers Sterben wird nicht geredet.
Sie wirken so gefasst. Packt Sie nicht manchmal Verzweiflung?
Manchmal, ja. Zum Beispiel als ich monatelang im Krankenhaus gelegen bin. Ich wurde künstlich ernährt, bekam Psychopharmaka, um das alles durchzuhalten. Man hat mich nach Traunstein verlegt und dann wieder mit dem Hubschrauber nach München. Ich war zwischen Leben und Tod. Ich bin nur noch apathisch dagelegen. Es gab Situationen, da habe ich gedacht: Wenn ich jetzt einschlafe und wache nicht mehr auf, ist es mir auch recht.
Was hat Ihnen Kraft gegeben?
Ohne meine Familie hätte ich das alles nicht durchgestanden. Es war jeden Tag jemand da. Zwei Stunden Zugfahrt jeden Tag von Waging nach München. Als es besser ging, haben sie mich mit dem Rollstuhl in die Sonne gefahren, das hat gutgetan. Es gibt schon Anflüge von Selbstmitleid, aber das sind nur kurze Sequenzen. Dann beschäftige ich mich schnell mit was anderem, mit etwas Positivem. Auch wenn ich abends im Bett liege.
Beten Sie?
Ja, vor dem Einschlafen spreche ich ein Gebet. Meine Familie, meine Frau und auch ich selbst sind da mit eingeschlossen. Bis vor wenigen Jahren habe ich dabei nicht groß nachgedacht, das lief so automatisch ab. Hilft’s nicht, dann schadet’s auch nicht.
Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?
Ich bin mir nicht sicher, ob es da was gibt im Jenseits. Aber es könnte ja sein.
Wie stellen Sie sich das Paradies vor?
Hier zu leben, hier zu sein. Mir passiert es immer öfter, dass ich von München heimkomme, das Auto hinstelle und nicht ins Haus gehe, sondern zu den Kälbern hinterschaue, denen etwas Heu gebe, dann vielleicht zum Obstanger gehe, ob den Bäumen etwas fehlt, oder ich fahre mit dem Auto ins Moos, um zu schauen, ob das Gras gewachsen ist. Und dann gehe ich erst rein ins Haus.
Foto: Dieter Mayr