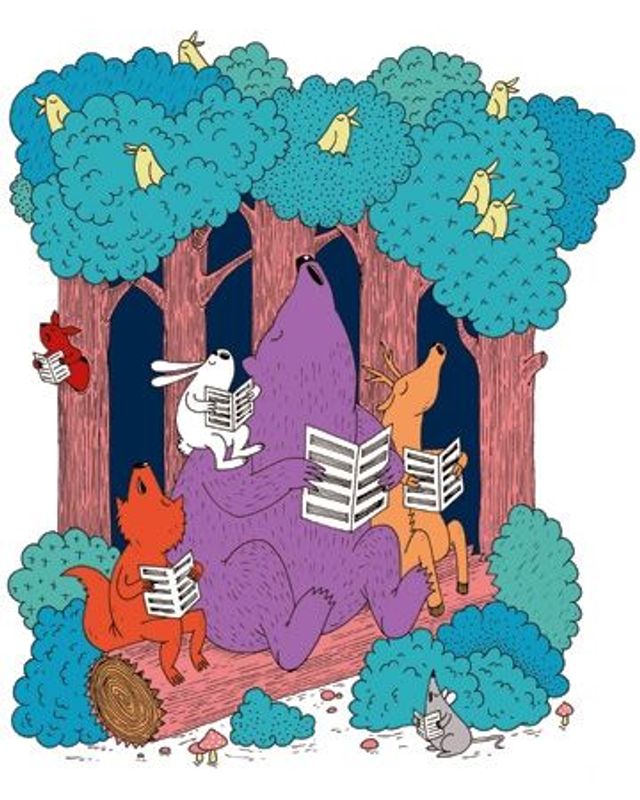Eigentlich wäre man gern mit Bernie Krause durch die unberührte Wildnis gestapft, um ihn dort zu treffen, wo der Kalifornier seit mehr als 40 Jahren hauptsächlich arbeitet. Doch leider ist Krause im Stress, er muss seinen Vortrag für die diesjährige TED-Konferenz in Long Beach vorbereiten. Dort wird er der Welt erklären, wie Ameisen klingen und warum es ohne die Klangwelten der Wälder keine Musik gäbe, wie wir sie kennen. Krause war nicht immer im Wald – als junger Mann war er selbst ein gut gebuchter Musiker und Klangtüftler. Er arbeitete mit den Doors zusammen und wirkte an Soundtracks berühmter Filme wie »Apocalypse Now« und »Rosemary’s Baby« mit. Dann fand er in den Geräuschkulissen der Natur eine Welt, die ihn nicht mehr losließ. Unser Gespräch findet am Telefon statt.
SZ-Magazin: Herr Krause, was hören Sie gerade, wenn Sie Ihre Ohren spitzen?
Bernie Krause: Das leise Surren meines Computers.
Sonst nichts?
Nein, ich sitze im Tonstudio in meinem Haus. Es ist schallisoliert.
Und wenn Sie mal nach draußen treten?
Dann könnte ich die Stimmen von ungefähr zehn verschiedenen Vogelarten unterscheiden. Unser Grundstück ist etwa zweieinhalb Hektar groß und bietet relativ unberührte Vegetation. Manchmal kann ich Füchse kreischen oder bellen hören. Eine Fuchsmutter kann einen ziemlich furcht-erregenden Schrei ausstoßen, um ihre Welpen zu schützen.
Wo waren Sie zuletzt, um Naturgeräusche aufzunehmen?
In Alaska, etwa dort, wo die Inselkette der Aleuten beginnt. Ist aber schon Jahre her. Zurzeit arbeite ich viel in der Umgebung, auch weil ich nicht mehr der Jüngste bin. Am liebsten mache ich Aufnahmen kurz vor Sonnenaufgang, wenn das Konzert der Tiere am lautesten ist. Wir nennen das »Morgenchor«.
Warum machen Tiere gerade bei Sonnenaufgang solch ein Spektakel?
Weil die meisten Tiere aus ihrem Schlaf aufwachen, wie wir auch. Sie singen, um ihr Territorium zu markieren, um sich aufzuwärmen. Das Licht kehrt zurück, und aus irgendeinem Grund scheinen sie den anbrechenden Tag willkommen zu heißen. Man darf nicht vergessen: Das Überleben von Tieren hängt auch davon ab, sich mitteilen zu können. Jedes Tier will seine Nische finden, in der es kommunizieren kann, ohne von anderen gestört zu werden – wie eine Funkfrequenz. Die Klangsignatur bildet seinen Platz im Leben ab.
Sie behaupten, jede Form von Musik hat ihre Wurzeln in natürlichen Klängen. Woran machen Sie das fest?
Ich glaube, Tiere haben uns gelehrt, wie man singt und tanzt. Eingeborenenstämme imitieren noch heute die Klänge und Laute ihres Habitats, die Arrangements, die Rhythmen. Menschen sind gut darin, etwas nachzuahmen. Diese Gabe hat unsere Ausdrucksweise geprägt. Dabei waren es nicht so sehr die Laute eines einzelnen Vogels oder eines Frosches, sondern die kollektiven Laute eines Habitats. Wenn Sie die Klangdiagramme eines natürlichen Morgenchors und einer Mozart-Sinfonie vergleichen, werden sie Ähnlichkeiten im Aufbau erkennen. Diese Gabe, Musik zu Sinfonien zu verdichten, haben wir nicht in der Schule gelernt, sondern in den Urwäldern der Urzeit.
Wie wurde aus Nachahmung schließlich Musik?
Darüber können wir nur spekulieren. Vielleicht haben die Urmenschen versucht, die Naturklänge zu imitieren, um ihre Spiritualität auszudrücken, irgendetwas, was jenseits des Sagbaren liegt. Musik hat emotionale, mystische, aber auch praktische Bedeutung. Bestimmte Laute deuteten vielleicht auf Nahrung hin. Natürliche Klanglandschaften waren unser Medium, unser Nachrichtenkanal damals. Bestimmte Affen verständigen sich noch heute über Rhythmen, die sie auf Feigenbäumen erzeugen – haben wir uns das abgeschaut?
Sie waren selbst mal Musiker. Warum hat es Sie plötzlich in den Wald gezogen?
Mitte der Sechzigerjahre lernte ich Paul Beaver kennen, einen experimentellen Musiker, der Sounds kreierte für Pulp-Filme. 1967 traten wir als Beaver & Krause auf dem Monterey Pop Festival auf, als eine der ersten Bands mit Moog-Synthesizer. Durch diesen Auftritt bekamen wir einen Plattenvertrag und nahmen einen Guide für elektronische Musik auf, der 26 Wochen in den Charts war. Danach sollten wir für Warner Brothers ein Album zum Thema Ökologie aufnehmen. Für ein Album über die Natur brauchte man natürliche Klänge. Da mein Partner nicht der Outdoortyp war, habe ich mich mit zwei Stereomikros und einem Tonband auf den Weg gemacht.
Wo sind Sie für Ihre ersten Aufnahmen hingegangen?
Ich bin in den nächstbesten öffentlichen Park nördlich von San Francisco spaziert. Es war Oktober und eigentlich waren kaum Tierlaute zu hören. Aber allein der Raum, der sich plötzlich auftat, die Weite! Das hat mich sofort gefangen genommen. Ich verbrachte bald mehr Zeit im Wald als woanders. Es tat mir gut, still sein zu müssen. Ich leide an ADHS, kann mich bei Stress schlecht konzentrieren. Je mehr ich mich von der Zivilisation entfernte, desto ruhiger wurde ich. Es war also auch eine Selbsttherapie, weniger ein Forschungsinteresse. Das kam dann später.
Nach vierzig Jahren in der Natur: Was ist Ihre größte Erkenntnis?
Dass selbst vermeintlich einfache Tiere zu tiefen Gefühlen fähig sind. Ein Kollege von mir hat einmal in den Wäldern des mittleren Westens Aufnahmen an einem Teich gemacht, der seit der letzten Eiszeit nahezu unberührt war. Er wollte die Töne einer dort wohnenden Biberfamilie aufnehmen. Eines Tages tauchten ein paar Jagdaufseher auf und sprengten ohne ersichtlichen Grund den Biberdamm samt Bibermutter und Jungen in die Luft. Mein Kollege war geschockt, beschloss aber trotzdem, den restlichen Tag Aufnahmen zu machen. Der Bibervater schwamm in langsamen Kreisen um die Stelle, wo zuvor der Damm gewesen war, und hörte nicht auf zu klagen. Ich sage Ihnen, es sind die markerschütterndsten Laute, die ich je von einem lebenden Wesen gehört habe.
In Ihrem aktuellen Buch beschreiben Sie, dass selbst kleinste Lebewesen eine eigene Klangsignatur haben, zum Beispiel auch Ameisen.
Oh ja. Einmal war ich in der Wüste, um dort nach interessanten Soundscapes zu suchen. Leider hatten wir unser Lager direkt neben einem Bau roter, sehr aggressiver Feuerameisen aufgebaut, die überall wie wild herumkrabbelten. Nach ein paar Bieren ließ ich ein kleines Mikro durch den Haupteingang ihres Baus hinunter und drückte den Aufnahmeknopf. Ich hörte kratzende Geräusche und sah, wie die Ameisen ihre Beinchen an ihren Bäuchen rubbelten, um sich darüber zu verständigen, dass hier ein Problem existiert, das aus dem Bau geschafft werden muss. Sie kommunizierten über Klänge, nicht über Pheromone oder Duft. Danach hab ich andere Kleinstlebewesen aufgenommen: zum Beispiel Insektenlarven und sogar Bakterien oder Viren.
Wie hören sich Viren an?
Wenn ein Virus sich von einer Zelle losmacht, erzeugt es ein klickendes Geräusch, wie wenn man mit den Fingernägeln schnippt. Übrigens sind kleine Lebewesen nicht unbedingt die leisesten. Und große nicht die lautesten: Eine Giraffe erzeugt sehr tiefe, leise Töne, unter 20 Hertz, kaum wahrnehmbar.
Von Walen heißt es, sie können über Hunderte von Kilometern kommunizieren. Was könnte lauter sein?
Das stimmt: Der Gesang der Wale ist so mächtig, dass er einmal um die ganze Welt wandern würde, stünden keine Kontinente im Weg. Das lauteste Geräusch der Tierwelt, gemessen an seiner Größe, wird allerdings von einem Tier erzeugt, das kaum größer als vier Zentimeter ist: dem Knall- oder Pistolenkrebs. Er schnappt mit seiner Schere so schnell unter Wasser, dass eine sogenannte Kavitationsblase entsteht, die mit einem unglaublich lauten Knall implodiert, mit etwa 200 Dezibel. Das ist annähernd so laut wie ein Wal.
Trotzdem erscheint dem Laien die Unterwasserwelt alles in allem eher leise.
Oh nein, sie ist alles andere als leise. Ich allein habe in meinem Archiv Laute von 200 verschiedenen Fischarten. Schnorcheln Sie mal zu einem Korallenriff, und Sie werden eine sinfonische Explosion erleben! Nur ein Beispiel: Dort gibt es Umberfische, die man nicht umsonst Trommler nennt. Ihre Laute hören sich an wie die Basstrommel eines Rockschlagzeugs.
Warum machen Sie Ihre Aufnahmen? Nur für sich oder für die Nachwelt?
Ich arbeite mit Orchestern und Komponisten zusammen, nehme Alben auf oder arrangiere Klanginstallationen für Museen. Und natürlich will ich auch der Wissenschaft dienen. Ich besitze eine der wenigen Sammlungen von Klanglandschaften von vor 45 Jahren. So hat sich die Welt damals angehört. So wird sie sich nie wieder anhören.
»Der Gesang der Wale ist so mächtig, dass er einmal um die ganze Welt wandern würde, stünden keine Kontinente im Weg.«

BERNIE KRAUSE
1938 in Detroit geboren, arbeitete Krause in den Sechzigerjahren zunächst als viel beachteter Folkmusiker, wandte sich dann aber ganz der Erforschung von Naturklängen zu. Heute umfasst sein Privatarchiv 4500 Stunden an Naturaufnahmen, auf denen 15 000 verschiedene Tierarten zu hören sind. In Kürze erscheint sein Buch »Das große Orchester der Tiere - Vom Ursprung der Musik in der Natur« (Kunstmann). (Foto: Tim Chapman)
Was hat sich verändert?
Ein Großteil dieser Aufnahmen stammt von Tieren, die heute ausgestorben sind. Das ist die große Tragödie unserer Zeit. Die Bioakustik eines Habitats lässt große Rückschlüsse darauf zu, wie gesund es ist.
Wie klingt ein gesundes im Vergleich zu einem gestörten Habitat?
In einer gesunden Umwelt haben alle Insekten, Reptilien, Amphibien, Vögel und Säugetiere ihre akustischen Nischen. Man kann das sehr gut beobachten in den Klangspektrogrammen, das sind unsere Audio-Schnappschüsse eines Habitats. In einem gestörten Habitat geht diese Ordnung verloren. Die Tiere versuchen neue Nischen zu finden, auf andere auszuweichen. Das Klangdiagramm wird diffus, gerät aus dem Gleichgewicht.
Gibt es überhaupt noch unberührte Habitate heutzutage?
In Alaska, in den Nordwest-Territorien von Kanada, wo kein Bergbau betrieben wird. Im südamerikanischen Regenwald. Oder in Afrika, aber dort werden sie rapide weniger. In Europa ist es schon schwerer, solche Orte zu finden. Es gibt allerdings einen, wo die natürliche Soundlandschaft sogar zurückkehrt: Tschernobyl.
Was ist der stillste Ort, den Sie kennen?
Einmal wanderte ich runter in den Grand Canyon und fand einen kleinen Seitencanyon abseits des Flusses mit etwa hundert Meter hohen Wänden aus Sandstein. Ich konnte das Blut durch meine Venen rauschen hören. Es war so beunruhigend, dass ich zurück zum Fluss ging, um weiterzuwandern. Der Ausschlag auf meinem Aufnahmegerät war nicht wahrnehmbar, also unter zehn Dezibel. Es gibt noch einen Tag, den ich nie vergessen werde: den Tag nach dem 11. September 2001. Kein Flugzeug in der Luft, der Straßenverkehr erloschen. Ich saß zusammen mit meiner Frau im Garten, und es herrschte eine absolut atemberaubende, unwirkliche Stille, wie wir sie nie zuvor und nie wieder danach vernommen haben. Es war gespenstisch und wunderbar zugleich.
Illustration: Dirk Schmidt