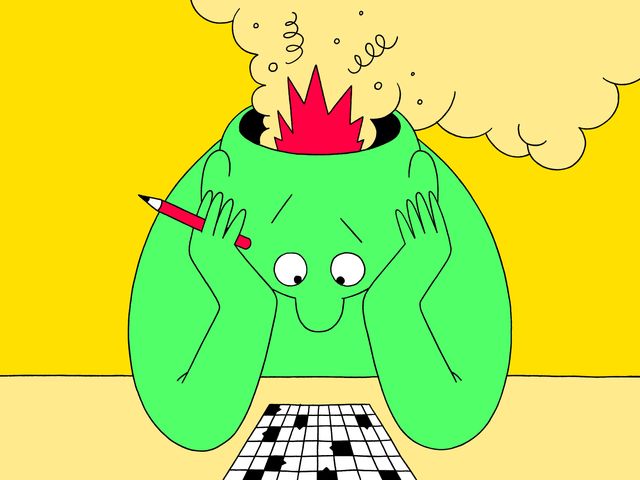Ich habe eine Taxi-App und eine Uber-App. Ich werde sie löschen. Ich brauche sie nicht mehr, ich werde nicht mehr Taxi fahren. Man mag mir Kleinlichkeit nachsagen, aber mein Leben ist mir wichtiger als die SMS, die die Fahrer, während ich in ihrem Auto sitze, in eines ihrer Handys eintippen. Ich hab die Schnauze voll davon, dass sie in ihren Handys nach der Route suchen, während wir längst fahren: »Plinganserstraße?« – »Nein, Pasinger Straße«. – »Wie?«
Ein normales Taxi oder Uber-Auto ist ja heute ausgestattet wie ein Space-Shuttle: Mit mindestens zwei Handys, eines für die Bestellungen per App, das andere für private Gespräche und Mitteilungen, ein Bildschirm in der Konsole, auf dem man wahlweise Rückfahrkamera, Radio, GPS-Funktion oder Telefon bedienen kann; ein weiterer Bildschirm, an dem die Taxizentrale erkennt, wo sich der Fahrer gerade befindet, und der die Durchsagen auf »Kanal 3«, oder wo auch immer, »für Schleißheimer 48, Müller« überflüssig macht. Viele Autos haben obendrein noch ein GPS-Gerät, das per Saugnapf an der Windschutzscheibe haftet. »Warum?«, hab ich kürzlich einen Fahrer gefragt. »Falls die anderen kaputt gehen«, hat er gesagt.
Lang hab ich mich wohlgefühlt in meiner Haut, fand es gut, dass wir zu dritt nur ein Auto besitzen, dass ich meist Rad oder Bus oder Trambahn fahre, auch lieber den Zug als das Flugzeug nehme, und dass ich nur dann, wenn es eilt oder ich zum Bahnhof muss, ein Taxi rufe. Doch inzwischen habe ich Angst: Zu oft wurde mir eingetrichtert, dass SMS schreiben oder lesen die häufigste Unfallursache nach Alkohol ist. Und ich schon bei Tempo 50 in einer Sekunde 14 Meter zurücklege, auf denen sonstwas passieren kann, das ich nicht sehe, weil ich eine Kurznachricht schreibe.
Er führte sich so auf, dass ich das Gefühl haben musste, das lästige Autofahren unterbreche seine eigentliche Tätigkeit: mit dem Smartphone zu hantieren.
Vor zwei Wochen ist mir der Geduldsfaden gerissen: Auf dem Weg zum Bahnhof hielt der Taxifahrer erst sein Handy ans rechte Ohr und unterhielt sich. Natürlich kann man sagen, ich solle froh sein, dass er keine Freisprechanlage benutzte, sonst hätte ich das Gequacke von beiden Männern gehört. Ich war aber nicht froh, ich machte mir Sorgen. Um mich, meine Unversehrtheit, meine Zukunft. Kaum hatte der Fahrer aufgelegt, schrieb er mit der rechten Hand eine Kurznachricht, die linke hielt er am Lenkrad, sein Gesicht rückte nah ran an das Smartphone, die Rechtschreibung! Blick nach vorn, schon klingelte es kurz, er hatte er eine Antwort bekommen. Rechte Hand aufs Handy, mit zwei Fingern die Schrift größer ziehen. Er führte sich so auf, dass ich das Gefühl haben musste, das lästige Autofahren unterbreche seine eigentliche Tätigkeit: mit dem Smartphone zu hantieren. Ich jedenfalls nahm fast all meinen Mut zusammen und bat ihn jetzt deutlich und laut, damit aufzuhören, sonst würde ich aussteigen. Da dreht er sich um zu mir, blaffte mich an, machte mich zur Minna mit den Worten: »Ich fahre seit 17 Jahren unfallfrei. Und von Ihnen lass ich mir nicht vorschreiben, was ich tun darf, und was nicht!« Endlich dreht er sich wieder nach vorn und schaute auf die Straße. Oder tat so.
Er hielt nicht an, damit ich aussteigen konnte, er telefonierte aber auch den Rest des Weges nicht und schrieb auch keine Kurznachrichten mehr. Ich war zu feige, ihm kein Trinkgeld zu geben. Als ich vor ein paar Tagen wieder ein Taxi rief und der Fahrer, ein anderer, wieder SMS schrieb, hatte ich Angst davor, mich nochmal zusammen falten lassen zu müssen, so dass ich lieber mutig meinem Tod ins Auge sah, als ihn zu bitten, mit dem Tippen aufzuhören. Ich habe nur einen Ausweg gesehen: Nicht mehr Taxi zu fahren. Wird auch gehen. Muss ich halt früher aufbrechen.