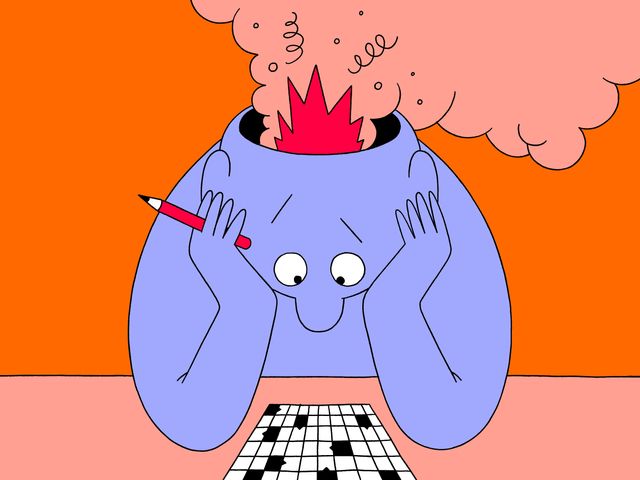Es begann damit, dass der Amerikaner vom Himmel fiel.
Der Maierbub sah es zuerst. Am 9. Dezember 1944 war das, nach dem Mittag, die Luft trüb und kalt. Das Bombenflugzeug kam plötzlich über die Hänge gebrummt, qualmend, die Bäume zitterten. Ein Benzinkanister landete auf dem Feld. Klonk. Danach etwas Schwereres. Flatsch. Es war der Pilot. Sein Fallschirm hatte sich nicht geöffnet. Der Kopf war Brei. Das Haar, schwarz und lockig, schwamm darin. Die Beine hatten sich in den Bauch gebohrt. Das Flugzeug schlingerte unbemannt weiter, Richtung Frankreich. Brown hieß der Amerikaner, Robert H. Brown, geboren am 21. Juli 1921, Erkennungsmarke 0-815824-D.
Den verscharren wir gleich da am Waldrand, befahl der Ortskommandant, Stabsveterinär Braunschweig. Abends hörte der Bürgermeister davon, Josef Schwendemann. Das geht nicht, sagte Schwendemann, jeder braucht eine anständige Ruhestätte. Am nächsten Tag bestatteten die Totengräber den Amerikaner auf dem Friedhof.
So kam der Krieg nach Welschensteinach im Kinzigtal, mittlerer Schwarzwald, 892 Einwohner, 55 Höfe. In den ersten drei Monaten des Jahres 1945 kamen dann die, die vor dem Krieg flohen, Familien aus dem ganzen Reich, und vom Westen die Truppen auf dem Rückzug. Am 19. April 1945 errichtete der Volkssturm Schützenlinien hinter dem Dorf. In der Nacht stieß ein Bataillon unter dem Kommando eines Ritterkreuzträgers dazu. Sie bauten Panzersperren auf dem Weg nach Schweighausen. Beim Lixenhof sprengten sie die Straße. Am 20. April, Hitler hatte Geburtstag, bezogen die Soldaten Stellung auf dem Kirchberg, rund um das Pfarrhaus und die Schule.
Um 14 Uhr begann der Artilleriebeschuss, es pfiff und krachte, aber man sah die Franzosen hinterm Hügel nicht. Am schlimmsten erwischte es das Backhäusle vom Maier Josef. Die Wand hat es weggerissen, im Keller saß die Familie, großes Glück. Die Soldaten und der Ritterkreuzträger machten sich davon. Nur der Volkssturm blieb. Mit Maschinengewehren wollten sie die Franzosen, die nun von Schuttertal runterkamen, aufhalten. Zwei Deutsche starben. Auf der Gegenseite fünf. Der Rapp-Josef und Stulzens Theresia waren die einzigen verletzten Zivilisten. So endete der Krieg in Welschensteinach. Und doch nicht.
Die Besetzung erfolgte am Samstag, den 21. April 1945 um 6 Uhr morgens. Widerstand: keiner. Die meisten Franzosen strömten weiter Richtung Front. Doch am 22. April 1945 tauchte gegen Abend beim Pfarrer Hildebrand ein französischer Soldat auf, der ein Dokument vorzeigte, das ihn zum Ortskommandanten von Welschensteinach ernannte. Der Mann sprach sehr gut Deutsch. Er ließ sich »Kommissar« nennen. Sein Name: René Ungar-Klein. 22 Jahre erst. Ein Jude, hieß es, aus dem Elsass.

René Ungar-Klein im Alter von 18 Jahren. Es ist das letzte existierende Foto vor Ungar-Kleins Auftauchen in Welschensteinach. Foto: privat.
Ungar-Klein quartierte sich in der Schule ein. Bald traute sich dort niemand mehr vorbei. Der »Kommissar« war kein großer Mann, aber eine Erscheinung. Oft fuchtelte er mit seiner Pistole. Mit den verbliebenen französischen Soldaten plünderte er Häuser, beschlagnahmte auch den Besitz der Flüchtlingsfamilien, die nach Welschensteinach gekommen waren, Schmuck, Pelzmäntel, Möbel, manche behaupten, im Wert von mehreren Hunderttausend Mark. Als seine Soldaten weiterzogen, bewaffnete der Kommissar ehemalige Zwangsarbeiter von den umliegenden Höfen, Polen. Auch sie raubten – und verprügelten die Leute oder sperrten sie ins Schulzimmer. Der Bürgermeister beschwerte sich bei der französischen Militärbehörde in Haslach. Aber es ging weiter.
Am 28. April ließ René Ungar-Klein auf dem Friedhof einen Regierungsobersekretär des Straßenbauamtes Offenburg, der in der Nähe festgenommen worden war, erschießen, Punkt 16 Uhr. Franz Neumaier, Rentner, und Bernhard Maier, Gastwirt, mussten das Grab schaufeln.
Zwei Tage später erschien ein Oberst der US Air Force. Er suchte einen verschollenen Soldaten. Genau, Robert H. Brown.
Der Pfarrer zeigte dem Oberst, wo er den Amerikaner hatte beerdigen lassen. Der Oberst war dankbar. Im Vertrauen bat der Pfarrer den Oberst um Hilfe. Er berichtete vom Treiben des »Kommissars«. Von der Angst. Der Oberst stellte Ungar-Klein zur Rede. Einige Tage später teilte die Gendarmerie René Ungar-Klein mit, er müsse das Dorf innerhalb 24 Stunden verlassen. Am 5. Mai ließ sich der »Kommissar« noch vom Bürgermeister Schwendemann standesamtlich mit einer deutschen Luftwaffenhelferin trauen, dabei hielt er seine Pistole gezückt. Dann verschwand er. René Ungar-Klein war nur zwei Wochen in Welschensteinach. Aber er ist bis heute geblieben.
»Da stand er immer und hat gebrüllt«, sagt Horst Maier und zeigt auf die Stufen vor dem Rathaus, das früher zugleich Schulhaus war, das Ungar-Klein besetzt hielt und in dem zuletzt die Sparkasse untergebracht war, weil es seit der Gemeindereform kein Rathaus mehr brauchte, aber jetzt braucht es auch keine Sparkasse mehr, alle sind online. »Wir Kinder sind dem Kommissar nicht zu nahe gekommen«, sagt Maier, der kleine Junge, der auf dem Feld stand, als der Amerikaner vom Himmel fiel. Maier ist ein kleiner Mann mit einem spitzen Grinsen geworden, und er grinst auch, wenn er von diesen »schlimmen Tagen« erzählt.
Neben ihm steht sein Bruder Erich, noch kleiner, noch spitzer grinsend. Erich war ein Baby, ein Jahr alt, als der »Kommissar« auftauchte, vergangenes Jahr hat er Siebzigsten gefeiert. Die Mutter hatte den Kinderwagen in den Keller geschleppt, kurz bevor die Wand vom Backhäusle wegkrachte. Außer den Maier-Brüdern gibt es nur eine im Ort, die damals schon gelebt hat, die Tochter der Wirtsfamilie, aber die erinnert sich nicht an damals. Erich Maier ist der Ortsvorsteher, er hat einen Schreibtisch im Rathaus, für den Papierkram. Im ersten Stock, wo René Ungar-Klein mit seinen Getreuen residierte, leben jetzt laut Erich Maier »Sozialhilfeempfänger«.
»Der ›Kommissar‹«, sagt Horst Maier, »hat die Männer gezwungen, ihn auf dem Rücken durchs Dorf zu tragen! Wie Tiere!« »Du hast den noch vor Augen?«, fragt Erich Maier. Fotos existieren nicht.
»Ha, logisch«, sagt Horst Maier, »ein furchterregender Kerl!«
Sie haben nie über den »Kommissar« gesprochen, niemand hat viel über ihn gesprochen, der Schreck ging still in die DNS des Dorfes und seiner Einwohner über, man raunte den Namen Ungar-Klein höchstens, beim Frühschoppen oder nach dem Gottesdienst. Als schäme man sich. Vielleicht wollte niemand darüber nachdenken, wofür sich die Zwangsarbeiter, die dem Kommissar halfen, eigentlich hatten rächen wollen. Über die Schuld des Kommissars und seiner Komplizen nachzudenken hätte bedeutet, über die eigene Schuld nachzudenken. In der Welschensteinacher Ortschronik, verfasst 1965, steht zu René Ungar-Klein: »In den Tagen seiner Herrschaft in Welschensteinach übte er ein Schreckens- und Terrorregiment aus. Danach konnte die Gemeinde wieder aufatmen.« So endet das Kapitel Nationalsozialismus, als wäre darin der »Kommissar« der schlimmste Verbrecher gewesen.
Interessant ist auch, was in der Ortschronik, deren Verfasser nicht mehr lebt, über den weiteren Verbleib von Ungar-Klein geschrieben ist: »Er soll sich noch einige Wochen in Haslach aufgehalten haben, kam dann, nachdem man seine Zugehörigkeit zur deutschen Waffen-SS feststellte, in das Lager Lahr-Diglingen, von wo er über Straßburg nach Israel flüchtete.« Auch in einer Veröffentlichung des Historischen Vereins für Mittelbaden aus dem Jahr 1985 wird die Episode um René Ungar-Klein als »schlimme Köpenickiade« bezeichnet.
Ein Hochstapler? Ein elsässischer Jude im Dienst der Waffen-SS? Der dann als französischer Soldat ein abgelegenes Schwarzwalddorf tyrannisiert?
»Ja, eine verrückte Gschicht«, sagt Erich Maier. Er hat sein ganzes Leben probiert, hier wieder Normalität herzustellen. Hat als Förster die Wälder aufgeräumt. Hat als Ortsvorsteher die deutsch-französische Freundschaft mit der elsässischen Gemeinde Truchtersheim aufgebaut. Reist seit Jahren nach Israel. Aber oft hat er bei der Einreise am Ben-Gurion-Airport gedacht: Wo ist der »Kommissar« geblieben?
Dann, vor zwei Jahren, rief bei Maier einer an. Der Name: Ungar-Klein. Oh, grüß Gott. Es war der Sohn. Jahrgang 1952. Aus Wien. Er wollte nach Welschensteinach. Ha, gut, Maier zeigte dem Mann, was es zu zeigen gibt. Der Mann fragte nichts. Maier auch nicht. Er gab dem Sohn eine Dorfchronik. Also, tschüssle. Reichen Sie meine Nummer nicht weiter, bat Ungar-Klein.
Der Historiker Manfred Hildenbrand, Ehrenbürger der Stadt Haslach, hörte von dem Besuch. Er brachte es fertig, einen Artikel über »Kriegsverbrechen« in der Region zu verfassen, in dem sowohl das Haslacher KZ als auch Ungar-Kleins »Ausschreitungen« erwähnt werden. Vorher rief Hildenbrand Ungar-Kleins Sohn an, der ihn harsch abwies. Maier hat Angst, der Sohn des »Kommissars« könnte denken, er hätte Hildenbrand die Nummer gegeben.
Man findet die Nummer jedoch, ohne dass Maier sein Wort brechen muss. Aber egal, wie oft man ihn fragt: Der Sohn will nicht über seinen Vater reden.
In französischen und deutschen Archiven findet sich nichts zu René Ungar-Klein. Auch nichts zu Colonel Rocaut, der den »Kommissar« enttarnt haben soll. Der US-Oberst, der Ungar-Kleins Verhalten zuerst gemeldet hatte, ist verstorben.
Schließlich ist es ein Eintrag in einem Ahnenforschungs-Forum, der weiterhilft. Eine Miriam Lieder hat einen Stammbaum für einen René Ungar-Klein angelegt. Miriam Lieder ist seine Tochter.
Ganz ehrlich, sagt Miriam Lieder, ich weiß es nicht, aber ich würde bei meinem Vater nichts ausschließen.

Laut den Berichten der Dorfbewohner verbreitete Ungar-Klein mit den ehemaligen Zwangsarbeitern, die er bewaffnet hatte, Angst und Schrecken ind Welschensteinach.
Lieder, 65 Jahre, empfängt in ihrem vollgestellten Garten neben dem vollgestellten Haus, das sie einst mit ihrem Mann Theo in Korneuburg gebaut hat und das nie richtig fertig geworden ist, zwischen Bahngleisen und Donau gelegen, nördlich von Wien. Miriam Lieder erzählt gern von ihrem Vater, aber: Leicht ist es nicht. Das Rauchen fällt ihr leichter. Der Bruder hatte ihr die Ortschronik von Welschensteinach geschickt. Ein Scheißbuch, sagt Lieder. Sie kannten ja Gerüchte über die Zeit im Schwarzwald. Aber das. Ein rechter Scheiß. Das ist nicht der Papa. So gar nicht. Aber der Reihe nach. Zigarette für Zigarette. Lieders Mann Theo hilft zwischendurch beim Erzählen. Dass er René Ungar-Kleins mittlere Tochter liebt, merkte er erst viele Jahre, eine erste Ehe und drei Kinder nachdem er die Ungar-Kleins kennengelernt hatte. Theo Lieder, zehn Jahre älter als Miriam, kennt die Familie seit dem 19. Dezember 1954, da war Miriam fünf. Die Ungar-Kleins waren gerade nach Wien gezogen, und da kamen sie, René, Beate, die drei Töchter und der kleine Sohn, zu einer Chanukka-Feier im Drachentheater, Theo spielte Akkordeon.
Miriams älteste Schwester lebt heute im Elsass. Die jüngere verstarb mit 45 an Diabetes, das hatte sie vom Papa.
Lieder holt jetzt die Fotos und die Dokumente vom Speicher. Die Ortschronik nicht. Das hier ist das Leben von René Ungar-Klein ohne Welschensteinach.
Geboren wird er am 5. Juli 1923 in Wien, als René Ungar. Sein Bruder ist zwei Jahre älter. Als René drei ist, nimmt sich der Vater, ein Kaufmann, das Leben, weil er davon überzeugt ist, an einem Hirntumor erkrankt zu sein. René kommt zum Bruder der Mutter, geborene Klein, und dessen Frau. Nach Straßburg. Die Stiefeltern können keine Kinder bekommen. Der Bruder neidet René die Ferne. René neidet seinem Bruder das Zuhause. Er ist ein aufmüpfiges Kind, mit sieben schicken die Stiefeltern ihn auf ein Internat nach Nancy. Er wechselt wohl später noch auf ein weiteres katholisches Internat, ein rundlicher, jüdischer Junge, der nur das Fechten mag und gut mit seinen Worten ficht, zu gut, wenn es nach seinen Lehrern geht. Als René 15 ist, der Krieg rückt näher, adoptieren ihn die Stiefeltern, es war immer Hass und Liebe, immer Ja und Nein. René Ungar heißt von da an Ungar-Klein.
1940 besetzt die Wehrmacht das Elsass. Die Adoptiveltern fliehen in den Süden Frankreichs, sie mieten insgesamt 17 Wohnungen bis Kriegsende. René lernt Hotelfachmann in der Schweiz, am Genfer See. Was noch bekannt ist: Er ist später im Umfeld der elsässischen Résistance-Bewegung aktiv. Verhilft Juden zur Flucht in die Schweiz. Bewegt sich in Straßburg mit der Identität eines Verstorbenen aus Vorarlberg, auch in deutschen Uniformen. Versteckt sich eine Zeit in einem Kloster.
Aber Miriam Lieder hat nie so genau zugehört, wenn der Papa, ein schlimmer Frühaufsteher, die Kinder weckte und im Morgenschimmer seine Geschichten erzählte. Leider. Theo Lieder sagt: Ach, er hat eh keine Details erzählt. Aber viel geprahlt, Widerstand, Nazis, Frauen.
Der Papa, sagt Miriam Lieder, ließ sich von jedem, der nach Deutschland fuhr, Roth-Händle-Zigaretten mitbringen. Selber fuhr er kaum nach Deutschland, weil seine Frau, die Mama, im Land der Mörder nicht mal auf die Autobahntoilette wollte. Er sagte, er kenne die Roth-Händle-Fabrik aus seiner Zeit im Schwarzwald. Er rauchte die Roth-Händle nie, nur leichtere Zigaretten. Aber sie machten ihn froh.
Eigentlich, sagt Miriam Lieder, fehlen die Jahre 1942 bis 1945 komplett. Danach, ab Sommer 1945, beteiligt sich Ungar-Klein von Straßburg aus wohl am Schmuggel von Kriegswaffen aus dem heutigen Tschechien ins heutige Israel, wo die Zionisten ihren eigenen Staat gründen wollen und die Briten das zu verhindern versuchen. Ungar-Klein gerät ins Visier der Behörden. Er muss weg. Mal wieder. Wer weiß.
Ende 1946 besteigt er in Marseille ein Schiff in Richtung Palästina, ein Schiff voller Juden. Es wird von den Briten abgefangen und nach Zypern gebracht. Dort, im Lager, lernt René Beate kennen, zwei Jahre jünger, eine Berlinerin, deren Vater auf einem der Todesmärsche aus Auschwitz umkam. Sie heiraten, Beate in kurzer, weißer Hose. Die erste Tochter wird kurz danach auf Zypern geboren. Als der UN-Teilungsplan für Palästina beschlossen ist, darf die Familie nach Israel, 30. November 1947. Renés leibliche Mutter ist schon dort. Beate versteht sich nicht mit ihrer Schwiegermutter. Nicht nur deshalb erträgt René Israel nicht. Es seien ihm dort zu viele Juden, sagt er einmal. Zu viele Orthodoxe.
Den israelischen Unabhängigkeitskrieg überlebt Ungar-Klein als Soldat 1948 knapp, danach lässt er sich immer neue Ausreden einfallen, um nicht mehr in den Kampf zu müssen. Als Beate noch mit Miriam schwanger ist, behauptet er, das Mädchen wäre schon auf der Welt und meldet gleich eine weitere Schwangerschaft an; ab dem dritten Kind muss man keinen Wehrdienst mehr leisten.
Je weniger ihm Israel gefällt, desto mehr schwärmt René Ungar-Klein von Österreich, dem Land, das er seit der Kindheit nicht gesehen hat. Er weiß noch nicht, dass die Polizei im Krieg vor der verwaisten Wohnung der Mutter gestanden hatte, wo auch er nach wie vor gemeldet gewesen war. Er sollte deportiert werden. Er weiß noch nicht, wie tief der Antisemitismus weiter sitzt in Österreich. Er denkt, in Wien wäre alles besser. So wie er denkt, im Sozialismus wäre alles besser, bis er nach Litauen reist.
Einmal kommen die Adoptiveltern nach Israel und wollen René, fast dreißig, nach Frankreich holen – ohne Frau und Kinder. Sie wollen nur den Sohn. Aber der hat nun ein Leben, das er nie verlassen würde.
1954 zieht die Familie in sein gelobtes Land, nach Wien, in die Salztorgasse, die Nachbarinnen sind Huren, in ihren Pausen schaukeln sie die Kinder. Doch die Wohnungen werden bald größer. Ungar-Klein ist ein gefragter Buchhalter. Er ist gefürchtet beim Finanzamt. Einmal schickt er Beate dorthin, sie soll vorgeben, auf den Strich zu gehen. Das ist zu der Zeit nicht steuerpflichtig, und so lässt sich was sparen.
Vor Autoritäten braucht man sich nicht zu fürchten, sagt René Ungar-Klein oft zu seiner Tochter Miriam. Wenn die sagen, geh in die Richtung, gehst du in die andere. Es geht ums Prinzip, sagt der Papa. Einmal verprügelt er in einer Hotelbar einen Mann, der einen Holocaust-Witz gemacht hat. Als Miriam sieben ist, bricht sie einem anderen Kind die Hand. Es hatte sie geärgert.
Miriam Lieder wird Buchhalterin. Sie ist darin gewissenhafter als der Vater, deshalb vielleicht nicht ganz so gut. René Ungar-Klein sagte immer: Papier ist geduldig, Miriam, du glaubst nicht, wie schnell man im Besitz einer offiziellen Urkunde sein kann. »Ich weiß nicht, wie ich ihn beschreiben soll«, sagt Miriam Lieder, »er war für mich einfach der beste Papa der Welt.«
»Der Mann war stolz auf das, was er geschafft hat«, sagt Theo Lieder, »zu Recht!« Ein Lebemann. Ein Angeber. Ein Blitzgescheiter. Hielt große Reden. Beglich große Rechnungen. Im Alter, breit und laut und mit dem Monokel im Gesicht, sah er aus wie ein Mafiapate. Kurz vor seinem Tod am 11. August 1984 verlor er beide Beine, der Zucker. Das zerstörte ihn. Zentralfriedhof, viertes Tor. Seine Frau lebte bis 1995. Manche fanden, sie sei nach dem Tod des geliebten Mannes regelrecht aufgeblüht. Plötzlich hatte sie eine eigene Meinung.
So ist das, sagt Miriam Lieder. Der Aschenbecher ist voll. Aber was ist mit Welschensteinach? Wie wurde der Papa zum »Kommissar«? Wie gesagt, sagt Miriam Lieder: Papier ist geduldig. Er wird sich diese Vollmacht selbst geschrieben haben. Dass Résistance-Kämpfer mit den französischen Truppen vorrückten, war ja nicht ungewöhnlich.
Ich glaube sofort, sagt Miriam Lieder, dass er sich in dem Kaff ausgetobt hat. Er war kein Kind von Traurigkeit. Aber kein Monster. Es ging ums Prinzip. Müssen wir wirklich über einen erschossenen Nazi auf dem Friedhof reden bei sechs Millionen ermordeten Juden? Er hat einen Erschießungsbefehl unterzeichnet, der ihm vorgelegt wurde, mehr nicht. Selbst hat er nie jemanden erschossen, das weiß ich, das hätte er mir gesagt. Aber selbst wenn, wer könnte es ihm verübeln? Diese Ortschronik, sagt Theo Lieder, liest sich, als wollten die Täter sich zu Opfern machen. René wollte sich nicht bereichern mit dem Zeug der Deutschen. Er wollte Entschädigung für den Verlust seiner Adoptiveltern, die hatten alles verloren. Es tut weh, wie einseitig diese Berichte sind, sagt Miriam Lieder, aber es tut nicht weh, dass Papa dort war.
Warum ausgerechnet Welschensteinach? Eben, sagt Miriam Lieder: ausgerechnet!
Im Keller der Schwester im Elsass stehen noch die Möbel. Alte Holzmöbel, Tische, Stühle, Sessel. Nicht hübsch. Aber der Vater schleppte sie zurück ins Elsass. Es waren, sagte er, Möbel aus diesem Schwarzwalddorf. Es waren, sagt Miriam Lieder, offenbar Möbel, die zuvor seinen Adoptiveltern in Straßburg geraubt worden waren. Möbel, die ihr Vater gezielt aus Welschensteinach geholt hatte? Der »Kommissar« war wegen Möbeln in Welschensteinach? Es sind Geschichten, sagt Miriam Lieder. Aber Fakt ist: Im November 1944 hatte sich eine 120 Mann starke Schutzkompagnie des SS-Stabes Himmler, darunter auch französische Mitglieder, in Welschensteinach im Schulhaus einquartiert. Die Offiziere wohnten privat. Hatten sie gestohlenes Hab und Gut aus Frankreich mitbringen lassen? Waren darunter SS-Leute, die Ungar-Klein aus Straßburg kannte, wo er inkognito unter Deutschen verkehrte?
Ganz ehrlich, sagt Miriam Lieder, ich weiß es nicht, aber ich würde bei meinem Vater nichts ausschließen.
Auch die Sache mit der Luftwaffenhelferin, die der Vater geheiratet hat. Es gibt Fetzen von Geschichten in der Familie, die besagen, dass er die Frau bereits in Straßburg kennengelernt hatte. Dass sie drohte, ihn als Juden auffliegen zu lassen, wenn er sie verlasse. Und warum heiratet er sie im besiegten Deutschland? Wie kam sie dorthin? Wie hat sie ihn dort erpresst? Niemand weiß es, sagt Miriam Lieder, jedenfalls hat er die Ehe gleich 1946 annullieren lassen.
Und die Überlieferungen, dass die Franzosen ihn inhaftierten, weil er Mitglied der Waffen-SS gewesen sei? Blödsinn, sagt Miriam Lieder, er war nie in französischer Haft. Auch wenn es genug Gründe gegeben hätte. Urkundenfälschung. Diebstahl. Waffenschieberei.
Es ist mir eigentlich alles egal, sagt Miriam Lieder, wie es auch war, das ändert nichts an dem Mann, den ich kannte.
Warum eigentlich will ihr Bruder nicht über dieses Abenteuer des Vaters reden? Ach, will er nicht?, fragt Miriam Lieder. Sie hat schon eine Weile keinen Kontakt mehr zu ihm, mal wieder. Es geht ums Erbe. Nach dem Tod des Vaters stellten sie fest, dass kein Geld übrig war. All die Geschichten, all das Protzen – aber da war nichts. Der Bruder warf den Schwestern vor, etwas genommen zu haben. Er glaubte, sagt Miriam Lieder, dass der Vater Millionen besessen hätte, und war von der Idee nicht abzubringen. Für den Bruder sei der Vater ein sehr reicher Mann gewesen, ganz sicher.
Illustrationen: Sam Vanallemeersch