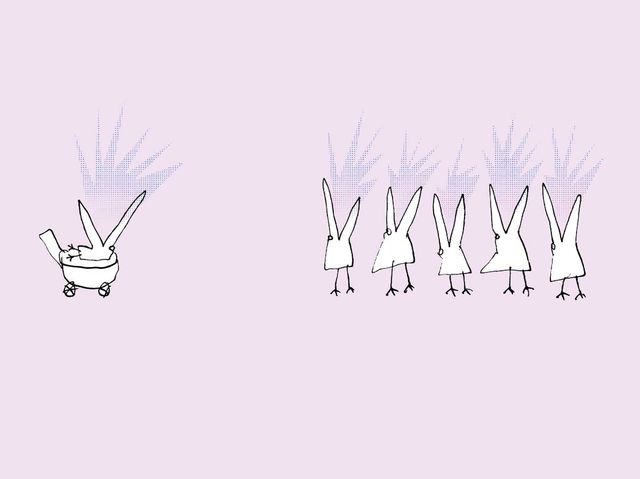Und, was haben Sie dieses Jahr an Christi Himmelfahrt gemacht? Ich könnte auch fragen: Wie haben Sie den Feiertag begangen, wie gefeiert? Aber das liegt mir ziemlich fern. Christi Himmelfahrt ist für mich ein langes Wochenende, an dem ich mal Besuch bekomme, mal wegfahre, oft irgendwo in der Sonne rumliege, und mich immer wieder frage: Warum genau muss ich heute nicht arbeiten? Ähnlich ist meine Beziehung zu Pfingsten. War das jetzt das Fest mit den Palmwedeln, die mir aus dem Religionsunterricht im Kopf geblieben sind? Und von Mariä Aufnahme in den Himmel (15. August) habe ich vor Kurzem zum ersten Mal gehört, nachdem ich einen bayerischen Arbeitsvertrag unterschrieben hatte.
Ganz anders geht es mir mit Weihnachten. Bis heute sehe ich meine Oma vor mir, wie sie schon im November anfing, Haselnussbrötle und Zimtsterne zu backen, die sie in Pappkartons auf dem Schrank im Schlafzimmer versteckte, damit an Heiligabend noch genug übrig waren. In meiner Familie schmücken wir zusammen den Baum und singen Lieder, nur den Kirchenbesuch haben wir irgendwann sein lassen. Weihnachten ist gefüllt mit Erinnerungen, mit besonderen Dingen, die ich sonst nicht esse und tue, die einzige Zeit im Jahr, die nur mir und meiner Familie gehört. Naheliegend, dass Weihnachten für mich diese Bedeutung hat. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, die ersten Jahre meines Lebens im Haus meiner katholischen Großeltern. Es hätte aber auch ganz anders sein können.
Mein Vater hat als Kind nicht Weihnachten, sondern Nouruz gefeiert. Für mehr als 300 Millionen Menschen, für Iraner, Afghaninnen, Kurden, ist der 21. März der Anfang eines neuen Jahres. In Iran deckt man einen Haft Sin, einen Tisch mit sieben Gegenständen, die mit dem Buchstaben س, Sin, beginnen. Sir zum Beispiel, Knoblauch. Serkeh (Essig), Sib (Apfel) und Sonbol (Hyazinthe).
Dass Nouruz ist, bekam ich als Kind nur mit, weil meine Mutter eine Hyazinthe auf den Tisch stellte und wir mit unseren Verwandten in Teheran telefonierten. Nur in einem Jahr hatten wir so etwas Ähnliches wie einen Haft Sin, mein Bruder und ich wollten das Fest jetzt auch mal feiern und meinen Vater in seinem Feierabend überraschen. Im Internet lasen wir nach, welche sieben Gegenstände wir brauchten, und improvisierten mit dem, was wir zu Hause fanden.
In den vergangenen Jahren habe ich viel darüber nachgedacht, woher ich komme und wohin ich gehöre. »Identitäten sind nicht festgeschrieben, keine starren und absoluten Folien. Sie sind prozesshaft und unterliegen stets Transformationen. Identitäten sind Schauplätze von Aushandlungen, hybrid und dynamisch«, schreibt der Politikwissenschaftler Ozan Zakariya Keskinkılıç in seinem Buch Muslimaniac. Die Karriere eines Feindbildes. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mit Weihnachten so viel Schönes verbinde. Aber ich habe mich auch oft gefühlt, als fehle mir etwas. Puzzlestücke, ohne die ich mich nicht fertig puzzeln kann. Weil ich kaum Farsi spreche, weil ich meine Cousinen lange kaum kannte und wahrscheinlich auch, weil ich nie Nouruz gefeiert habe. Denn Feiertage sind ja auch deshalb besonders, weil man sich miteinander verbindet, auch wenn man sie getrennt erlebt. Weil man weiß, dass auch die anderen jetzt einen Haft Sin decken oder den Baum schmücken und auch die Generationen vor uns das so ähnlich gemacht haben. Auch Feiertage sind Marker in den Prozessen, von denen Keskinkılıç spricht. Erlebnisse, die unsere Identitäten prägen. Ereignisse, an denen wir, oft nicht nur harmonisch, verhandeln, wer wir eigentlich sind.
Identität sei ein Schauplatz von Asymmetrien und strukturellen Machtverhältnissen, schreibt Keskinkılıç: »Nicht jeder Mensch hat die Möglichkeit, die eigene Identität frei zu artikulieren und ohne Angst der Mensch zu sein, der man ist oder sein will.« Auch das lässt sich auf Feiertage übertragen. Angst klingt mir, zumindest in Deutschland, zu drastisch, aber Konsequenzen handelt man sich schnell ein, wenn man feiert, was man will. Dass wir Nouruz weitgehend übergingen, lag wohl auch daran, dass mein Vater am 21. März zu arbeiten hatte und wir in die Schule mussten.
Meine Kindheit prägten dafür Weihnachten und auch Ostern, andere wuchsen ausschließlich mit Feiertagen auf, die für ihre Eltern, für sie Bedeutung haben, aber nicht in Deutschland. Sie teilen mein Gefühl, dass mit übersehenen Feiertagen mehr verloren geht als gutes Essen und Familienzeit. Ich habe deshalb für diesen Text Menschen gefragt, welche Feiertage sie vermissen.
»Ich wünsche mir, dass ich an Nawroz frei habe«, sagt mir Hila in einer Sprachnachricht. »In Afghanistan ist das ein Fest, bei dem alle, egal welcher Religion sie angehören, zusammen das neue Jahr und den Frühling feiern, das will ich auch hier!« Meryem würde endlich gern mal mit ihren Eltern in Ruhe das islamische Opferfest verbringen, auch Asim wünscht sich, da nicht in die Werkstatt zu müssen, ebensowenig wie am Zuckerfest am Ende des Ramadan. Ina hätte gern an Jom Kippur frei, für sich selbst und für alle Fastenden, damit sie sich darauf besinnen können. Ricardo möchte am Día de los Muertos mit seiner Familie einen Altar aufbauen, Natali will an Ambedkar Jayanti des Geburtstags des gleichnamigen Aktivisten und seines Kampfes für die Abschaffung des Kastensystems in Indien gedenken. Und Mei antwortet mir, auch in einer Sprachnachricht: »Ich habe mir schon so oft gewünscht, dass ich mit viel leckerem Essen und meiner Familie gemütlich in ein neues Jahr starten kann, das für mich mit Mondneujahr beginnt. Da reicht nicht ein Tag, am besten wäre eine freie Woche, wie hier zwischen Weihnachten und Silvester und wie in Hongkong und China nach dem Mondneujahr.«
In Syrien ist neben nationalen und islamischen Feiertagen auch der 25. Dezember frei, obwohl nur etwa ein Zehntel der Bevölkerung christlich ist. Und auch in Myanmar gilt der erste Weihnachtstag als Feiertag, neben vielen buddhistischen Feiertagen. Eine Möglichkeit wäre, uns diese Länder zum Vorbild zu nehmen. Immer wieder haben Menschen gefordert, einen islamischen Feiertag in Deutschland einzuführen. 2004 zum Beispiel sprachen sich dafür die Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele und Jürgen Trittin aus. Musliminnen und Muslime bilden heute in Deutschland die zweitgrößte Religionsgemeinschaft. Der Vorschlag hat viele provoziert, man kann es sich denken.
Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach erinnerte 2013, nachdem der Zentralrat für Muslime gesetzliche Feiertage gefordert hatte, an die christlich-jüdische Prägung Deutschlands: Hier gebe es »keine islamische Tradition«. Nun ist es mit den Leitkulturdebatten der vergangenen Jahre immer so gewesen, dass damit vor allem das Revier markiert werden sollte, wie Ozan Zakariya Keskinkılıç schreibt: »Wer darf Ansprüche stellen und wer nicht, wer leitet und wer hat zu folgen.« Dazu dienten in diesem Fall die Feiertage.
Was wäre denn mit Mei und Ina, Natali, Ricardo, Hila und all ihren Festen? Ich könnte jetzt so weit gehen zu fordern, auch ihre Wunschfeiertage einzuführen. Wir könnten uns lustig durchs Jahr feiern, futtern und faulenzen. Aber ich sehe ein, dass das volkswirtschaftlich keine Option ist.
Einige Bundesländer haben in ihren Feiertagsgesetzen Ausnahmen festgelegt. In Bayern können Schülerinnen, Schüler und Arbeitnehmende an israelitischen Feiertagen zu Hause bleiben, ihr Gehalt müssen sie trotzdem bekommen. Auch im Saarland und in Nordrhein-Westfalen gilt das für jüdische Feiertage. Begründet wird das mit der jahrhundertelangen gemeinsamen christlich-jüdischen Geschichte (Bayern) oder den Gräueln in der Zeit des Nationalsozialismus (NRW). In Bremen können sich Arbeitnehmende an jüdischen, islamischen und alevitischen Feiertagen für den Besuch von Gottesdiensten freistellen lassen. Gleiches gilt in Hamburg, seit die Stadt 2012 einen Vertrag mit islamischen Verbänden und alevitischen Gemeinden geschlossen hat. Olaf Scholz, damals Erster Bürgermeister, erklärte, man nehme damit »die Anwesenheit des Islam als eine in unserer Gesellschaft gelebte Religion zur Kenntnis«. Und in Sachsen-Anhalt kann man sich an religiösen Feiertagen unbezahlt freistellen lassen. Das gilt für alle religiösen Gemeinschaften ohne Unterschied und wird begründet mit der »weltanschaulichen Neutralität des demokratischen Rechtsstaats«.
In allen Bundesländern gilt: Die gesetzlichen Feiertage, etwa der 1. Mai, der 3. Oktober und die christlichen Tage, gibt es für alle. Zusätzliche jüdische, islamische oder andere religiöse Tage kann nur bekommen, wer den jeweiligen Religionsgemeinschaften angehört.
Inklusiver und einfacher erscheint mir, wie die Vereinten Nationen das regeln. Jeder Standort legt Feiertage fest, angelehnt an diejenigen, die im jeweiligen Land gelten. Zusätzlich bekommt jeder Mitarbeitende seit 2015 einen »Floating Holiday«, einen schwimmenden Feiertag, den man aus einer Liste wählen kann – um die Vielfalt des Personals zu respektieren. Wir könnten mit einem schwimmenden Tag anfangen. Und langfristig, für alle, bundesweit, 13 Feiertage schwimmen lassen (das würde auch die Ungerechtigkeit beheben, dass ich auf 13 komme, weil es so viele derzeit in Bayern gibt, in Berlin aber nur zehn).
Die schwimmenden Tage müssten sich überhaupt nicht auf religiöse oder kulturelle Traditionen aus verschiedenen Ländern beschränken. Meryem würde auch gern einen Tag der Freundschaft feiern. Ricardo will, dass der 8. Mai, der Tag der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus, Feiertag wird. Patricia begeht, seit sie ein Kind hat, nicht mehr Weihnachten, sondern am 21. Dezember ein Lichtfest mit ähnlichen Traditionen, aber ohne christlichen Hintergrund. Und Sophie wünscht sich den Tag des Baumes. Das klingt wie ein Witz, ich habe auch kurz gelacht. Sie denkt dabei aber an den Klimawandel. Mudar hatte die gleiche Idee: Er ist in Aleppo aufgewachsen, seit fünf Jahren lebt er in Berlin. Von nationalen und religiösen Feiertagen hat er genug, aber den Tag des Baumes kennt er aus Syrien. Er würde da gern, statt arbeiten zu gehen, auch hier Bäume pflanzen. Ich könnte damit mehr anfangen als mit Pfingsten, das mit Palmwedeln übrigens nichts zu tun hat, das war natürlich Palmsonntag.
Ein schöner demokratischer Prozess: Alle Menschen dürften Vorschläge einreichen, welche Tage sie feiern wollen
Wie bei den Vereinten Nationen würden alle Menschen in Deutschland ihre »Floating Holidays« aus einer Liste wählen. Dafür bräuchten wir zunächst so eine Liste, aber das könnte ein schöner demokratischer Prozess werden. Mehrere Monate lang dürften alle Menschen, die hier leben, Vorschläge mit Begründungen einreichen, welche Tage sie feiern möchten. Eine Kommission würde daraus die Liste zusammenstellen. Nicht geleitet von einem Mehrheitsprinzip, sondern mit dem Anspruch größtmöglicher Inklusivität. Wie viel Prozent oder Promille der Bevölkerung einer Religionsgruppe angehören, wäre dafür unerheblich. Es zählte ausschließlich, dass die Vorschläge gut begründet sind. Dass es einen Anlass für diesen Tag gibt, dass ihm eine religiöse, kulturelle, gesellschaftliche Relevanz zukommt. Um die Liste demokratisch zu legitimieren, würden Bundestag und Bundesrat sie gesetzlich verankern. Selbstverständlich bliebe die Möglichkeit bestehen, auch danach Vorschläge bei der Kommission einzureichen, wenn durch neue Migrationsbewegungen nach Deutschland oder neue gesellschaftspolitische Ideen Notwendigkeiten entstünden, zusätzliche Feiertage zu schaffen.
Das klingt nach viel Arbeit. Einfacher wäre es, Feiertage abzuschaffen und die Zahl der Urlaubstage zu erhöhen. Aber Feiertage sind wichtig, für die Einzelnen, für unsere Identitäten. Und sie sind wichtig für eine Gesellschaft. Schwimmende Feiertage würden uns zusammenbringen und die Gemeinschaft stärken.
Christi Himmelfahrt erreicht mich jedes Jahr wie ein Paket, das ich nicht bestellt habe, dessen Inhalt ich nicht blöd finde, damit aber auch nicht viel anfangen kann. Tage, die wir uns selbst aussuchen, würden wir mehr wertschätzen und mit größerer Wahrscheinlichkeit wirklich begehen. Wir müssten uns miteinander, mit Freunden, Nachbarinnen, Verwandten absprechen: Welche Tage wählen wir? Wir würden uns darüber unterhalten, warum uns diese Anlässe wichtig sind und was wir dann gemeinsam machen wollen. Auch mit Chefinnen und Kollegen müssten wir uns koordinieren – und könnten so dazu beitragen, dass wir mehr voneinander, von religiösen und kulturellen Anlässen erfahren und Verständnis füreinander entwickeln.
Weil alle jedes Jahr aufs Neue wählen, welche Tage sie freihaben möchten, weil jeder aus der offiziell beschlossenen Liste nehmen kann, was ihm gefällt, ohne seine Zugehörigkeit rechtfertigen zu müssen, könnten wir auch Feste entdecken. Ich würde natürlich Weihnachten freimachen. Aber ich hätte auch große Lust, in einem Jahr mit Natali Ambedkar Jayanti zu verbringen und im nächsten beim Zuckerfest dabeizusein. Und wie schön wäre es, mit Menschen, die in meinem Viertel wohnen, die ich bisher nie gesprochen habe, Bäume zu pflanzen? Solche Aktionen müsste man frühzeitig ankündigen, damit viele sie mitplanen. Es bräuchte vermutlich Jahre, bis sie angenommen und Tradition werden. Aber das wäre doch großartig!
Wem das alles viel zu anstrengend erscheint, der kann seine Tage so beibehalten, wie es bisher ist. Wen sollte es stören, wenn jemand oder viele sich für die Feiertage entscheiden, die sie schon kennen?
Weil ich das alles nicht als Utopie verstehe, habe ich auch bei Unternehmen nachgefragt. Von Volkswagen heißt es: Mehr Feiertage als die offiziellen zu ermöglichen, wird schwierig. Nicht weil dann jemand am Opferfest fehlt, sondern andersherum: wenn jemand an Karfreitag arbeiten möchte. Die meisten VW-Angestellten arbeiten in der Produktion. Man könne schließlich nicht allein am Band stehen. Ähnliches sagt eine Sprecherin von Siemens: An den deutschen Standorten seien Menschen aus etwa 140 verschiedenen Nationalitäten angestellt, da käme man auf eine Menge unterschiedlicher Feiertage. »In unseren Werken arbeiten die Menschen in Abläufen zusammen, insofern wäre es schwierig, andere Feiertage als die gesetzlichen freizugeben«, sagt die Sprecherin. Flexible Arbeitszeitsysteme erlaubten es aber den Mitarbeitenden, sich unbezahlt freistellen zu lassen, Gleitzeittage oder auch Urlaub an einem Feiertag zu nehmen. Einfacher klingt das beim Softwarekonzern SAP: Dort sei das kein Problem, mit Arbeitszeitkonten und Vertrauensarbeitszeit könne man schon jetzt Tage umstrukturieren und so Feiertage freibekommen. Arne Molfenter, der Sprecher der Vereinten Nationen in Deutschland, erzählt mir, mit den »Floating Holidays« laufe es reibungslos. »Das ist wie mit jedem normalen Urlaubsantrag auch, man muss sich einfach rechtzeitig absprechen«, sagt Molfenter. Mit 13 Tagen wäre das natürlich mehr Koordination – aber es wäre es wert.
»Deutschland ist vielfältig und das ist manchen zu kompliziert«, schrieb Aydan Özoğuz 2017 als Integrationsbeauftragte der Bundesregierung im Tagesspiegel. Die Feiertage wären ein überschaubares Projekt, damit anzufangen, Kompliziertes möglich zu machen. In einem Land, in dem jeder Vierte einen Migrationshintergrund hat, in dem nicht einmal mehr die Hälfte der Bevölkerung Kirchenmitglied ist, brauchen wir Möglichkeiten, andere Tage zu feiern als die christlichen – für die Vielfalt, für all die Menschen, die hier leben.
Vor ein paar Jahren war ich noch Studentin und konnte mir meine Zeit frei einteilen. An einem Nachmittag Ende März feierte ich mit vielen Menschen auf einer Pferderennbahn in Hamburg Chaharshanbe Suri, den letzten Mittwochabend vor Nouruz. Im vergangenen Jahr fiel Norouz auf einen Samstag, ich hatte frei und traf mich mit meinen Cousinen. Mit einem richtigen Haft Sin und Sabzi Polo Mahi, Kräuterreis mit Fisch, dem traditionellen Neujahrsessen. Es hat mir geholfen, mein Puzzle zu füllen.
Mein Freund Asim hat mir dann noch eine zweite Antwort geschickt. Er würde am Zuckerfest gern nicht nur freihaben. Für ihn ergibt es auch keinen Sinn, Weihnachtsgeld zu bekommen. Er will die Sonderzahlung lieber am Ende des Ramadan erhalten.