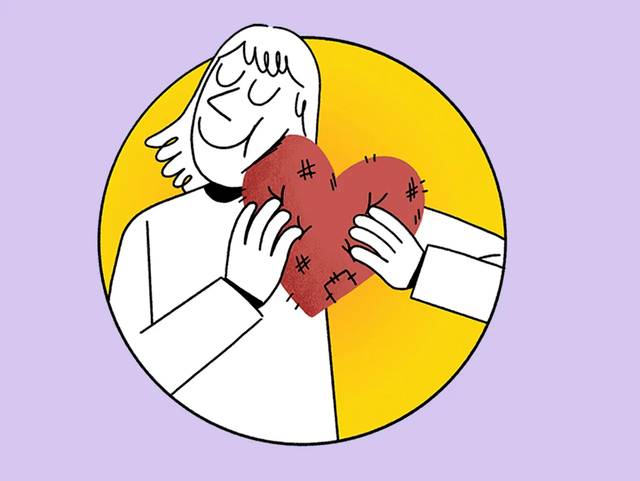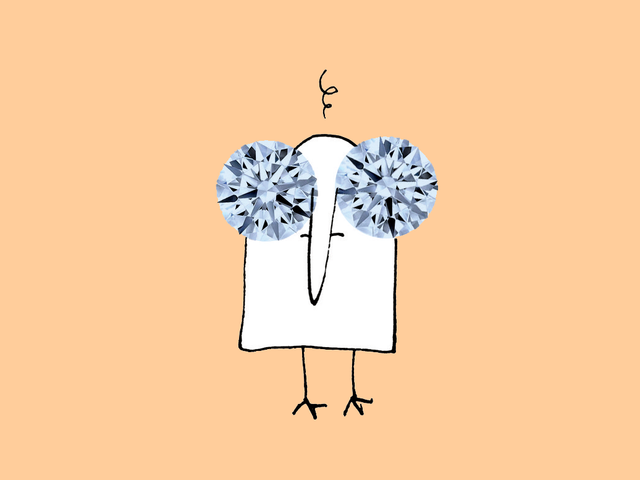Folge 100: Die Miniaturen
Es sind die kleinen Dinge: Sonnenaufgänge beobachten, ein großes Glas Sprudelwasser nach dem Sport, ein Blümchen an der Mauer auf dem Weg zum Supermarkt, ein süßer Hund. All das macht mich oft so verrückt glücklich, dass ich einfach nur dankbar für dieses Leben bin.
Doch während diese Momente eher zufällig sind, gibt es weitere Kleinigkeiten, die verlässlich zu jeder Zeit funktionieren: Miniaturen. Das sind diese winzigen Dinge, deren einzige Bestimmung es ist, einfach süß auszusehen. Die kleine Vase im Regal, ungefähr so groß wie eine Erdbeere. Die Mini-Bialetti, die ich letztes Jahr in der Toskana gekauft habe (– wobei sie sogar 50 ml Espresso kochen kann). Oder das klitzekleine Obst aus Ton auf dem Fensterbrett. Diese kleinen Sachen sind so rührend niedlich, dass mir manchmal Tränen der Freude in die Augen steigen, wenn ich sie betrachte oder daran denke.
Zugegeben: Der Grat zwischen süß und kitschig ist schmal – bei Modelleisenbahnen bin ich raus – , aber wenn ich darüber nachdenke, dass es Menschen gibt, die mit viel Hingabe und Aufwand etwas herstellen, was keinerlei praktischen Nutzen hat (und es ist so viel schwieriger, ganz kleine Dinge zu fertigen als normalgroße!), wird mir warm ums Herz. Wer so etwas erschafft, hat sicherlich auch einen Blick für die kleinen Glücksmomente des Alltags. Dana Packert
Folge 99: Der rote Badeanzug
Sein knalliges Rot leuchtet Sonne und Chlor zum Trotz noch immer wie eine Signalboje. Seine dünnen Träger laufen im Nacken zusammen und öffnen sich über dem Rücken wieder. Er ist sicher über zehn Jahre alt, das ist mehr als ein Drittel meines Lebens. Mein Badeanzug. Modell: »Performance Good Racerback«, übersetzt in etwa »Gute Leistung Raser-Rücken«.
Nur beim Schwimmen erreiche ich einen Zustand himmlischer innerer Ruhe. Ich sinke ins Wasser ein, stoße mich vom Rand ab. Die ersten Sekunden fröstle ich noch. Es ist immer die zehnte Bahn, ab der ich tranceähnlich vor mich hintreibe. Meine Gedanken sitzen am Beckenrand und ziehen vorbei. Niemand spricht frühmorgens im Schwimmerbecken, das ist Gesetz. Das Wasser plätschert leise. Sonst Stille.
Hallenbäder sind mir zuwider (die stickige Luft, die Lautstärke, die Enge). Der Badeanzug und ich führen eine saisonale Beziehung, die mit dem Frühling beginnt und mit dem Fallen der Blätter endet. Wohl gerade, weil ich die warme Jahreszeit so liebe, schätze ich ihn umso mehr. Badeanzug bedeutet Sommer. Allerdings bin ich eitel, niemals trage ich den Sportbadeanzug zu einem Tag am See oder zum Sonnen an der Isar – er verdeckt zu viel und hinterlässt unvorteilhaft weiße Abdrücke auf der Haut. Deshalb betrüge ich ihn mit einem schwarzen Bikini, der besser aussieht, aber für schnelle Bewegungen im Wasser ungeeignet ist.
Doch niemals könnte ich mich trennen von dem Stück Stoff, das mich nun schon durch so viele Sommer in Bädern in Heidelberg, München, Berlin oder Paris getragen hat. Wahrscheinlich würde ich heute eine dezentere Farbe wählen, weniger Pamela Anderson, mehr ernstzunehmende Sportlerin. Allerdings hat das robuste Rot mich womöglich schon vor einigen Zusammenstößen mit unachtsamen Schwimmern der Gattung Plansch-Krauler bewahrt. Das Rot verleiht mir die Autorität eines schwimmenden Stopp-Schildes.
Mein Badeanzug und ich, das sind die frühen Morgen nur für mich. Die frische Luft um sieben Uhr, wenn ich, noch im Halbschlaf, Richtung Freibad radle. Das Eintauchen und Aufatmen. Das ist die erschöpfte Leere danach, wenn ich mich in die Sonne lege und die Augen schließe. Ich schwimme, ich schwimme… ich fliege! Nele Sophie Karsten
Folge 98: Das Kaffeeservice
Bis vor einiger Zeit war ich überzeugt, dass Gegenstände keine Seele haben. Selbst meinen Nintendo DS, der mich Jahre meiner Kindheit begleitete, entsorgte ich unzeremoniell im Elektromüll. Doch dann starb meine Großmutter, und als meine Mutter und ich ihre Küchenschränke leeräumten und das Kaffeeservice an die Reihe kam, zögerte ich. Das Kaffeeservice? Ich trinke doch kaum Kaffee und Kuchen esse ich nur, wenn es die Höflichkeit gebietet. Besonders schön war es auch nicht. Die Porzellanteller und -Tassen sind mit einem lichtblauen Streifen und goldenen Akzenten verziert, so richtig Oma-like halt. Und trotzdem war mein erster Impuls, es zu behalten. Warum nur?
Ich mochte meine Oma, aber besonders nahe standen wir uns nie. Sie war kühl, hatte in ihrem Leben viel durchmachen müssen – sie war Kriegsflüchtling und früh verwitwet. Doch meine Eltern hatten ihr Haus in ihren Obstgarten gebaut, deshalb besuchte ich sie öfter zum Kaffeekränzchen oder zum Abendbrot mit dem obligatorischen Stück Schwarzbrot mit Käse. Und dann waren da noch die unzähligen Familiengeburtstage. Alles in stiller Begleitung des Kaffeeservice.
Das genaue Alter des Service kenne ich nicht, aber meiner Mutter zufolge existierte es schon zu ihrer Kindheit. Über die Jahre haben die Teller und Tassen gelitten, abgebrochene Ränder und feine Risse zeichnen heute das gesamte Set und könnten genauso gut als Metapher für das inzwischen zerklüftete Familienverhältnis stehen.
Seitdem ich es vor dem Müll bewahrt habe, zieht das Service mit mir umher. Die Tassen werden allenfalls als Messbecher missbraucht, die Teller und Untersetzer dienen als Krümelfang beim hastigen Snacken. Trotzdem könnte ich mich niemals davon trennen. Mit der Zeit verstand ich, warum: Es erinnert mich an eine Zeit der Beständigkeit – bevor meine Eltern sich trennten und die Tage bei Oma seltener wurden. Das Service hat jetzt eine Seele. Fynn Latendorf
Folge 97: Der Wecker
Neulich besuchte ich meine Eltern im Schwarzwald und entdeckte einen »Zu verschenken«-Tisch vor ihrem Haus, darauf lauter Erinnerungen aus meiner Kindheit. Das Brettspiel »Auf-und-davon«, Tassen, aus denen ich mit fünf getrunken habe und ein extrem laut tickender (und morgens noch lauter schrillender) Wecker mit mechanischen Drehknöpfen auf der Rückseite. Ich nahm den Wecker in die Hand, alte Verschlaf-und-nicht-aufstehen-wollen-Erinnerungen rauschten mir durch den Kopf, dann steckte ihn ein.
Natürlich hätte diese Geschichte enden können wie so viele von alten Dingen, die man nicht weggeben kann: in einer staubigen Kiste. Tat sie aber nicht, der Wecker hat mich gar aus einem Dilemma befreit. Er hat nämlich das Smartphone abgelöst, das bisher auf dem Nachttisch lag, um mich zu wecken. Das kann nun im Wohnzimmer laden, was den Vorteil hat, dass ich meine Abende nicht mit Scrollen verbringe und morgens nicht drei Sekunden nach dem Aufwachen eine Eilmeldung aus dem Weißen Haus lesen muss. Und selbst das Problem des lauten Tickens ließ sich leicht beheben: Der Wecker steht nun tief im Innern des Nachttischs, was sogar das Schrillen am Morgen auf eine erträgliche Lautstärke heruntergedimmt hat. Marius Buhl
Folge 96: Die Powerbank
Um ehrlich zu sein: Sie ist nicht besonders schön. Als ich sie das erste Mal meinen Freunden vorstellte, zeigten die sich unbeeindruckt. Sie ist schweigsam, eigene Hobbies hat sie auch keine, vielmehr schleppe ich sie überall mit hin. Und Verbindungen geht sie nur mit ausgewählten Gestalten ein. Es war also keine Liebe auf den ersten Blick. Vielmehr habe ich sie über all die Jahre, während gemeinsamer Reisen und Abenteuer schätzen gelernt: meine Powerbank.
Auf diesen tragbaren Akku ist nun mal Verlass. Als ich mich vor einigen Jahren in Kopenhagen verirrte, hauchte er meinem Smartphone wieder Leben ein. So fand ich doch noch zurück in meine hyggelige Unterkunft. Die Idylle Irlands konnte ich nur festhalten, weil meine Powerbank meine Kamera aus dem Dornröschenschlaf erweckte. Und beim Campen im polnischen Riesengebirge fühlte ich mich plötzlich ganz klein, als meiner Stirnlampe der Saft ausging und schlagartig Dunkelheit über meinen Rastplatz hereinbrach. Doch meine Powerbank lud auch dieses Gerät gelassen wieder auf.
Dafür mag ich sie, dieses tragbare Energiebündel. Sie ist geduldig, kennt keinen Neid und macht sich nicht wichtig. Manchmal wünschte ich, es gäbe eine Powerbank für den Menschen, eine Ladestation für Geist und Seele.
Und dann fällt mir wieder ein: Es gibt sie, die unermüdlichen Kraftspenderinnen in unserem Leben. Die geduldigen, gütigen und manchmal unscheinbaren Menschen. Die einfach da sind. Nicht nur, wenn es ihnen passt, sondern wenn es drauf ankommt. Ein Hoch auf all die stillen, aber treuen Begleiterinnen und Unterstützerinnen in unserem Leben. Ihr seid die wahre Bank unter all den Powerbanks. Lukas Buschmann
Folge 95: Der Einkaufswagen-Chip
Im Alltag trägt man viel Zeug mit sich herum, das meiste allerdings nur vorübergehend. Geld wird ausgegeben, kaum dass man es ins Portemonnaie gesteckt hat, Kleider verschleißen oder passen nicht mehr, Handys, Brillen und Kreditkarten müssen regelmäßig erneuert werden, Schlüssel gehen verloren, und nun habe ich sogar meinen alten, pinkfarbenen Führerschein aus dem letzten Jahrtausend gegen die neue EU-Plastikkarte eingetauscht. Ein Ding aber ist immer ganz dicht bei mir: die Einkaufswagen-Münze, die ich seit 20 Jahren in meinem Geldbeutel mitführe.
Sie stammt aus dem Tengelmann an der Wolfratshauser Straße im Münchner Süden. Ab 2003 wohnte ich einige Jahre lang im weiteren Einzugsbereich das Markts, aber nicht wirklich in der Nähe, und musste mir deshalb angewöhnen, Lebensmittel auf Vorrat zu kaufen. Also Einkaufswagen statt, wie vorher, schnell, schnell ein paar Sachen im Korb. Nun ist ein Einkaufswagen-Chip ohne Zweifel ein total banaler Gegenstand, und ich schenkte meinem zehn, fünfzehn Jahre keine besondere Beachtung. Bis mir eines Tages erstaunt auffiel: Der ist ja immer noch da! Irgendwie hatte der Chip es geschafft, sich dem Hang des Universums zu Chaos und Entropie zu widersetzen, und eine erstaunliche Anhänglichkeit bewiesen. Oder war ich es selbst, der ich mich an diesem unscheinbaren Ding festgehalten hatte? Und wenn ja, warum?
Die Kassenschlange ist ein guter Ort, um über solche Dinge nachzudenken, und ich bin zu folgendem Ergebnis gekommen: Der Chip selber ist mir ziemlich egal. Falls er doch mal verschwinden sollte, werde ich mir einfach einen neuen besorgen. Ich mag ihn eher als Symbol, er steht für mich für den Wert langjähriger Beziehungen, für die Freude an den kleinen Dingen und für den praktischen Nutzen von Ordnung und guter Organisation. Das klingt alles ein bisschen spießig, ich weiß, aber inzwischen ist mir das egal: Das Glück, soviel habe ich im Leben gelernt, liegt oft eher in der Normalität als in den Extremen, und genau daran erinnert mich die olle Tengelmann-Münze jedes Mal, wenn ich sie in den Schlitz eines Einkaufswagens schiebe. Johannes Waechter
Folge 94: Der Lipgloss
Ich weiß nicht mehr, wann ich zuletzt einen gekauft habe. Oder wie viele davon mittlerweile bei mir rumfliegen. Vielleicht drei, vielleicht fünf. Transparenter Lipgloss und ich führen jedenfalls eine Beziehung, die man kompliziert nennen könnte.
Mit 13 habe ich meinen ersten Lipgloss gekauft. Er war rosa und roch so süß, dass ich dachte, man könnte ihn essen. Als ich ihn zögerlich probierte, bemerkte ich meinen Irrtum schnell. Er schmeckte nach Plastik. Was aus diesem ersten Lipgloss wurde, weiß ich nicht. Einen aufzubrauchen, habe ich nie geschafft.
Auch mein aktueller Lipgloss ist manchmal einfach weg. Wie auf Entzug suche ich ihn dann in Hosentaschen, Handtaschen oder unterm Autositz. Dann gebe ich auf. Beende gedanklich die Beziehung. Erzähle mir selbst, dass Zeit ist für etwas Neues. Vielleicht sollte ich einfach mal erwachsen werden und Lippenstift tragen.
Und dann, wenn ich längst Frieden mit dem Verlust geschlossen habe, passiert es: Ohne Vorwarnung liegt mein Lipgloss wieder da. So, als wäre nichts gewesen. Das finde ich fast ein bisschen dreist. Aber irgendwie weiß ich: Er kommt zurück. Auf seine eigene, unzuverlässig-verlässliche Art.
Inzwischen sieht er auch nicht mehr »Crystal Clear« aus. Durch diverse Lippenpflegeprodukte hat er einen leicht rosigen Stich bekommen, den ich im Laden so nie kaufen könnte, aber gernhabe. Ich mag auch, dass ich ihn schon zig Freundinnen ausgeliehen habe, wenn sie ihn auf der Clubtoilette spontan benutzen wollten. Und ich kann nicht mal böse sein, wenn mir wegen ihm beim ersten Windstoß die Haare an den Lippen kleben. Aber am meisten mag ich, dass ich mich selbstbewusster fühle, wenn ich ihn trage. So war das schon mit 13 und so ist es noch heute.
Man sagt: »Wenn du etwas liebst, lass es frei. Kommt es zurück, gehört es zu dir.« Mein Lipgloss und ich haben das ganz gut verstanden. Clara Hofstetter
Folge 93: Das Fernglas
Eine der ersten Erinnerungen, die ich habe, sieht so aus: Ich liege bäuchlings auf einem stoppeligen, senfgelben Teppich in der Mitte meines Zimmers. Vor mir ein Tierlexikon, dicker als mein Oberschenkel. Aufgeschlagen ist eine Seite mit Zeichnungen von Greifvögeln, und darauf liegt ein Butterbrotpapier. Mit einem Bleistift und viel Geduld pause ich durch das Papier den Mäusebussard ab.
Genau wie diese gestochen scharfe Erinnerung ist mir die Faszination für die Vogelwelt bis heute geblieben. Vergangenes Jahr im Sommer spazierte ich in den niedersächsischen Marschlandschaften und beobachtete Falken, Fasane und Reiher. Auf den ostfriesischen Inseln, wo im Frühjahr alles flattert und zetert, sah ich Brandgänse und Kiebitze und einmal sogar den Wiedehopf. Doch all dies läge verborgen in der Weite, hätte ich nicht mein Fernglas.
Ich bekam es vor zehn Jahren von Freunden geschenkt. Es ist nicht hochwertig, aber es erfüllt seinen Zweck. Ich bin ein Großstadtmensch, schon immer. Doch manchmal, wenn meine Freunde und ich draußen im Grünen sind und am Himmel ein Greifvogel kreist, packe ich es aus, stelle die Schärfe ein und blicke in die Runde. Alle schauen mich erwartungsvoll an und können kaum erwarten, durch das Glas zu sehen, und das freut mich.
Denn manchmal habe ich das Gefühl, dass die zwei Okulare, auf die ich meine Augen presse, eine magische Wirkung haben. Sie sind in der Lage, die Distanz zwischen mir und der Natur zu verkürzen, die in U-Bahnhöfen, Häuserschluchten und den Tierdokus auf dem Handybildschirm so fern scheint. Sie zeigen die Realität in Echtzeit. Sie offenbaren Details, in denen ich mich ewig verlieren kann. Ein leicht geneigter Kopf, ein schneller Flügelschlag. Und letztlich schenken sie mir eine neue Perspektive, nicht nur auf den Mäusebussard. Jonas Junack
Folge 92: Der blaue Stein
Am Rand eines Weges durch einen Park liegt eine Reihe großer Steine. Ich bin diesen Weg oft als Kleinkind gegangen, weil wir in der Nähe wohnten, und damals erschien er mir endlos lang. Trotzdem freute ich mich, wenn wir diese Strecke nahmen, denn ich wusste, dass am Ende etwas Besonderes auf mich wartete: Dort war nämlich ein Stein blau.
Ich habe mich immer gefragt, warum dieser Stein blau war und warum allein er da farbig inmitten der anderen Steine lag. Wer hatte den Stein gestrichen? Und warum? Warum genau diesen Stein und nicht den daneben? Und wieso in diesem knalligen Dunkelblau?
Der Stein hatte eine Magie, eine Verrücktheit an sich und seine Existenz war mir absolut unerklärlich. Auch war er einer der wenigen Punkte, dank dem ich mich orientieren konnte. Ich wusste eine Sache: Dieser Weg führt zu dem blauen Stein.
Kurz bevor ich in die Schule kam, zogen meine Familie und ich weg, und langsam verschwand der Stein aus meinem Gedächtnis. Doch eines Tages, ich war schon deutlich älter, als ich mal wieder in der Gegend war und zufälliger diesen Weg ging, dämmerte es mir: Das ist der Weg zum blauen Stein!
Und da war er tatsächlich. Wie immer lag er inmitten der anderen Felsbrocken. Doch sein Blau leuchtete nicht mehr so stark. Es war wohl mit den Jahren etwas ausgeblichen und niemand hatte ihn neu gestrichen.
Das konnte für mich nicht sein. Der blaue Stein war nicht mehr blau?! Dieser krasse, magische Stein leuchtete einem nicht mehr blau entgegen?!
Also beschloss ich, dass es an mir lag, dem Stein sein Blau zurückzugeben. Ich kaufte eine Spraydose und frischte ihn auf.
Alle paar Jahre gehe ich den Weg zum blauen Stein. Nach wie vor freut es mich, wenn ich ihn zwischen den anderen grauen Steinen erblicke und er sein unerklärliches blaues Dasein weiterführt. Neulich fiel mir auf, dass sein Blau wieder verblasst war. Also ging ich los und holte eine Dose Farbe. Amelie Schaeberle
Folge 91: Basilikum
Mal wieder bringe ich eine kleine grüne Gefährtin mit nach Hause. Unzählige Male schon habe ich im Supermarkt eine Basilikumpflanze eingepackt und in meiner Küche platziert, jedes Mal mit dem festen Vorsatz, dass sie dieses Mal am Leben bleibt. Und doch: Irgendwann werden die Blätter schwarz und ich sehe, es geht zu Ende mit unserer gemeinsamen Zeit.
Ich habe es schon mit viel und mit wenig Wasser versucht, mit Umtopfen, mit gutem Zureden. Diesen Frühling pflanze ich sie in einen Balkonkasten, vielleicht gefällt es ihr dort besser. Als ich die Wurzeln mit Erde bedecke, steigt mir der frische Duft der grünen Blätter in die Nase. Mmh, das riecht nach Kochen, nach italienischem Essen, nach Zusammensitzen mit lieben Menschen. Nach den besten Dingen der Welt.
Für mich riecht es außerdem nach meiner Kindheit und meinem Zuhause auf dem Land: Im Garten hatten wir eine Kräuterschnecke, in der Minze, Thymian, Rosmarin oder eben Basilikum wuchsen. Als Kind schickte mich meine Mutter oft los, um Kräuter zu pflücken, die dann in leckeren Pastasoßen verarbeitet oder über gegrilltes Gemüse gestreut wurden. Gerne landeten sie auch in den Cocktailgläsern meines Vaters. Vom Geruch der Kräuter konnte ich nicht genug bekommen. Vielleicht keimten dort schon die ersten Sprösslinge meiner heutigen Liebe zum Kochen.
Vor einiger Zeit habe ich auf Instagram gelernt: In den Supermarkttöpfen sind oft zu viele Pflanzen zu eng gedrängt. Um ihre Überlebenschancen zu erhöhen, sollten die einzelnen Pflanzen mit mehr Abstand in einen größeren Topf gesetzt werden. Ich schaue auf das glücklich leuchtende Grün der neu gekauften Pflanze. Vielleicht war das jetzt ja das letzte Mal, dass ich einen neuen Basilikum besorgen musste. Cara Hofmann
Folge 90: Das Armkettchen
Vor ein paar Jahren habe ich meinen Partner in Crime kennengelernt. Auf einem Markt für Kunsthandwerk in der Nähe von Kapstadt, als ich in Südafrika studierte. Anders als sonst bei der Beziehungsanbahnung wusste ich direkt: Das passt.
Mein Partner in Crime ist ein Armkettchen. Filigran und aus Silber, jede andere Art von Schmuck ist mir zu wuchtig. Seitdem umspielt das Kettchen mit dem Lebensbaum-Anhänger mein linkes Handgelenk.
Es begleitete mich, als ich auf den Tafelberg stieg und in der Unibibliothek Essay um Essay schrieb. Es war dabei, als Freundschaften zu sprießen begannen, die heute noch blühen. Und auch, als ich nach dem Semester unter anderem Botswana, Simbabwe und Mosambik mit öffentlichen Bussen bereiste, mal karge, mal grüne Landschaften, mal Dörfer, mal Großstädte vorbeizogen – über tausende Kilometer hinweg. Häufig rann mir der Schweiß von der Stirn, zitterten meine Hände, hämmerte mein Herz, wenn ich mal wieder ins Ungewisse stolperte.
Das Armkettchen war mein Anker, wenn ich mich dafür verfluchte, allein auf diese Reise losgezogen zu sein. Es war aber auch Zeuge, wenn fremde Menschen in den Buspausen ihre Chips und Teigtaschen mit mir teilten. Wenn andere Frauen mir erklärten, welche Busse und Fußwege ich problemlos nehmen konnte und welche ich besser meiden sollte. Wenn sie sagten: »Hier ist meine Nummer, melde dich jederzeit, wenn du Hilfe brauchst.«
Das Symbol des Lebensbaums steht unter anderem für Wachstum und Entwicklung. Während dieser Zeit bin ich sehr gewachsen, immer wieder auch über mich hinaus.
Auch heute noch umspielt das Armkettchen mein linkes Handgelenk. Ich habe es keinen Tag mehr abgelegt. Und wenn ich mich mutlos fühle, reicht ein Blick darauf, damit ich denke: »Hey, du schaffst das schon, du hast doch schon ganz andere Dinge hinbekommen.«
Lara Voelter
Folge 89: Die Chucks
Die Turnschuhe waren weinrot, knöchelhoch und an der Innenseite prangte ein weißer Aufnäher mit blauem Stern, darauf in roten Buchstaben die Worte »CONVERSE ALLSTAR«. Das Einkaufszentrum in der nahegelegenen Kreisstadt hatte sie günstig erworben – Sonderangebot. Es war ein familiengeführter Supermarkt, der bereits Anfang der 90er Jahre neben einer gut sortierten Käsetheke auch »Junge Mode« im Angebot hatte. Die ganze Region pilgerte dorthin, denn dort gab es Dinge, die sonst nur in Großstädten zu finden waren. Und die nächste Großstadt war weit weg.
Ich war etwa zehn oder elf Jahre alt und wusste nicht, dass diese Turnschuhe aus Gummisohle und Canvasstoff bereits seit 1917 in den USA produziert werden, dass es sich ursprünglich um Basketballschuhe handelte, dass James Dean, Elvis Presley und Kurt Cobain sie getragen hatten, und dass sie mit mehr als einer Milliarde verkauften Exemplaren eines Tages zum erfolgreichste Schuhmodell aller Zeiten werden sollten. Doch eins wusste ich sofort. Diese Turnschuhe waren etwas ganz Besonderes. Sie machten aus dem Mädchen mit rosaroter Hornbrille, das ich damals war, das Mädchen mit den Chucks.
Auf einmal sprachen mich Jugendliche aus dem Dorf auf meine Schuhe an. Wie cool die doch seien, und dass ich dann ja wohl auch gar nicht so uncool sein kann. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mir je zuvor Gedanken darüber gemacht hätte, was ich anziehe oder was ich mit meinen Klamotten ausdrücken möchte. Doch das änderte sich nun, denn ich hatte erlebt, was Kleidung bewirken kann.
Während der Pubertät und der Suche nach meiner Identität durchlief ich – nicht nur modisch – Grunge-, Hippie- und Skatergirlphasen. Ließ mich wie so viele Jugendliche von Zeitschriften und MTV, Freunden und Freundinnen beeinflussen. Doch nichts davon wollte so recht zu mir passen. Nur den Chucks bin ich bis zum heutigen Tage treu geblieben. Denn für diese Schuhe habe ich mich entschieden. Ohne zu wissen, wofür sie stehen. Ich besaß schon viele Paare, mal waren sie gelb und flach, meistens weiß. Die Chucks tragen mich bis heute und haben mir geholfen, meinen eigenen Weg zu gehen.
Verena Haart Gaspar
Folge 88: Mayonnaise
Kaum ein Produkt in meinem Kühlschrank kann meinen Tag so verderben wie Mayonnaise – wenn sie nicht da ist. Schon immer gab es für mich Pommes nur mit Mayo, auch der Gurkensalat und das Sandwich bekommen stets einen Klecks ab. Auch ihre Geschwister Aioli und Remoulade haben einen besonderen Platz in meinem Herzen.
Ketchup und Senf schmecken mir zwar auch gut, aber nichts geht über Mayo. Nur in seltenen Ausnahmefällen greife ich zu einem anderen Dip: Wenn der Mayo-Eimer am Pommes-Stand auf dem Rummel bei 30 Grad in der prallen Sonne steht, darf es auch mal Ketchup sein. Die Gefahr einer Lebensmittelvergiftung, die mit abgelaufener Mayo einhergeht, darf nicht unterschätzt werden. Es gehört viel Vertrauen dazu, auswärts Mayonnaise zu bestellen. Andererseits schmeckt für mich nichts mehr nach Urlaub als eine Pommes mit zu viel Mayo am Strand von Holland.
Mein Mayo-Konsum sorgt für Verblüffung. Mayonnaise scheint zu polarisieren. Vielleicht ist es die abschreckende Kaloriendichte, die kaum ein anderes Lebensmittel aufweist. Immerhin gut 700 kcal auf hundert Gramm – genau zwischen Nuss-Nougat-Creme und Schweineschmalz. Trotzdem verrät ein Blick ins Supermarktregal, dass Mayonnaise aktuell ein Comeback erlebt: Mayo mit Chili, Wasabi, Zitrone oder in vegan und plant-based. Vielleicht ist langsam die Zeit gekommen, Mayo aus der Ecke der Pommessoßen herauszuholen und ihr einen festen Platz im Kühlschrank zu reservieren – so wie bei mir zuhause. Lorenz Nigge
Folge 87: Die Digitalkamera
Meine erste Kamera, eine Nikon in knallrosa, bekam ich mit ungefähr acht Jahren zu Weihnachten, das war in den frühen 2010ern. Meine Schwester bekam die gleiche in blau. Wir fotografierten uns gegenseitig, unsere Kinderzimmer, die gemeinsamen Urlaube, nichts und niemand war vor uns (und unseren Kameras) sicher. Irgendwann gerieten die Kameras aber in Vergessenheit: das erste Smartphone löste die Digitalkamera ab. Meine rosa Kamera gab langsam den Geist auf, und so landete sie in ihrem Grab, der dunklen Schublade in der Wohnwand.
Ich hatte meine vergangene Liebe zu diesem Relikt der 2000er Jahre schon fast vergessen, als ich vor drei Jahren im Putzrausch eine alte Fujifilm Kamera entdeckte. Die schwarze Oberfläche war leicht verstaubt, die silbernen Details größtenteils abgeblättert. Die Digitalkamera meiner Eltern, fast älter als ich selbst, ist seitdem treuer Wegbegleiter in meiner (ebenfalls uralten, heißgeliebten) Bauchtasche. Mit ihrer Linse fängt sie für mich die schönsten Momente ein: Sommertage in Kölner Parks, Reisen mit Freundinnen, das Lachen meiner Herzensmenschen. Die Bilder sind mal überbelichtet, mal verwackelt, mal unscharf, aber irgendwie immer charmant und authentisch. Genau aus diesem Grund feiern die Digitalkameras in meiner Generation wohl gerade ein Comeback.
Natürlich mache ich die meisten Fotos noch mit der Handykamera, ich bin schließlich ein Digital Native. Aber wenn ich mich ein bisschen nach Kindheit sehne, greife ich dann doch zu meiner Fuji – trotz rissigem Display und Bildern mit Blaustich. Lea Beldiman
Folge 86: Die Cordhose
Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn diese Hose mal kaputtgeht. Nicht, weil sie teuer gewesen wäre, im Gegenteil: Sie hat nur neun Euro gekostet. Ich habe sie nämlich bei einem Räumungsverkauf ergattert. Und das ist das Problem: Ich könnte nicht einfach in ein Geschäft gehen und mir eine neue kaufen. Es ist eine Culotte aus beigem Cord, ähnliche Hosen sehe ich immer mal wieder in Läden oder auf dem Flohmarkt, aber keine sitzt so perfekt wie meine. Wenn ich nur ein Kleidungsstück aus meinem Schrank retten dürfte, sie wäre es. Dabei liegen darin auch ein Seidentuch meiner verstorbenen Oma, ein Pulli, den meine Mutter schon als Studentin getragen hat, und ein Kleid, das meine Schwester und ich in einem Secondhandladen in New York entdeckt haben. Teile mit mehr Bedeutung und in besserer Qualität.
Wobei, was heißt schon Bedeutung? Ich habe darüber nachgedacht, warum ich dermaßen an meiner Cordhose hänge: Wenn ich mit einem Kleidungsstück ausdrücken müsste, wer ich bin, dann würde ich sofort zu meiner Cordhose greifen. Und wenn man so ein Teil erst einmal gefunden hat, eines, in dem man sich uneingeschränkt richtig fühlt, seit Jahren, und das einen daran erinnert, wie unwichtig Trends und widersprüchliche Ansprüche an Frauenkörper sind, dann muss man daran festhalten.
Wenn meine Cordhose mal kaputtgeht, werde ich das Geld, das ich bei ihrer Anschaffung gespart habe, nehmen und sie zu einer Schneiderin bringen, damit sie mir nach ihrem Muster Ersatz näht. Agnes Striegan
Folge 85: Der Füller
Ich weiß noch, wie ich als Kind auf meinem Schreibtischstuhl kippelte, aus dem Fenster schaute und dann dramatisch meinen Füller über das Papier gleiten ließ: Tada – ich schrieb eine Geschichte. Inzwischen ist mein Lamy-Füller mit mir von der Kleinstadt Minden über Osnabrück bis nach Hamburg gezogen.
Mit ihm schrieb ich meine Abiturklausuren und auch im Studium blieb ich ihm treu – was mir oft ein Kopfschütteln einbrachte. Wer kratzt mit einem Tintenkiller übers Papier, anstatt das Geschriebene einfach durchzustreichen?
Die Kritik an meinem Füller beeindruckte mich nicht, war er doch mein Glücksbringer. Als ich in meiner Examenszeit fünfstündige Klausuren mit der Hand schrieb und kurz vor dem Nervenzusammenbruch war, beruhigte es mich, meinen langjährigen Begleiter jeden Morgen aus meinem Etui zu holen. Einmal dachte ich, ihn vergessen zu haben, und meine Hände fingen an zu schwitzen.
Er ist sogar mehr als ein Glücksbringer. Wenn ich ihn nun zuhause aus der Schublade hole, gehören die nächsten Minuten nur mir, mein Handy landet ausnahmsweise im Flugmodus in der Ecke. Dann höre ich mir selbst zu: Ich schreibe auf, was in meinen Kopf kommt, und versuche, meine Gefühle in Worte zu fassen und zu ordnen. Mit meinem Füller schreibe ich Tagebuch oder Briefe an Menschen, die mir viel bedeuten. Zuletzt hatte ich ihn in der Hand, als ich meiner besten Freundin einen Brief schrieb, weil sie nach England zieht.
Ich hoffe, dass mein Füller noch viele Jahre hält, und bis dahin kaufe ich fleißig weiter Lamy-Patronen. Nina Spannuth
Folge 84: Die Sardellenpaste
Meine Großmutter Edith hatte Stil. Sie trauerte meinem Großvater nach und lachte trotzdem viel. Sie erlaubte auch viel, Fernsehen zum Beispiel, und verteilte großzügig Milka-Schokolade unter uns Enkeln. Als Kind war ich oft bei ihr zu Besuch, und ich habe sie nie im Nachtgewand gesehen, sondern immer sorgfältig zurechtgemacht und eigentlich zu elegant angezogen für das Dorf im Sauerland, in dem sie lebte. Sie rauchte Menthol-Zigaretten, viele Menthol-Zigaretten, man hörte das ihrer Stimme auch an. Nachmittags um fünf trank sie einen Sherry, abends zur Tagesschau Weißwein von der Mosel, sie schlief meist aus und aß zum Frühstück ein pflaumweiches Ei mit Sardellenpaste, nichts anderes, nie etwas anderes, und das hat sich mir so eingeprägt, dass ich, seit ich einen eigenen Haushalt habe, Sardellenpaste kaufe, wann immer ich welche entdecke. Dann esse ich ein Ei mit Sardellenpaste, das schmeckt gut und macht mich sehr wehmütig, ich sehe sie vor mir in ihrem Lieblingssessel, eigentlich ein Stuhl mit Seitenlehnen und Samtkissen, wie sie vor sich hin raucht und zugleich bei uns und in Gedanken bei meinem Großvater ist. Und hier beginnt die eher komplizierte Beziehung zur Sardellenpaste, denn dann liegt die Tube in meinem Kühlschrank, kaum angebrochen, weil ich gar nicht oft Eier zum Frühstück esse und schon gar nicht mit Sardellenpaste, die Erinnerung soll ja auch nicht schal werden. Manchmal serviere ich Freunden Cracker mit hartgekochtem Ei und einem Tupfer Sardellenpaste, was richtig lecker ist, aber irgendwann muss die Tube weg, die immer noch kaum aufgebraucht ist. Und bei der nächsten Gelegenheit kaufe ich eine neue. Das muss so. Ich wünschte, es gäbe Sardellenpastetuben in der Größe von Hautcremepröbchen. Gabriela Herpell
Folge 83: Die Wärmflasche
Meine Wärmflasche ist älter als ich, mindestens um die Vierzig. Sie ist aus moosgrünem Gummi und auf ihrem Hals steht »Made in West Germany«. Zwischen ihren Lamellen hat sich Staub gesammelt. Ich habe versucht, ihn mit der Spülbürste herauszuschrubben, aber er sitzt dort fest wie Plaque. Die Flasche und ihr Schraubverschluss haben jeweils ein kleines Loch, durch das ich eine goldene Kordel geschoben und verknotet habe, damit sie sich nicht verlieren. Der Schraubverschluss ist vom vielen Rein- und Rausdrehen aufgeraut und porös. Ich bin mir sicher, dass die Wärmflasche keine Qualitätskontrolle überstehen würde. Vielleicht ist es sogar lebensgefährlich, sie noch mit heißem Wasser zu füllen. Ihnen würde ich das keinesfalls empfehlen, ich aber bin meiner Wärmflasche treudoof ergeben. Nichts hält mich davon ab, sie Nacht für Nacht mit ins Bett zu nehmen. Ich reise sogar mit ihr. Mit ihr fühlt sich jedes Ferienhaus, jedes Hotelbett wie zu Hause an.
Meine Mutter war sehr darauf bedacht, dass ich als Kind nicht fror. Vielleicht, weil sie selbst ständig fror. Wenn sie mich ins Bett brachte, lupfte sie meine Füße und schlug die Decke einmal um sie herum. In diesen Bettdeckenfußsack hinein legte sie die Wärmflasche. Die Wärme stieg von meinen Füßen durch meine Beine meinen Körper hinauf. Wenn ich in der Nacht aufwachte und nicht wieder einschlafen konnte, füllte sie die Wärmflasche erneut mit warmem Wasser. Es war, als würde meine Mutter mit der Wärmflasche ein wenig ihrer eigenen Wärme bei mir lassen.
Meine Mutter fragt mich auch heute noch oft, ob ich denn nicht friere. Sie stellt die Frage suggestiv. Ich erinnere mich an einen Winterspaziergang am Nordseestrand. Meine Mutter sah, dass ich keine Handschuhe trug. Sie fragte: »Ist dir nicht kalt?«, betastete meine Hände, befand sie für »eisig« und bot mir ihre Handschuhe an. Mich stürzte diese Frage in ein moralisches Dilemma. Ich wusste ja, dass es eigentlich meine Mutter war, die fror und dieses Gefühl auf mich übertrug. Ich hingegen hatte mir bis dahin über die Temperatur meiner Finger gar keine Gedanken gemacht. Ich schlüpfte testweise in ihre Handschuhe hinein. Sie waren gefüttert und mütterlich vorgewärmt. Sollte ich sie annehmen und damit meine Mutter der Kälte überlassen? Oder könnte ich meiner Mutter diesen Akt der Liebe ausschlagen? Ich wollte nicht, dass meine Mutter friert. Und ich wollte als erwachsene Frau auch nicht mehr bemuttert werden. Wir fanden einen Kompromiss. Ich streifte mir einen Handschuh über, den anderen behielt sie.
Wenn ich meine Wärmflasche heute mit Wasser fülle, fällt mir auf: Sie riecht muffig. Ich habe deshalb mal nachgeschaut: Das Nachfolgemodell meiner Wärmflasche von Fashy, eine »Doppellamelle 2,0 Liter«, kostet 9,95 Euro. Es gibt sie in rot, grau und blau. Mittlerweile kann man auch allerlei Kinderwärmflaschen mit Flauschbezug kaufen. Mich überzeugt das alles nicht. Ich bleibe bei meiner Wärmflasche, bis ein Unglück passiert. Das nehme ich in Kauf. Aber ich habe bei meiner Suche eine Mini-Wärmflasche für die Jackentasche entdeckt. Ich denke, das wäre ein schönes Geschenk für meine Mutter. Lisa McMinn
Folge 82: Der Tisch
Ich weiß nicht mehr, wieso ich mir ausgerechnet diesen Tisch ausgesucht habe: ein Meter mal zwei Meter, Vollholz, Kiefer gebeizt. Passt nicht wirklich zu einem 18-Jährigen. Viel zu groß und massiv für ein WG-Wohnzimmer. Und dazu sechs Stühle – ganz schön optimistisch. Fast jeder erinnert sich noch an seinen ersten Ausflug zu Ikea, als die erste Wohnung eingerichtet werden sollte. Dieser Tisch hatte es mir damals angetan.
Allein die Tischplatte war so schwer, dass wir sie zu viert in den Miet-Anhänger hieven mussten. Und dann noch diese massiven, klotzartigen Beine. Wie froh waren wir, dass unsere Wohnung im Erdgeschoss lag. Beim Einzug haben wir eine Kerbe in die Tischplatte geschlagen. Ich sehe sie gerade vor mir, 25 Jahre später, während ich diesen Text schreibe.
Der Tisch stand erst in Wien, in meiner ersten WG. Später in München in der ersten gemeinsamen Wohnung mit meiner damaligen Freundin. Dann in der ersten Wohnung mit meiner späteren Frau. Als im Wohnzimmer auch noch ein Babybett Platz finden sollte und vorübergehend ein kleinerer Esstisch hermusste, wartete er – zerlegt in seine Einzelteile – hinter dem Schlafzimmerschrank geduldig auf seinen nächsten Einsatz. Drei Jahre stand er in Madrid und jetzt in unserer Wohnung außerhalb Münchens. Unsere Kinder kennen nur diesen Tisch in ihrem Zuhause. Und wenn es nach mir geht, soll das noch ganz lange so bleiben.
Denn so sehr ich den Tisch mag, so entspannt kann ich dabei zusehen, wie er von ihnen malträtiert wird. Ich bin nicht mäkelig mit diesem Tisch. Mindestens zwei, manchmal viel mehr Kinder kleckern ihn täglich voll, malen ihn an, klopfen und kratzen mit Messern und Gabeln auf ihm herum. Löffeln Suppe auf die Tischplatte und rufen »Ammersee!«. Erklimmen ihn wie den Mount Everest. Bauen sich eine Höhle unter ihm. Versuchen, ihn durchs Wohnzimmer zu schieben (geht nicht, siehe oben). Sollen sie ruhig. Diesen Tisch kriegt keiner kaputt. Jede Kerbe, jeder Cut, jeder Kratzer erzählt eine weitere Geschichte vom Leben, das auf ihm und um ihn herum stattfindet.
Gerade sind wir auf der Suche nach einem Haus mit Garten. Wo das genau stehen wird, wie groß der Garten sein wird, ob es einen Keller haben oder ein Marder unterm Dach hausen wird – ich weiß es nicht. Aber ich weiß, wer – umringt von sechs Stühlen – in der Mitte des größten Zimmers stehen wird. Wolfgang Luef
Folge 81: Die Calvin und Hobbes Gesamtausgabe
Wir leben in einer verrückten Zeit, warum also nicht auf die Lebensweisheiten von einem kleinen Jungen und seinem imaginären Tiger vertrauen? Die beiden heißen Calvin und Hobbes und sind die Hauptfiguren der gleichnamigen Comic-Reihe, die erstmals 1985 erschien. Deren US-amerikanischer Erfinder und Zeichner Bill Watterson beendete die Reihe 1995 überraschend, trotz großem Erfolg. Seine gesammelten Calvin und Hobbes-Werke gibt es als vierbändigen Sammelordner mit allen über 3000 Comic-Strips auf rund 1400 Seiten. Diese Gesamtausgabe habe ich vor vielen Jahren geschenkt bekommen (sie sieht so gebunden auch einfach schick aus im Bücherregal).
Bill Watterson wollte mit dem rebellischen Sechsjährigen Calvin und seinem zum Leben erwachten Stofftiger Hobbes mehr als nur Kinderunterhaltung oder Lacher auf der Comic-Seite vieler Tageszeitungen produzieren. Das merkt man schon daran, dass er Calvin nach dem im 16. Jahrhundert lebenden Reform-Theologen Johannes Calvin benannt hat und den Tiger Hobbes nach dem Philosophen Thomas Hobbes. Die beiden erleben nicht nur laufend Abenteuer, die oft auf halsbrecherischen Schlittenfahrten stattfinden oder im Weltall (in Calvins Tagträumen im Schulunterricht). Sie sprechen auch miteinander über die großen Themen der Welt: Freundschaft, Liebe, Umweltschutz, Gerechtigkeit, der Sinn des Lebens, Erziehung, Identität, Fiktion, Tiere und Eltern.
Dabei sind sie nicht belehrend oder altklug oder moralisierend, ihre Lebensweisheiten sind eher die Folge von sympathischen Missgeschicken, Niederlagen, Dummheiten und Reinfällen. Calvin und Hobbes ohne die begleitenden Comic-Geschichten zu zitieren wird dem Gesamtkunstwerk nicht gerecht, aber dennoch hier mal vier Beispiele:
»The surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that it has never tried to contact us.« (»Das sicherste Zeichen dafür, dass es irgendwo im Universum intelligentes Leben gibt, ist, dass es nie versucht hat, mit uns Kontakt aufzunehmen.«)
»There is never enough time to do all the nothing you want.« (»Es gibt nie genug Zeit, um all das Nichts zu tun, das man will.«)
»Live is full of surprises. But never if you need one.« (»Das Leben ist voller Überraschungen. Aber nie, wenn du eine brauchst.«)
»Day by Day, Nothing Seems to Change, But Pretty Soon...Everything's Different.« (»Tag für Tag scheint sich nichts zu ändern, aber ziemlich bald… ist alles anders.«)
Man muss hier noch mal sagen, dass Calvin und Hobbes-Comics nicht nur klug die Welt beobachten, sondern auch sehr süß gezeichnet und richtig lustig sind. Mitunter wirken Calvin und Hobbes fast hellseherisch, etwa wenn Calvin sagt: »Ich verweigere die Realität nicht. Ich bin nur wählerisch bei der Realität, die ich akzeptiere.« Wir leben 2025 in einer Welt, in der sich Staatsführer mitunter benehmen wie Sechsjährige aus einem Comic, die mit einem Schlitten ungebremst Richtung Baum rasen. Marc Baumann
Folge 80: Die Räucherstäbchen
Ich bin eine Räuchertante. Hin und wieder zünde ich ein Räucherstäbchen an und stecke es glühend in die dafür vorgesehene Schale. Manchmal laufe ich damit sogar durch die Wohnung, dann fühle ich mich wie eine kleine Hexe. Doch angefangen hat das Ganze nicht, weil ich an Energien glaubte oder meditieren wollte, sondern wegen eines Imbisses.
Auch meine Mutter hat unser Haus immer wieder geräuchert. Als Kind fand ich das nervig. Dann roch es nach Weihrauch, wie in der Kirche. Und es war kalt, weil sie währenddessen alle Fenster und Türen geöffnet hatte. Meistens räucherte sie in der Nacht von Halloween auf Allerheiligen, um alles Negative und den »Dreck« aus dem Haus zu vertreiben. Oft auch, bevor bei mir in der Schule eine wichtige Prüfung anstand. Wertgeschätzt habe ich das leider nie.
Als ich vor zwei Jahren in meine erste eigene Wohnung zog, dachte ich nicht, dass ich mal mit einer rauchenden Lampe oder einem Stäbchen darin herumschleichen würde. Doch eines Tages wurde der Geruch nach Frittierfett, der aus dem Imbiss unter meiner Wohnung heraufzog, zu penetrant. Eine Lösung musste her. Da ich nicht wollte, dass meine Wohnung nach dem Zitrusduft eines Gäste-WCs roch, entschied ich mich, den Esoterikladen um die Ecke zu besuchen – und kam mit verschiedenen Sorten an Räucherstäbchen und einer passenden Schale nach Hause.
Anfangs zündete ich nur ein Stäbchen an, wenn es draußen wieder zu sehr nach Frühlingsrollen roch. Als ich meiner Mutter am Telefon das erste Mal davon erzählte, konnte sie sich das Lachen nicht verkneifen. Doch mittlerweile möchte ich den rauchigen Geruch nach Sandelholz und Lavendel auch an den anderen Tagen nicht mehr missen. Zwar zelebriere ich das Räuchern nicht so wie meine Mutter, aber ich verstehe inzwischen ihre Liebe dazu. Jedes Mal, wenn ich mir ein Stäbchen anzünde, denke ich an sie, und dann fühlt es sich ein kleines bisschen nach Zuhause an. Sophia Mayer
Folge 79: Die Yogamatte
Ich mache gerne Yoga, aber es gibt drei Sachen, die es mir oft etwas erschwert haben. Ich bin sehr dehnbar und habe etwas instabile Knie, wenn ich nicht aufpasse, rutscht mir eines davon weg oder ich knicke um. Und ich schwitze schnell, vor allem an den Händen und Füßen. Deshalb wurde aus meinem herabschauenden Hund sehr oft ein herabrutschender Hund. Während ich mein Gesäß in die Luft streckte, mich eigentlich darauf konzentrieren sollte, den Rücken gerade zu lassen und tief zu atmen, war ich damit beschäftigt, die eine Hand am Hosenbein trocken zu wischen, um nicht gleich auf der Nase zu landen.
Eines Tages besuchte ich eine gute Freundin, bei der ich mich nicht scheue, über diverse Unappetitlichkeiten, die einem das Leben so beschert, zu sprechen, und erzählte ihr von meinem Problem. Sie ist nicht nur eine gute Zuhörerin, sondern auch eine äußerst tatkräftige Person. Sie rollte mir eine rote Matte aus und schaltete ein 30-Minuten-Morning-Flow-Video ein. Zum ersten Mal rutschte ich nicht. Offenbar war ich nämlich gar nicht so alleine, wie ich in diversen Yogastudios gedacht hatte. Sie kannte das auch und hatte sich eine spezielle Matte zugelegt, die B Mat, aus Naturkautschuk. Der Hersteller wirbt damit, dass man förmlich an dieser Matte klebt. Das hätte mich, hätte ich nur den Text gelesen, eher abgeschreckt, ich wollte mich ja trotzdem geschmeidig bewegen. Aber plötzlich ging genau das ohne Probleme. Ich stand, auch im herabschauenden Hund.
Ich bestellte mir eine, in Safrangelb, und fuhr damit zum ersten Yogaretreat meines Lebens. Dort sprachen mich viele auf die tolle Farbe an, ich fühlte mich wie eine Vertreterin für Yogamatten. Wenn ich seither alle paar Monate mal in einer anderen Stadt zum Yoga gehe und mich auf eine dieser Leihmatten stellen muss, dann fällt mir wieder ein, wie nervig das früher war. Zum Glück habe ich meine Freundin. Susan Djahangard
Folge 78: Die Stiefel
Mein Schuhwerk wirft oft Fragen auf. Nicht zuletzt, wenn ich wirklich noch einmal versichern muss, dass ich tatsächlich kein einziges Paar Sneaker besitze und es mir – nein – auch nicht fehlt. Denn meine Stiefel geben mir Halt. Nicht nur beim Laufen.
Mein Lieblingspaar trägt mich nun schon seit sechs Jahren durch mein Leben. Schwarze Vintage-Stilettos. Kniehoch, ohne viel Schnickschnack. Sie passten von Anfang an super. Und im Laufe der Zeit wurden sie perfekt. Die Sohle ist inzwischen ideal eingelaufen, das Leder hat vollständig die Form meiner Beine angenommen. Etwa alle zwei Monate bringe ich sie zum Schuster, um die Absätze zu erneuern. Denn das ist ihr einziges Manko: Die Pfennigabsätze laufen sich schnell ab. Ich freue mich jedes Mal, sie frisch aufpoliert in Empfang zu nehmen.
Wann genau ich angefangen habe, Stiefel statt Sneaker zu tragen, weiß ich nicht mehr. In meiner Schulzeit begleiteten mich weiße Turnschuhe durch den Alltag. Mehr aus Gruppenzwang als aus Überzeugung, gemocht habe ich sie nie. Sie repräsentieren für mich, was Leistung und Schule für mich bedeuteten: gesellschaftliche Uniformierung. Bloß nicht auffallen, bloß nicht gegen den Strom schwimmen.
In mir aber wuchs der Wunsch, genau das zu tun, von Tag zu Tag mehr. Bis ich irgendwann meinen stillen Protest nach außen trug. Wortwörtlich. Nicht nur optisch zeigte sich mein Wandel durch mein Schuhwerk, begleitet wurde dieser durch das lang ersehnte Klackern meiner Stilettostiefel. Ohne fehlt mir etwas. Stella Lukaschewski
Folge 77: Das »Traveller's notebook«
Es kommt aus Japan und war sicher nicht billig. Nicola hat es mir geschenkt, vor Jahren schon.
»Traveller’s notebook« heißt es, ein Kalender im altmodischen Brieftaschenformat, in Leder, ich habe es in Braun, aber es gibt sie auch in Schwarz oder Beige, mit den unterschiedlichsten Einlagen, die durch ein Gummiband gehalten werden.
Ich benutze die Notizeinlage mit weißen Blättern und die Kalendereinlage, die jeweils einen Monat auf einer Doppelseite zeigt. Die Kästchen für die einzelnen Tage bieten also nicht viel Platz. Mir reicht er eigentlich, denn ich schreibe nur Stichworte auf. Namen, Themen, Termine, Erledigungen. Beruflich und privat. Oft streiche ich die Stichworte durch, wenn sich etwas erledigt hat oder verschoben wurde. Manchmal kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen.
Das Erstaunlichste aber: Ich nehme meinen Kalender stets in die Redaktion mit, auch auf jede kleine Reise, dabei schaue ich nicht jeden Tag hinein, nur wenn ich drohe, durcheinander zu geraten, dann ordne ich mein Leben durch einen Blick in mein Traveller’s notebook.
Das Schreiben ist für das Merken wichtiger als wiederholtes Nachlesen. Wenn ich mir darin etwas handschriftlich notiere, ist es, als ob ich mir etwas direkt ins Hirn schreiben würde. Ich merke es mir durch das Schreiben. Beim Tippen funktioniert das nicht.
Schon in Schulzeiten habe ich so gelernt. Ich habe etliche Schmierzettel verfasst, die ich danach kaum angesehen habe, aber ich wusste exakt, wo ich etwas hingeschrieben hatte. Dritter Zettel im ersten oberen Drittel ziemlich weit rechts etwa. Wenn ich nichts aufschrieb, konnte ich mir nichts merken.
Deswegen also wird der Kalender im Handy oder E-Book mein Notebook nie ersetzen können. Ich brauche es, um mich wohlzufühlen. Ich werde nervös, wenn ich es mal einen Tag zu Hause liegen gelassen habe. Ich fühle mich dann nicht komplett.
Nicola, die mir das Notebook vor Jahren zu Weihnachten geschenkt hat, ist so etwas wie meine beste Freundin, und sie weiß oft, was mir guttut. Lars Reichardt
Folge 76: Die Teedose
Irgendwann muss meine Mutter diese blaue Teebüchse mit Ceylon Breakfast Tea gekauft haben, sagen wir zu einer Zeit, als Helmut Kohl neuer Bundeskanzler wurde und Tee noch kein Wellnessgetränk war, sondern die Sparversion von Kaffee. Ich war vielleicht 13, als die Teedose in meinen Besitz überging und lange, sehr lange bei mir blieb. Und das kam so. Und nein, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen.
Wir brauchten etwas, das man sprengen konnte, mein Freund Christoph und ich, denn wir hatten jede Menge ungenutzter Silvesterböller gehortet und viel Zeit. Wir hatten schon eine ganze Reihe von Versuchen hinter uns: Kanonenschläge mit noch mehr Schnur umwickeln und zur Detonation bringen, Topf samt Deckel mittels darin platziertem Böller in die Luft jagen, solche Sachen, als die Teedose in unseren Blick geriet. Sie war aus Blech, hatte oben einen Deckel, den man schön festkleben konnte. Unten bohrten wir ein kleines Loch für die Zündschnur hinein, fertig war unser Sprengsatz, mit dem wir die abstrakte Lehre der Thermodynamik mit neuem Leben füllen wollten. Die Explosion, die wir in einer Lichtung im Wald nahe unserer Siedlung herbeiführten, war gar nicht so laut. Es hatte ordentlich Ploing gemacht und wir waren aus unserer Deckung herbeigeeilt, um das Ergebnis zu begutachten. Doch wo war der Deckel? Wir hatten etwa eine Minute gesucht, als selbiger endlich wieder von seiner Reise in den Himmel zurück segelte. Die einst eckige Dose war jetzt kugelrund, hatte Schmauchspuren und roch nach Schwarzpulver. So zierte sie nun meinen Kinderzimmerschreibtisch als Stiftebehälter, schmückte fortan meinen schwarzen Holzschreibtisch in der ersten Studentenbude, später den kleinen Wohnzimmersekretär mit dem Laptop drauf. Jetzt ist sie leider weg, irgendwie verschütt gegangen im Fluss der Zeit. Aber das Ploing wird für immer nachhallen. Als Erinnerung an unbeschwerte Jugendnachmittage, als die Dinge endlich ins Fliegen kamen. Thomas Bärnthaler
Folge 75: Der Senf
Sobald ich an einer Imbissbude mein Essen bestelle, treffen mich ungläubige Blicke: »Wie bitte? Sie wollen Senf dazu?« »Ja, Pommes mit Senf!«, antworte ich dann, »mittelscharf und reichlich bitte!« Denn: Ich liebe Senf.
Die Mixtur aus Senfkörnern, Wasser, Essig, Salz und Zucker hat schon als Kind mein Herz erobert. Zur (damals noch fleischigen) Wurst gab es Senf. Mit Ketchup oder Mayo konnte man mich auch als Vierjährige nicht locken. Das ist bis heute so geblieben und seitdem verfeinere ich alles mit Senf: Ich gebe ihn zum Ofengemüse, streiche ihn aufs Brot, dippe darin meine Karotten oder verteile ihn über gekochte Kartoffeln. Der mittelscharfe, gelb leuchtende Senf ist der Hauptakteur auf meiner Speisekarte. Er ist der perfekte Kompromiss zwischen all den Soßen. Nicht so süß wie Tomatenketchup, nicht so schwer und fettig wie Mayo und nicht so stinkig wie Knoblauchsauce. Senf verleiht faden Gerichte mehr Schärfe und Salatdressings mehr Tiefe.
Als Senfconnaisseurin würde ich mich trotz dieser Liebe nicht bezeichnen. Dijon-Senf, Feigensenf, Kremser Senf, Englischer Senf, Senf gemischt mit Mango und alle weiteren Senfvariationen interessieren mich nicht. Auf meinem Teller landet die klassische Variante: Mittelscharf. Ab und zu wechseln die Marken, manchmal landet auch der süße Senf neben der (veganen) Weißwurst und in seltenen Fällen wird zum extra scharfen Senf gegriffen. Ansonsten bleibt es klassisch, nur eben gemischt in wilden Kombinationen.
In meinem Kühlschrank finden sich immer ein paar Tuben Senf. Die sind nicht nur platzsparender und hygienischer als Gläser oder Tiegel, sondern damit lässt sich der Senf auch besser über den Pommes verteilen. In Erinnerung bleibt diese Bestellung meist auch und beim Imbiss meines Vertrauens kennt man mich schon: »Wie immer? Pommes mit Senf?« Xenia Beitz
Folge 74: Das Klopapierrollen-Schaf
Ich wusste nicht, dass Trauer sich so sehr nach Liebeskummer anfühlt. Es sind zwei Jahre seit des Todes meines Vaters vergangen. Und ich beginne zu verstehen, dass es Liebe mit verschiedenen Farben gibt. Dass die Liebe zu Freundinnen und Freunden eine andere Farbe hat als die Liebe zu meinem Partner, die zu meinen Brüdern und meiner Mutter eine andere als die Liebe zu meinen Neffen. Keine Liebe lässt sich austauschen und ersetzen. Auch nicht die meines Vaters, die sich sonnengelb anfühlte.
An manchen Tagen schaffe ich es, immer wieder auszublenden, wie sehr ich diese sonnengelbe Liebe vermisse. Weil mein Mann mich auf eine tiefblaue Weise liebt, die mehrere Räume flutet; ich hellgrüne Liebe spüre, wenn ich mit dieser einen Freundin lache; orangefarbene Liebe durchs Telefon kommt, wenn meine Neffen mir sagen, wie sehr sie sich schon auf meinen nächsten Besuch freuen.
Aber dann gibt es Tage, da weine ich um das verlorene Sonnengelb. Ich vermisse meinen Vater immer noch an ganz gewöhnlichen Dienstagen oder Mittwochen, an denen etwas Schönes in meinem Leben passiert und ich ihn nicht anrufen und ihm davon erzählen kann. Ich vermisse ihn, wenn ich das Meer sehe, das er so geliebt hat. Und ich vermisse ihn an den klassischen Tagen, die bestimmt alle Trauernden kennen: an Geburtstagen und Weihnachten.
Als Erwachsene ist es schwer genug, Weihnachtsmagie zu erschaffen, schließlich ist man selbst dafür zuständig. Vermutlich wird es bei mir dieses Jahr so ablaufen wie im vergangenen: Ich werde gemeinsam mit meinem Mann in einem vollen Supermarkt das Essen einkaufen, danach den Baum schmücken, Geschenke verpacken und Karten schreiben. Dann, irgendwann am Nachmittag, wenn fast alles erledigt ist, werde ich meinen Vater vermissen. Und genau für diesen Moment bewahre ich einen alten Pappkarton auf.
Darin liegt eine Krippe, die meine Eltern und meine großen Brüder vor etwa 35 Jahren aus Papp- und Stoffresten selbstgemacht haben. Am liebsten mag ich das Schaf, das aus einer Toilettenpapierrolle gebastelt wurde, und auch genauso aussieht. Wenn ich das Schaf wiedersehe nach einem Jahr Pause, muss ich meistens lachen. Und wenn ich lache, ist es für kurze Zeit immer sonnengelb in mir. Dorothea Wagner
Folge 73: Die Helmmütze
Kennen Sie noch Goofy, den treudoofen Freund von Micky Maus? Jetzt stellen Sie sich bitte ganz kurz vor, man würde diese arme Hundefigur skalpieren. Und sich die dunkle Kopfhaut mit den langen baumelnden Ohren dann selbst auf den Kopf setzen. Fürchterlich, oder? Nun muss ich gestehen: Ich besitze ein Kleidungsstück, das dieser Horrorvorstellung recht nahekommt. Und ich liebe diese unglaublich hässliche, unglaublich praktische Mütze so sehr, dass ich hier von ihr berichten will. Ursprünglich für Radrennfahrer gemacht, die auch bei eisigen Temperaturen hunderte Kilometer in der Woche durch den Eisregen strampeln, habe ich als eher lahmer Großstadt-Radler das Ding lieben gelernt, als ich mir einen Helm zugelegt habe. Beziehungsweise, als ich anfangen habe, den zu Hause vor sich hin staubenden Helm auch zu tragen. Kurz zuvor hatte mir ein befreundeter Arzt erzählt, in welch unterschiedlicher Verfassung die vom Rad geschleuderten Patienten bei ihm auf dem OP-Tisch landen – je nachdem, ob sie einen Helm trugen, als die Autofahrerin von rechts aus der Nebenstraße auf den Radweg gedüst kam. Oder eben nicht. Mein Arzt-Freund hatte sichtlich Vergnügen mit der realistischen Schilderung seiner Arbeit, seine Erzählung zeigte augenblicklich Wirkung, so dass ich von da an im Winter mit einer viel zu dicken Wollmütze unter dem dann plötzlich drückenden Helm durch die Stadt fuhr – und alle 500 Meter die in die Stirn gerutschte Wollmütze hochschieben musste zwischen Oktober und Ostern, schweißnasse Haare fast jeden Tag. Und dann kam dieser Goofy-Skalp aka Helmmütze in mein Leben. Der Kopf bleibt warm und trocken und mein Fahrradhelm hat plötzlich sogar den einzig denkbaren ästhetischen Vorteil: Er verdeckt diskret das hässlichste und beste Winterhalbjahr-Kleidungsstück der Welt. Timm Klotzek
Folge 72: Das Buchweizenkissen
Es muss vor ungefähr zwanzig Jahren gewesen sein, und ich weiß noch, dass ich überhaupt keine Lust auf das Tollwood-Winterfestival in München hatte. Aber ich war zufällig in der Nähe, hatte Hunger und dachte: Wo, wenn nicht hier, kriegst du unkompliziert was auf die Hand, einen Döner oder eine indische Linsensuppe. Am Ende verließ ich das Gelände hungrig – zu viele Menschen, zu wenig Geduld –, dafür mit einem Nackenkissen aus Buchweizen. Der bärtige Verkäufer tat mir leid, außerdem dachte ich an meine Rückenschmerzen und dass sich mein kleiner Abstecher so wenigstens gelohnt hätte.
Dezember 2024: Ich sitze im ICE Richtung Hamburg, neben mir eine Reisetasche, obenauf das Nackenkissen von damals. Es ist mein treuester Begleiter, war mit mir in der Wüste und im Dschungel, in Absteigen und Grandhotels, von den letzten fünftausend Nächten haben wir ganze vier ohne einander verbracht – ich habe es zweimal in einem Hotel vergessen, aber noch aus dem Taxi dafür gesorgt, dass es mir mit Express hinterhergeschickt wurde. Der sandfarbene Bezug war nach zwei Jahren abgewetzt, aber ich ließ mir neue schneidern, aus hübschen Stoffen, auch die sind längst verschlissen, meine Schneiderin schüttelt nur noch den Kopf. Nach zehn Jahren platzte es zum ersten Mal auf, aber ich nähte es notdürftig zusammen und saugte die Buchweizenschalen aus meinem Bett, seitdem wiederholt sich das Ganze alle paar Jahre, das Kissen ist nicht mehr ganz so prall wie am Anfang, aber ein neues kommt nicht in Frage, ich käme mir vor wie ein Verräter. Dabei verwende ich es nicht mal korrekt: Eigentlich sollte man sich das halbmondförmige Ding um den Hals legen, damit der Nacken entlastet wird, ich aber knülle es zusammen und bette meinen Kopf darauf. Ich befürchte, es zerstört meinen Rücken jede Nacht ein bisschen mehr, aber was soll ich tun, ich bin süchtig: Es ist weder weich, noch hart, man sinkt ein, aber nicht zu tief, ich fühle mich gehalten, aber nicht eingeengt, bei der kleinsten Bewegung knirschen die Buchweizenschalen beruhigend – ich kann mir mein Leben ohne dieses Kissen nicht mehr vorstellen.
Neulich musste ich zum Radiologen. Die Leiste. Selbstverständlich bestand ich darauf, auf meinem Buchweizenkissen in die Röhre geschoben zu werden. Ich kann mich gut an den Blick der Arzthelferin erinnern: Oje, ganz schwieriger Fall. Aber das war mir egal, das vorgesehene Plastikteil war viel zu weich, keine zwei Minuten hätte ich es ausgehalten, erst recht nicht in dieser Röhre. Es war dann etwas kompliziert, der Reißverschluss störte das Magnetfeld, aber ich habe mich durchgesetzt und es hat funktioniert – nur die Leiste war kaputt. Im Januar muss ich ins Krankenhaus. Ob ich mein Kissen in den OP-Saal nehmen darf? Tobias Haberl
Folge 71: Das Nähkästchen
Mein Nähkästchen hat eine Seele. Glauben Sie nicht? Ich bekam es von meiner Großmutter. Sie war Schneiderin, und als ich von zu Hause auszog, stellte sie für mich etwas von all dem zusammen, das ihre Welt im Innersten zusammenhielt: Fäden, Garne, Nadeln und eine kleine Auswahl an Knöpfen. Geschichtet in eine – muss man doch nicht wegschmeißen – Ferrero-Rocher-Schachtel. Ich besitze das genau so bis heute. Das Heiligtum im Heiligtum ist ein gefaltetes Blatt Küchenrolle, durch das sie ein paar Nadeln verschiedener Größe gesteckt hat. Es war ihr Überlebens-Kit für mich in der großen Stadt: Kleidung selbst reparieren zu können, war in ihren Augen so lebensnotwendig wie eine funktionierende Heizung oder Essbesteck.
Denkt man an Erbstücke geliebter Menschen, dann fallen einem Dinge wie Halsketten, feine Gläser, Trachtenjanker ein – derlei habe ich von meiner Oma auch übernommen, aber das, was mir von allem am wertvollsten ist, sind die Nähsachen, die kaum materiellen Wert haben. Vielleicht hat das mit der Handarbeit zu tun, die ihr Beruf war, damit, dass in den Nähutensilien ein Teil von ihr steckt, ja regelrecht in sie übergegangen ist. Vielleicht weil ihre Arbeit eben doch so ein großer Teil ihrer Identität war – sie war, denke ich heute, mehr als Mutter, Nachbarin, Witwe und Kannst du mal eben das Loch in der Levis flicken, Oma. Sie war Schneiderin.
So profan es ist, das Nähkästchen heute in die Hand zu nehmen (gibt es etwas Profaneres als einen losen Knopf?), so feierlich sind für mich die Minuten, die folgen. Ich setze mich aufs Sofa, und die kleine, meist ziemlich stümperhafte Näherei wird zu einem Mini-Requiem, zu einer Meditation, in der meine Oma neben mir sitzt. Manchmal sind wir auch kurz in ihrer Küche, die sie als Nähstube nutzte und in der immer der Geruch der Köstlichkeiten hing, die sie mir nach der Schule kochte. Ich höre das Rattern ihrer Nähmaschine und wie sie »Murks« murmelte, wenn beim Nähen mal was nicht klappte oder – schlimmer in ihren Augen – die Verarbeitung der Hersteller schon mangelhaft war. Ja, H&M, Oma meint dich. Seit ihrem Tod habe ich oft ihr Grab auf dem Friedhof im Ort besucht, ich stand immer etwas betreten herum, wusste nicht, ob ich mir ihr oder Gott sprechen sollte, ich ahnte: Wenn ich meiner Oma wirklich nah sein will, dann nähe ich und murmle leise »Murks«. Annabel Dillig
Folge 70: Der Fleecepulli
Ausnahmslos jeder Morgen beginnt mit der Zumutung, eine Entscheidung treffen zu müssen. Noch bevor man einen klaren Gedanken fassen kann, drängt sich die Frage auf: Was ziehe ich heute an? An Standby-Tagen wähle ich reflexhaft polyesterne Verlässlichkeit: meinen mitternachtsblauen Fleece-Pullover.
In einem Winter vor etlichen Jahren habe ich ihn meinem Vater abgeluchst. Er trug ihn nur, wenn bei uns mal wieder die Heizung ausgefallen war, ich sah ihn bei mir besser aufgehoben – obwohl er mir bis heute zu groß ist. Die Ärmel muss ich umkrempeln und das Gummiband am unteren Saum gut festziehen, damit der Pulli mir nicht auf die Oberschenkel rutscht. Letztens habe ich meinen Vater gefragt, woher er den Pullover hat. Er meinte, es sei das letzte Geschenk seiner Oma gewesen, kurz nach meiner Geburt ist sie gestorben.
Seitdem ich ihn habe, ist mir der Pulli überall hin gefolgt. Ein Silberstreif, während ich durch jugendliche Modesünden irrlichterte, noch immer nehme ich ihn in jeden Urlaub mit. Ich weiß gar nicht genau, was mich seit all den Jahren an ihm begeistert. Womöglich ist es dieses diffuse Gefühl von Sicherheit. Er ist das Erste, was ich anziehe, wenn ich im Winter nach Hause komme, das Kleidungsstück, das ich am längsten trage. Nicht am liebsten, aber am verlässlichsten. Vielleicht, denke ich, ist Heimat gar kein Ort, sondern ein Stück Stoff. Sven Fröhlich
Folge 69: Die Stehlampe
Meine 15-jährige Tochter stellt sich Erwachsenwerden nicht als Prozess vor, sondern als konkreten Moment, deshalb fiebert sie ihrem 18. Geburtstag schon jetzt entgegen. Ich weiß es besser: Erwachsen werden wir in kleinen Schritten, viele davon in die falsche Richtung. Einer der wesentlichen Schritte auf unserem Weg: Die Erkenntnis, dass Licht eine wesentliche Rolle im Leben spielt. Nach zu vielen Jahren, in denen wir beim Einzug in eine neue Wohnung praktische Deckenstrahler mit 100-Watt-Knallern darin auf alle Zimmer verteilt und unter Operationssaal-Beleuchtung zwar alles sehen, aber nichts mehr spüren konnten, beginnen wir irgendwann, den Reiz des Schummrigen zu schätzen. Das Leben hat dunkle Ecken – warum nicht auch die eigene Wohnung? Mehrere kleine Leuchten, verschieden groß, verschieden hell und gut verteilt im Raum, sind immer die bessere Alternative. Die schönste aller Stehleuchten ist für mich die »Switch On« von Lambert, ein elegantes, schmales Wunder mit einem, zwei oder drei Armen, die sich beliebig bewegen und anordnen lassen. Günstig ist sie nicht – aber dafür, dass man sich ein ganzes Leben lang an ihr freuen kann, passt der Preis. Sie begleitet mich seit über 25 Jahren, zweiarmig in meinem Fall, und stand schon in vier verschiedenen Wohnungen. In jedem Raum fand sie wie von selbst ihren Platz. Und auch wenn sich mein Geschmack in Einrichtungsfragen immer wieder ändert: Diese zeitlose Leuchte macht jeden Unsinn, jede Volte, jedes Nachbarmöbelstück mit. Eine treue, strahlende Begleiterin bei meinem Versuch, niemals so ganz erwachsen zu werden. Michael Ebert
Folge 68: Die Schraubgläser
Mitte September war der Küchenschrank dran: Ich musste Platz machen. Vordergründig für meine Zwischenmieterin, aber eigentlich, weil die Sache langsam aus dem Ruder lief. Ich blickte unglücklich ins obere Fach.
In den Schraubgläsern, in denen Aufstrich, Apfelmus, Kichererbsen, Gewürzgurken oder passierte Tomaten verkauft werden, sehe ich: Aufbewahrungsgläser für Granola, Nüsse oder Hefeflocken und perfekt geformte, auslaufsichere Behältnisse, um Suppe oder Joghurt zu transportieren. Deswegen ist mittlerweile eine Sammlung an Schraubgläsern entstanden, die haushaltsübliche Dimensionen übersteigt. Einige sind erst ein paar Wochen alt, andere haben schon mehrere Umzüge mitgemacht.
Mein Lieblingsglas wohnt seit letztem Advent bei mir, es ist klein und hoch. Ursprünglich war darin ein Ingwershot, jetzt transportiert es treu Salatdressing, damit mein Mittagessen bis zur Pause nicht durchgeweicht ist. Bis es bei mir gelandet ist, wusste ich nicht, wie sehr ich es brauche. Immer wenn es zum Einsatz kommt, bin ich seltsam stolz, sein Potenzial erkannt zu haben.
Und wer dieses Überlegenheitsgefühl einmal gefühlt hat, für den wird der Gang zu den Konserven im Supermarkt schnell zum Talentscouting. Ich verstehe plötzlich meine Oma, die sogar alte Quarkbecher aufbewahrt hat, damit Opa darin Schrauben sortieren kann. Trotzdem musste ich mit ein paar Gläsern Schluss machen. Zumindest für die Zeit, in der die Wohnung untervermietet ist. Ein paar – darunter das Lieblingsglas – durften natürlich bleiben. Und das Gute an den Gläsern ist ja: Es gibt sie überall und ich kann sie wieder nachkaufen, wenn ich zurück bin. Jule Ahles
Folge 67: Der Mini One
Als ich 18 wurde, bekam ich mein Auto. Kein schickes Ding. Einen Mini One, gefunden auf Ebay. Baujahr 2003. 90PS. Schwarz, mit violetter Motorhaube, die ich zwei Monate später umlackieren ließ. Allerdings wurde sie nicht wie der Rest des Wagens in metallischem Look lackiert, sondern mit funkelnden Pigmenten versetzt. Und das sollte nicht das letzte Malheur bleiben, nur wusste ich das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Nachdem ich den ersten Frust überwunden hatte, fuhr ich also mit meiner glitzernden Motorhaube in meine neu erlangte Freiheit. Hinter dem abgegrabbelten Lenkrad schien mir die Welt offen zu stehen.
Etwa einen Monat später fiel mein Auspuff ab. Es folgten akutes Kühlerversagen, Lenkungsblockaden, diverse Motorschäden, eine neue Kupplung und vier neue Bremsen. Mein Auto fiel gleich zweimal durch den TÜV. Und plötzlich lag mir nicht mehr die Welt, sondern ein »How to repair your Mini«-Handbuch zu Füßen. Irgendwann zwischen Abiprüfung und Bachelorabschluss entwickelte sich mein kaputtes Auto in meinem Freundeskreis zum Running Gag. Gelacht habe ich jedoch selten.
Inzwischen kann ich (zum Glück!) sagen: Mein Auto fährt wieder, und zwar zuverlässiger denn je, dank technischer Kernsanierung. Es sind aber auch einige neue Macken hinzugekommen. Ein enormer Kaffeefleck, der in wildem Gelächter mit meinem besten Freund entstand, als er sich wieder einmal über meinen Fahrstil beschwerte. Eine Katsche am Rücklicht, als ich etwas zu schwungvoll ausparkte und gegen die Bio-Tonne meiner Nachbarin fuhr. Das Handschuhfach, das inzwischen beim kleinsten Hubbel auffällt. Mein Fenster, bei dem die Kurbel-Automatik klemmt, sodass man einmal gegen die Tür schlagen muss, damit es sich wieder bewegt.
Unter meinen Freunden hat mein Auto mittlerweile Kultstatus erreicht. Und auf die Frage, ob es denn noch fahre, schießen mir mittlerweile keine Tränen mehr in die Augen. Ich antworte einfach mit: Ja! Zumindest noch bis März, dann steht der nächste TÜV-Termin an. Stella Lukaschewski
Folge 66: Die Kokosnuss
Ich mag es nicht, Reisen genau durchzuplanen, weil Pläne keinen Raum für Zauber lassen. Die ausgehöhlte Kokosnuss in meinem Regal erinnert mich daran, Dinge manchmal einfach geschehen zu lassen.
Zwölf Jahre ist es her, dass mein bester Studienfreund und ich in Nassau landeten, der Hauptstadt der Bahamas. Wir hatten keine Adresse unserer Unterkunft der nächsten zwei Monate. Wir wussten nur, dass uns ein Fremder am Flughafen abholen wollte.
Unser letztes Medizin-Studienjahr, das »praktische Jahr«, war fast vorbei. Wir waren stolz, wir waren traurig, wir wussten, dass sich unsere Wege bald trennen würden. Noch einmal etwas Besonderes zusammen erleben, so der Plan. Ich weiß nicht mehr, wer die Idee hatte, einen Teil unserer letzten Zeit in einem Krankenhaus auf den Bahamas zu verbringen. Aber ich weiß noch, dass wir zwar gerade noch die horrenden Studiengebühren bezahlen konnten – aber keine Unterkunft. Also hatten wir eine Anzeige auf couchsurfing.com geschaltet. Ein User schrieb, seine Oma habe ein riesengroßes Haus, einen tropischen Garten und ein leeres Zimmer. Sie wolle keine Miete. Und – vollkommen unüblich für Couchsurfing – durften wir dort nicht nur ein paar Nächte bleiben, sondern ganze zwei Monate. Ein »Freund der Familie« würde uns am Flughafen abholen. Alles sah nach einem Betrug aus. Wir sagten zu.
Der Garten der Oma war so groß, dass man 15 Minuten brauchte, um ihn einmal ganz zu durchschreiten. Neben der Veranda wuchsen Bananen und andere tropische Früchte. Wir höhlten zwei Kokosnüsse aus und tranken daraus kaltes Bier. Das Haus lag etwas ab vom Schuss. Wir brauchten ein Fortbewegungsmittel.
Die Verkäuferin im Fahrradladen mochte uns. Sie lachte über die Kokosnusstrinkbecher im Netz unserer Rucksäcke. Sie sagte, sie habe einen herumstehenden Zweitwagen. Acht Wochen fuhren wir umsonst damit herum.
Vor der Küste Nassaus lagen tropische Inseln. Man erreichte sie nur auf Privatbooten. Ein Freund unserer Gastgeber-Oma hatte ein Boot. Er teilte es mit uns.
Jetzt, zwölf Jahre später, kam mich zu meinem Geburtstag mein alter Studienfreund besuchen. Er schenkte mir ein gerahmtes Foto. Unsere Köpfe schauen darauf aus kristallklarem Wasser hervor. Eine Erinnerung an die Zeit, als wir ganz ohne Plan für zwei Monate umsonst ein Haus, ein Auto und ein Boot gehabt hatten. Der Freund zog seine ausgehöhlte Kokosnuss aus dem Rucksack. »Zum Anstoßen!«, sagte er. Ich lief zum Regal und wischte den Staub von meiner Nuss. Vivian Pasquet
Folge 65: Das Multifunktions-Kopftuch
Neulich habe ich es für einen Urlaub gesucht und nicht gefunden: mein Reise-Haarband. Jedenfalls habe ich es so genannt. Inzwischen bin ich schlauer, weil ich nach der haarbandlosen Reise hektisch nach Ersatz gegoogelt habe – so sehr habe ich es unterwegs vermisst. Im Internet heißt es zum Beispiel Yoga-Stirnband oder Multifunktions-Kopftuch. Meins habe ich namenlos vor einigen Jahren in einem kleinen Laden in Hamburg erstanden, ganz nebenbei und ohne zu wissen, welchen Schatz ich da gefunden hatte.
Es ist ein breites Stirnband aus dünner Baumwolle, und damals hatte ich im Kopf, dass es mir bei der nächsten Tour meinen Pony und sonstige Haarsträhnen aus dem Gesicht halten sollte. Tat es auch. Aber es konnte viel mehr, denn bei Bedarf kann man es sich fast über den ganzen Kopf ziehen. So schützt es die Kopfhaut vor Sonnenbrand. Oder die Ohren vor Wind. Man kann die Haare drunter verstecken, wenn es unterwegs mal länger keine Möglichkeit zum Haarewaschen gibt. Oder es sich im Nachtbus über die Augen ziehen für ein bisschen Privatsphäre. Wiegen tut es quasi nichts und problemlos waschen kann man es unterwegs auch immer, weil es so schnell wieder trocken ist. So wurde es ein treuer Reisebegleiter – es gibt Bilder von Touren, wo ich es auf gefühlt jedem zweiten Bild trage.
Ich mache es kurz: das neu bestellte Multifunktions-Kopftuch/Yoga-Stirnband aus dem Internet konnte mit meinem alten Reise-Haarband leider nicht mithalten. Es saß nicht so gut, irgendwas war falsch. Aber gerade, als ich dachte, dass ich mich halt mit dem neuen arrangieren muss, fand ich das alte wieder. Ab jetzt werde ich besonders gut drauf aufpassen. Nicola Meier
Folge 64: Essig
Halten Sie mich für verrückt, aber Essig ist die tollste Flüssigkeit der Welt. Man kann mit Essig Speisen verfeinern, vom Salatdressing über eine Bolognese bis zum Dip für Xiaolongbao, chinesische Suppen-Dumplings (nur Barbaren essen Dumplings mit Chilisauce). Man kann mit Essigessenz putzen und in Kombination mit Natron löst er jeden Staudamm im Abfluss. Ich bin mit einem Langhaarcollie aufgewachsen, ich weiß, wovon ich rede. Sogar Wunden kann man damit behandeln, lernte ich mal als Kind. Ich war in einem Alter, in dem man noch viele Sachen ausprobierte, um herauszufinden, ob etwas gut oder nicht so gut war. Eiscreme: gut! Hand auf heißer Herdplatte: nicht so gut! Ein kurzer stechender Schmerz und meine Hand erinnerte an Anakin Skywalker, der nach seinem Kampf mit
Obi-Wan Richtung glühende Lava rutschte und Sie ahnen ja, was die Verbrennungen mit dem gemacht haben: Ohne schwarzen Helm ging der nicht mehr raus. Ich befürchtete schon, für immer entstellt zu sein, aber meine Großmutter eilte mit einer Flasche schwarzem Essig und einer Schüssel herbei, goss einen großzügigen Schluck ein und badete dann meine Hand darin. Es brannte höllisch und roch fast noch schlimmer. Aber nach einer Weile wurde es besser. Was ich nicht wusste: Die Säure im Essig wirkt leicht antibakteriell und war ein gängiges Hausmittel in alten chinesischen Haushalten. Ich wurde so ein Essig-Fanatiker, dass ich auf Partys gerne fragte, was denn das Lieblingsputzmittel der anderen war, nur um meiner Begeisterung für Essigessenz als Wundermittel der Hauswirtschaft Luft zu machen. Nachdem einige Frauen das aber in den falschen Hals bekamen (chauvinistisches Arschloch!!!), beschloss ich, meine Smalltalk-Taktik zu überdenken. Am leichtesten fällt mir das Denken beim Schrubben meiner Badewanne, während mir der säuerlich-herrliche Duft das Hirn vernebelt. Marvin Ku
Folge 63: Der Schal
Ich verliere oft Dinge, die ich mag. Die blaue Lieblingsmütze mit der Blume drauf, mein ganzer Stolz in der dritten Klasse. Einen Ring mit einem Stein meiner Großmutter. Den Geldbeutel in genau dem richtigen Braunton, der fast weinrot war, vom Trip nach Istanbul.
Bei meiner Verlustbilanz ist erstaunlich, dass ich ein Accessoire über all die Jahre behalten habe: einen Schal mit Blumenmuster, quadratisch, aus Wolle. Der Schal würde mir in keinem Laden auffallen, die Farben sind irgendwas zwischen lila, grün und dunkelblau. Er ist immer genau ein paar Zentimeter zu kurz. Beim Fahrradfahren bleibe ich genervt im Herbstwind stehen, um den Schal wieder in sich selbst einzuzwicken, damit er nicht runterfällt. Den Schal habe ich von meiner Mutter. Als wir klein waren, deckte sie uns beim Mittagsschlaf darunter zu, erst meine Geschwister und später mich. Der Stoff kratzte ein bisschen, aber das war uns egal, denn er roch immer wahnsinnig gut nach Parfum.
Vor ungefähr zehn Jahren schenkte mir meine Mutter den Schal, weil sie ihn nicht mehr trug. Zu der Zeit hatte meine Mutter ihr Parfum schon lange gewechselt, dafür hatte ich irgendwann unbewusst begonnen, ihr Parfum von früher zu kaufen – es war das einzige, das ich auch noch nach mehreren Duft-Experimenten (bizarr, teuer, Chanel) wirklich mochte. So ein Umweg, da hatte ich mich monatelang fremd eingesprüht und am Ende landete ich zuhause.
Nicht nur den Schal, auch das Parfum habe ich bis heute, deswegen riecht die Wolle immer noch nach dem, was auf dem Parfumflakon steht: weißer Tee. Eigentlich riecht der Schal aber natürlich nach Mittagsschlaf und nach der Kinderidee, zuerst nur so zu tun, als würde man schlafen (genial!) und dem ertappten Gefühl beim Aufwachen, wenn man dann doch eingeschlafen war. Irgendwann werde ich ein Kind unter diesem Schal zudecken. Ich bete, dass ich ihn vorher nicht verliere. Theresa Hein
Folge 62: Der Hackklotz
Als ich vor vielen Jahrzehnten meine erste Wohnung in München einrichten wollte, fuhr ich dafür durchs oberbayrische Umland, um bei jenen Scheunen zu halten, an denen handgemalte Schilder »Antikes & Raritäten« versprachen: von Bauernhöfen ausgespuckte Überbleibsel wie Melkschemel, zerbeulte Milchkannen oder Waschzuber aus Emaile - altes Geraffel für Menschen, die froh sind, keine zerbeulten Milchkannen mehr nutzen zu müssen, aber für eine landlustige Großstädterin wie mich das Größte: so urig, so authentisch! Ich wollte diese antiken Dinge mit Modernem kombinieren, malte mir im Kopf das eklektische Interior Design meiner Butze schon aus.
An einem Tag wanderte ich wieder durch eine Scheune voll Bauerntischen, Truhen, Anrichten, auch im Garten stand viel Zeug. Plötzlich sah ich: den schönsten Beistelltisch, den ich je gesehen hatte! Aus altem Holz, mit einer interessanten, fast grafisch anmutenden Oberflächenstruktur. Den wollte ich haben, direkt neben meinem Sofa, ich war schockverliebt. Ich fragte den Besitzer, was dieser schöne Beistelltisch kosten solle. »Was für ein Tisch? Das ist kein Tisch. Das ist mein Hackklotz. Darauf hake ich Holz für meinen Ofen.« »Oh. Kann ich den trotzdem kaufen?« »Sie wollen meinen Hackklotz kaufen?« Er sah mich irritiert an. Ich meinte, ihn innerlich den Kopf schütteln zu sehen: versteh einer diese Großstädter. Es wurde dann ein bisschen peinlich, weil keiner von uns eine Idee hatte, welchen Preis man für einen zerhauenen Hackklotz aufrufen könnte. Wir einigten uns auf 20 Mark. Die Wohnung in München habe ich schon lang nicht mehr, der Hackklotz ist viermal mit mir umgezogen, steht jetzt neben einem Sessel in meiner Berliner Wohnung, und wenn meine großstädtischen Gäste vorbeikommen, rufen sie entzückt: »Was für ein schöner Beistelltisch! So urig, so authentisch!« Kerstin Greiner
Folge 61: Die Nachttischuhr
Manche sind furchtbar genervt davon. Ich hingegen mag das Ticken meiner Nachttischuhr sehr gerne. Der gleichmäßige Rhythmus beruhigt mich, sodass sich meine Gedanken problemlos ordnen lassen. Unnötige »Ach!-Hättest-du-da-bloß-anders-gehandelt«-Bedenken, die mich oft vor dem Einschlafen heimsuchen wollen, werden von dem metrischen Ticktack ferngehalten.
Schon mehr als zehn Jahre begleitet mich diese Uhr. Dabei gefiel sie mir zu Beginn gar nicht: Ich habe sie zu meinem vierzehnten Geburtstag bekommen. Gehofft hatte ich auf ein anderes Geschenk, etwas Cooleres, Teenagergerechteres als eine aufklappbare Uhr. Wenig beeindruckt stellte ich sie damals auf meinen Nachttisch. Mehrere Jahre und Nachttische später steht sie nach wie vor beim Einschlafen stets an meiner Seite.
Optisch fand mein Teenager-Ich die Uhr »ganz okay«. Jetzt bin ich der Meinung, dass »ganz okay« ihr absolut nicht gerecht wird: Sieht man meine Nachttischuhr im geschlossenen Zustand, gleicht sie einem silbernen Kompass. Klappt man sie auf, offenbaren sich ein eierschalenfarbenes Zifferblatt und zwei Globen. Sie ist unaufdringlich elegant und klassisch – oder wie die Gen Z es sagen würde: »very demure, very mindful«.
Ich könnte die Uhr auch als Wecker nutzen. Mit Betonung auf »könnte«. Tue ich aber nicht, da ich wegen ihr mehrmals verschlafen habe: Sie hat einfach nicht geklingelt. Trotz dieses Makels will ich sie auf meinem Nachtkästchen nicht mehr missen. Nicht nur, weil sie optisch gut zu meiner Einrichtung passt, sondern vor allem, weil ihr Ticken zu einem vertrauten Rhythmus für mich geworden ist, den ich stets mit einem Gefühl von zu Hause und Geborgenheit verbinden werde. Anastasia Tolstunova
Folge 60: Das Kinder-Kochbuch
Die Beziehung zwischen uns war eingeschlafen, wir hatten uns auseinandergelebt und schließlich war ich ausgezogen – während mein »Maxi-Mini-Maus-Kochbuch« bei meinen Eltern im Regal geblieben war. Aber als mich während Corona das Koch- und Backfieber erwischte, fiel es mir wieder in die Hände und meine Liebe entflammte neu. Nun wohnen wir wieder zusammen.
Ich habe das »Maxi-Mini-Maus-Kochbuch« als Kind von der Schwester meiner Oma geschenkt bekommen. Welche Schwester es war, darüber sind sich meine Oma und ich nicht ganz einig. Vermutlich Tante Mitzi, die mit der besten Eierlikörtorte. Das Kochbuch ist von der Sendung mit der Maus, weswegen sich nicht nur Rezepte zu Nudeln, Pommes, Pizza, Muffins und Weihnachtskeksen darin befinden, sondern auch anderes Wissenswertes. Etwa: Wieso heißt die Pizza eigentlich Pizza? Gute Frage, oder? Die Maus kennt die Antwort: Das Wort Pizza stammt vermutlich aus dem Dialekt der italienischen Stadt Neapel. »Piz'za, Piz'za«, was so viel bedeutet wie »druck'ruck- druck'ruck!«, sollen die Pizzabäcker früher gerufen haben, während sie den Teig kneteten.
Obendrein gibt es zu jedem Kapitel einen Basteltipp. Die Basteltipps interessieren mich inzwischen weniger, aber das ein oder andere Rezept koche ich auch heute noch nach. Und wenn mich Freunde oder Familienmitglieder fragen, woher es stammt, sage ich mit Stolz: »Aus dem Maxi-Mini-Maus-Kochbuch!« Im ersten Moment schauen sie mich dann fragend an, aber wenn ich das Kochbuch hole, schmunzeln sie. Einmal mehr ein Zeichen dafür, dass man das Kind in sich manchmal einfach bekochen sollte. Vielleicht mit Jumbo Pommes oder Pizza-Clowns? Stefanie Rabensteiner
Folge 59: Der Mixer
Ich weiß, es klingt absurd. Aber ich glaube schon ein wenig an die Magie der Dinge. Daran, dass Gegenstände nicht nur schön oder funktional sein können, sondern auch Glück bringen. Erinnerungen transportieren sie auf jeden Fall. Damit lädt man sie schließlich selbst auf. So wie ich meinen Mixer von Krups mit Erinnerungen an meine Großmutter. Er hat nämlich mal ihr gehört, vor fast zwanzig Jahren hat sie ihn mir zum Auszug überlassen, sie hatte sich eh gerade einen neuen gekauft. Und so kam ich in den Besitz dieses sehr schlichten weißen Mixers mit dem roten An-Aus-Knopf, den Krups TopMix Plus, produziert wurde er von 1972 bis 1984. Eigentlich gehören auch noch zwei Knethaken dazu. Aber ich habe nur die Schneebesen übernommen. Und trotz seines Alters und seiner ungezählten Arbeitseinsätze funktioniert der Mixer nach wie vor einwandfrei, ohrenbetäubend laut knattern seine Metallbesen gegen die Wände der pinken Plastikschüssel (die ich wiederum von meiner Mutter übernommen habe), wenn ich Sahne oder Eischnee schlage. Ich mache das nicht so oft, aber wenn, dann katapultiert mich dieses Geräusch sofort in die kleine Küche meiner Großmutter mit der strahlend blauen Arbeitsplatte und den holländischen Fliesen an der Wand. Und ich sitze wieder auf der gemütlichen Holzbank, schaue ihr beim Backen zu und darf später erst den Teig von den Rührbesen und dann aus der Schüssel lecken.
Meine Oma ist tot, aber meine Erinnerungen an sie sind sehr lebendig, außerdem gibt es ihre Küche und viele ihrer Dinge noch, da bisher noch niemand Neues eingezogen ist. Wenn ich bei meinen Eltern bin, gehe ich jedes Mal rüber (die zwei Häuser sind durch einen Flur verbunden), streife durch die Räume, öffne ihre Schränke, berühre die Dinge, die sie dort hinterlassen hat. Manchmal nehme ich auch etwas mit nach Hause, zum Beispiel die kleinen Eierbecher aus Aluminium, in denen sie sonntags immer die weichgekochten Eier servierte. Die stehen jetzt bei mir im Küchenschrank und jedes Mal, wenn ich die Türen öffne und sie sehe, huscht ein Lächeln über mein Gesicht. Auch wenn meine Oma längst woanders ist, ist sie in Gestalt der Dinge, die sie einst umgaben, stets mittendrin in meinem Leben. Mareike Nieberding
Folge 58: Die Brille
Langzeitbeziehungen entwickeln sich nicht nur in eine Richtung, es wird nicht alles besser. Gerade denke ich übers Schlussmachen nach: mit meiner Brille. Ich liebe sie, zwangsläufig. Ohne sie wäre meine Welt unklarer. Aber es ist nicht immer einfach zwischen uns.
Seit der Grundschule sind die Brille und ich ein Paar. Sie rettete mich vor den ewig quälenden Kopfschmerzen, ich beschützte sie vor der Bedeutungslosigkeit: Alle paar Jahre kamen die Kopfschmerzen zurück und fortan wusste ich, dass eine neue Stärke fällig war. Sämtliche Brillen, die mir je auf der Nase saßen, bewahre ich in einem Karton auf, nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich sie doch noch mal brauche.
Leider gehöre ich zu den seltenen Exemplaren der Sehkranken, denen nicht etwa ein rettendes Gestell von der Stange zugeworfen werden kann. Nein. Mein Gesicht ist nicht bloß schmal, mein Augenabstand ist nach einhelliger Expertenmeinung überaus klein. Beim Besuch in größeren wie kleineren Geschäften sehe ich Optikerinnen augenfällig und händeringend um eine Fassung bemüht. Ich schiebe den notwendigen Brillenkauf also gerne auf.
Den Blickwinkel verändern lohnt immer. Wieso nicht den Wind im Gesicht spüren und die Welt entrückt betrachten: etwas unscharf zwar, in Punkten vielleicht und dennoch ein impressionistisches Meisterwerk. Die Brille wieder zurechtgerückt, werden aus Schemen klare Formen. Kaum jemand kann die eigene Perspektive schneller verändern als eine Brillenträgerin. Tanja Selder
Folge 57: Die Fischkaraffe
»Das ist ja eine witzige Vase!«, habe ich schon öfter gehört, wenn Menschen den grünen Fisch in meiner Küche entdecken. Fast, denn das ist keine Vase – das ist eine Wasserkaraffe. Aber bei dem »witzig« kann ich zustimmen. Denn der Gluckerfisch hat schon viele Menschen zum Lachen gebracht.
Er ist aus Keramik, erinnert farblich an einen Teich am Waldrand, in dem Karpfen ihre gemächlichen Runden ziehen, und sieht aus wie ein Fisch, der die Flosse weit zurückklappt (der Griff!) und den Mund (Ausschank, tropft nicht!) weit öffnet, so als müsste gleich ein »Blubb!« daraus zu hören sein.
Ist es auch, denn im Innern ist eine Kammer, die den Fisch bei einem gewissen Füllstand gluckern lässt; beim Einschenken, aber auch, wenn das Wasser zurück in den Bauch des Fischs schwappt.
In meinem persönlichen Teich hat der Fisch sich seit seiner ersten Sichtung deutlich vermehrt. Ich habe ihn zuerst bei meiner Mutter im Regal gesehen, kurz danach bei meiner Schwester auf dem Esstisch. Unter dem Weihnachtsbaum lag dann mein eigener Gluckerfisch – und zog mit mir in meine WG. Meine Mitbewohnerin bekam regelmäßig Kicheranfälle am Esstisch (»Der gluckert mich an!«). Als ich in eine neue Stadt zog und die Karaffe mit mir, ging es hier weiter. Zwei Freundinnen haben ihn schon, von einer weiß ich, dass sie ihn auch gerne immer wieder verschenkt. Denn der Gluckerfisch ist zwar nur eine Wasserkaraffe, aber eben eine besonders witzige – die neben Wasser auch Freude schenkt. Dana Packert
Folge 56: Das Klavier
Es ist völlig verstimmt. Es ist beschämend vergilbt. Es liegt immer so viel darauf, dass ich sowieso nie darauf spielen kann. Trotzdem würde ich das Klavier nie weggeben. Dieses müde, alte Yamaha-Klavier mit dem billigen Lack, der vor Ewigkeiten mal weiß war. Wir gehören zusammen, zwei müde alte Dinger aus den 70er Jahren. Mein Vater hat es kurz nach meiner Geburt gekauft, eigentlich für sich selbst. Als ich alt genug war, um mir die Akkorde von »Our House« und »Roxanne« auf der Tastatur zusammenzusuchen, zog es um in mein Zimmer. Ich spielte als Teenager viel darauf, Klassik nach Noten eher ungern, Pop nach Gehör umso lieber. Ich hatte Klavierunterricht, aber das weiße Ding fühlte sich am wohlsten, wenn ich Stücke spielte, die ihm und mir zusammen einfielen. Ich steckte Reißnägel in die Filzhämmer, damit es härter klingt, ich holte die Reißnägel wieder raus, damit es nicht mehr so hart klingt. Das Klavier nahm es gutmütig hin. Als ich zu Hause auszog, zog es mit aus. Ich stellte Bier darauf ab, ich kippte versehentlich Kaffee darüber, Zigarettenasche landete zwischen den Tasten, es wurde bei Partys malträtiert, eines Nachts krachte eine Kleiderstange von der Wand auf die Tastatur und hinterließ böse Spuren. Das Klavier nahm es gutmütig hin. Es folgten noch mehr Umzüge, Heirat, Kinder. Das Klavier wurde immer staubiger, aber es kam mit. Heute steht es im Wohnzimmer und wird von der ganzen Familie als Ablagefläche missbraucht. Schulhefte, Rechnungen, Bücher, Handys, Malkästen, Sportbeutel, Handschuhe: Es ist ein Aushilfsregal geworden. Das Klavier nimmt es gutmütig hin. Nur selten mal räume ich es frei, klappe den Deckel auf und spiele ein paar Töne. Sie wehen verstimmt durch das ganze Haus, das Ding tut, was es kann. Ich frage leise: Psst, du bist hoffentlich nicht böse, wenn immer so viel Zeug auf dir rumliegt, oder? Das Klavier schiebt mir einen warmen E-Moll-sieben-Akkord rüber und sagt: Ist in Ordnung, Hauptsache, ich darf bei euch bleiben. Und ich sage: Klar bleibst du, für immer. Ich könnte mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen.
Max Fellmann
Folge 55: Der Spaghetti-Tester
Seit mehr als zwanzig Jahren wohnt in unserer Besteckschublade ein Spaghetti-Tester: ein leicht bauchig geformter Stab, an einer Seite spitz zulaufend, an der anderen mit einem runden Köpfchen versehen, das zum Stab hin eine Kerbe aufweist: Darin lässt sich – für die Al-dente-Probe – mühelos eine einzelne Spaghetti-Nudel aus dem Kochwasser ziehen. Das mag einem wahlweise überflüssig oder dekadent erscheinen (das Gerät kostet heute mehr als 50 Euro), aber für alle, die schon mal mit einer Gabel nach schlüpfrigen Nudeln geangelt und sich dabei sengendes Kochwasser auf die fahrigen Pfoten gespritzt haben, ist der Stab nicht weniger als eine Offenbarung. Bis vor Kurzem war ich mir sicher, wir hätten das Gerät damals auf die Empfehlung eines unbestechlichen Produkttesters hin gekauft, quasi eines frühen Influencers, der die Dinge, die er ausprobierte, auch mal verriss, wenn er sie für einem Schmarrn hielt. Ich hätte geschworen, Gerhard Meir, Münchner Friseur und Kolumnist, der für das SZ-Magazin in seiner Generalprobe »die Warenwelt durchkämmte«, habe irgendwann Anfang der 2000er-Jahre dem Spaghetti-Tester die volle Punktzahl auf seiner Genussskala gegeben. Aber als ich die Jahresbände im Büro durchgeblättert habe: Fehlanzeige. Der einzige Al-dente-Tester, den er präsentierte, war eine Plastikfigur, die man zu den Nudeln ins Wasser werfen musste, und die fand er unterirdisch. Tja. Aber wer immer damals den Stab rezensiert hat, er oder sie war jedenfalls begeistert, und ich bin es heute noch.
Dass mir die Nudelprobe wichtig ist, liegt wiederum am Münchner Westend, unserem Wohnort zum Ende der Studienzeit. Dort gab es in der Kazmairstraße eine italienische Bar, nicht besonders schick, nicht besonders groß, und falls sie je einen Namen hatte, hab ich ihn vergessen. Die deckenhohen Ikea-Regale (die billigste Sorte – wir hatten die gleichen in der Küche) waren zu einem Drittel gefüllt mit allerlei italienischen Spezereien, die kaum jemand kaufte. Den restlichen Platz nahmen Weinflaschen und Spirituosen ein – die kaufte man fleißig, wie auch Käse und Salami aus der Kühltheke. Aber vor allem nahm das halbe Viertel dort täglich seinen Caffè, der immer exzellent war, serviert von Vito, der immer schlecht gelaunt war oder zumindest so tat. Vito war ein mittelalter, wettergegerbter »Etrusker«, wie er sich selbst bezeichnete, und ein wahrer Snob, was das Essen anging. Kein einziges italienisches Restaurant in München fand Gnade vor seinem Gaumen, und auch in seiner Heimat gab es nur wenige Lokale, die er – sparsam – lobte. Sein Glück, und unseres, war daher Angela, seine Frau, die am späten Vormittag in die Bar kam und in den Kulissen die Pasta für den Mittagstisch kochte. Ab 12 Uhr drängte die Nachbarschaft herein, um einen Platz an einem der Stehtische und vielleicht auch einen Barhocker zu erwischen – und dann einen Teller von Angelas Nudeln vorgesetzt zu bekommen: in wenig Sauce, perfekt al dente gegart, köstlich. Man aß, was immer sie auftischte, und wurde nie enttäuscht. Dass wir kurz darauf aus dem Westend wegziehen mussten, brach uns das Herz – nicht nur, aber auch wegen Vitos Bar. Und als wir nach einiger Zeit wieder vorbeischauten, hatten neue Besitzer die Räume bezogen; was aus Vito und Angela geworden war, konnte uns niemand sagen.
Ich glaube nicht, dass ich je so eine fantastische Sauce hinbekommen habe wie Angela – obwohl sie immer großzügig ihre Rezepte verriet. Ich halte mich also an die Basics: kaufe Spaghetti von guter Qualität, ersäufe sie nicht in Sauce und achte darauf, dass sie al dente sind. Und wann immer ich mit meinem Stab im Kochwasser hantiere, denke ich an Vito und Angela und ihre Bar in der Kazmairstraße, und dass ich viel dafür geben würde, noch einmal dort zu essen. Daniela Ptok
Folge 54: Das Portemonnaie
Als ich sechzehn Jahre alt war, beschloss ich, dass es an der Zeit war für ein richtiges Portemonnaie. Meine neuerstandene Debitkarte sollte schließlich einen gebührenden Platz bekommen. Da auf der Karte aber noch das nötige Geld fehlte, kramte ich in der Kommode meiner Mutter und da war es: rotbraunes Leder, abgenutzt, geräumig und doch kompakt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Diese Liebe hält seit über zehn Jahren an.
Das sieht man: Durch das viele Auf- und Zuklappen löst sich langsam, aber stetig die Naht an der oberen Kante meines Portemonnaies. Die untere Kante ist aufgerissen, seitdem ich es vor vielen Jahren auf einer Bar liegen ließ und jemand sein Getränk darüber schüttete. Den Vodka Energy saugte das Leder auf, aber dass ich es von der klebrigen Bar reißen musste, hat es mir schlecht verziehen.
Klappt man das Börserl auf, kann man Rückschlüsse auf meine Persönlichkeit ziehen: Sammelpässe von meinem syrischen Friseur und meiner liebsten veganen Eisdiele stecken neben Belegen von längst versendeten Briefen (Was, wenn sie nicht ankommen?) und Fotos meiner Angehörigen. Im Münzfach sammeln sich Haargummis, vor dem Sport abgelegter Schmuck und Pfandmarken von zahlreichen Festivals und Konzerten. Hier findet sich auch noch ein Adapter von Micro-USB zu Typ-C. Ob der es jemals an den dafür angemessenen Ort schafft (das Archiv für überflüssig gewordene Technikgadgets), steht in den Sternen. Was aber klar ist: Dieses Portemonnaie wird mich begleiten, bis auch die letzte Naht gerissen ist. Sarah Aberer
Folge 53: Der Rucksack
Wenn ich meinen großen roten Rucksack aus dem Schrank hole, packt mich die Abenteuerlust. 65 Liter passen rein, und mehr Platz brauche ich nicht, um mehrere Monate zu verreisen. Oder um ein Wochenende wandern zu gehen mit Isomatte, Schlafsack und Zelt. Ich mag das ausgeklügelte Tragesystem und die vielen praktischen Fächer, aber es ist die Vorgeschichte des Rucksacks, die ihn zu etwas Besonderem macht: Er hat dem verstorbenen besten Freund meines Vaters gehört.
Als ich meine erste Reise nach Asien plante, bot mir die Witwe den Rucksack an. Den brauche sie jetzt erst mal nicht mehr, sagte sie. Dass ich ausgerechnet nach Thailand wollte, wo der beste Freund meines Vaters oft und gerne hingereist war, machte das sonst so schmerzhafte Aussortieren für uns alle zu etwas Hoffnungsvollem. Ein full circle moment, der Kreis schließt sich.
Da der beste Freund meines Vaters in etwa so groß war wie ich, passt mir sein Rucksack wie angegossen – und er ist zu meinem treuen Begleiter geworden. Ich bin damit im Sommer durch Osteuropa gereist und im Winter durch Südostasien. Ich bin damit ins Auslandssemester nach Norwegen aufgebrochen, so vollgepackt, dass ich die Schnallen fast nicht mehr schließen konnte. Ich bin damit zu Sonnenaufgängen gewandert und zum Wintercampen durch den Schnee gestapft. Ölflecken, dunkle Streifen und aufgeriebener Stoff zeugen von meinen Abenteuern der vergangenen vier Jahre, von Fahrten in klapprigen Bussen ohne Klimaanlage und mit kleinen Booten, in denen ich nass und seekrank wurde.
Die auffälligsten Gebrauchsspuren stammen von mir, und trotzdem überlege ich häufig, was wohl sein Vorbesitzer mit dem Rucksack erlebt hat. Kurz nach seinem Tod wollte ich seine Witwe nicht darauf ansprechen, aber für diesen Sommer habe ich mir vorgenommen, ihr einige dieser Fragen zu stellen: Warum hat er sich für dieses Modell entschieden? War ich vielleicht schon an Orten, an denen er auch war? Welche Reisen hatte er noch geplant – wäre der Rucksack mit ihm noch in ganz andere Ecken der Welt gekommen? Was würde er sagen, wenn er mich mit seinem – inzwischen meinem – Rucksack auf dem Rücken sehen könnte? Ich frage mich aber auch: Wie viele Geschichten stecken noch in dem Funktionsstoff des Rucksacks, die ich nie erzählt bekommen werde – aber auf jeder Reise mit mir herumtrage? Franziska Groll
Folge 52: Der Steamer
Ich war ein optisch ordentliches Kind: meine Bob-Frisur meistens gekämmt, meine Fingernägel kurz und sauber, weil mein Klavierlehrer sonst gemeckert hätte, und meine Pullis und Hosen weitgehend knitterfrei. Denn in meinem Elternhaus wurde gebügelt, was das Zeug hält, sogar Handtücher und Unterhemden bekamen eine Schnellglättung, damit sie sich akkurat falten ließen.
Als ich von daheim auszog, gehörten ein Bügeleisen mit Bügelbrett deshalb zu meiner Studentinnen-Erstausstattung, ich ging davon aus, dass man das als erwachsener Mensch eben so macht: möglichst glatt durchs Leben gehen. Aber meine neuen Freundinnen und Freunde lachten, wenn ich T-Shirts mit einer schnurgeraden Falte von der Schulter bis zum Ärmelsaum trug: »Du bügelst?? Warum nur?« Tja. Das fragte ich mich nach ein paar Monaten selbst, als ich sonntagabends am Bügelbrett stand, einen Korb Wäsche neben mir, in der Glotze irgendein schlechter Krimi. Ich schrieb einer Freundin per SMS »Pizza und Bier?«, ließ Bügeleisen, Brett und Korb stehen – und hörte in diesem Moment auf zu bügeln. Bis heute.
Außer in Ausnahmefällen natürlich, in denen es eine Bluse ohne Falten braucht, oder die Kinder ihre Bügelperlenbilder verschmelzen lassen wollen. Ich habe dadurch sehr viel Lebenszeit gewonnen. Und gleichzeitig aber ein Viertel meines Kleiderschranks verloren, weil man manche Sachen einfach nicht in seriösen Zusammenhängen anziehen kann, wenn sie aussehen wie eine vier Tage alte Brottüte.
Als ich zum wiederholten Mal mein geliebtes mintgrünes langes Kleid auszog, weil mir der Blick in den Spiegel verbot, derart knitterig aus dem Haus zu gehen, fiel mir diese Influencerin ein, die Werbung für einen Steamer gemacht hatte. Ein Gerät, das Kleidungsstücke angeblich nur mit dem Prinzip Wasserdampf glätten sollte.
Ein paar Tage später fuhr ich in den Baumarkt und kaufte so ein Wunderteil. Es gab nur eins zur Auswahl, von Tefal, und ich kann mangels Vergleiche nicht sagen, ob es besonders gut oder besonders schlecht ist. Was ich aber ohne Wenn und Aber behaupte: Dieses Gerät hat mein Leben verändert. Ich benutze es mittlerweile fast jeden Morgen, und wundere mich jedes Mal, warum mir nicht viel früher jemand gesagt hat, dass jeder Mensch einen Steamer haben sollte. Klamotte der Wahl auf einen Bügel hängen, Tank füllen, anschalten, eine Minute über den Stoff gehen – fertig.
Es hat knapp 40 Euro gekostet, um ein neuer Mensch zu werden, aber diese Verwandlung war jeden Cent wert, und im Vergleich zu sonstigen modischen Faltenbehandlungen ja auch wirklich günstig. Und wenn man bedenkt, dass noch 15 auf einmal wieder tragbare Kleidungsstücke im Preis inbegriffen waren: geradezu ein Schnäppchen. Einziges Problem: Von der faltenfreien Optik nach einer Botox-Behandlung kann man süchtig werden, heißt es, und ähnlich ist es mit den faltenfreien Klamotten. Ich fühle mich viel unwohler als früher, wenn ich verkrumpelt daherkomme. Deshalb überlege ich gerade, ob ich mir nicht auch noch einen kleinen Reisesteamer besorge. Sara Peschke
Folge 51: Die Baseballkappe
Ich trage keine Mützen. Auch diese nicht. Und Sachen, die ich nicht benutze, bewahre ich auch nicht auf. Die verhökere oder entsorge ich. Schönes Wort. Eine Sorge loswerden.
Aber diese Mütze, die ich nicht benutze, bewahre ich auf immerdar. Es ist eine beigefarbene Baseballmütze mit schwarzer Stirnkappe, vorn der Schriftzug »1. FC Köln« in etwas kitschig geschwungener, sattroter Schrift. Die Mütze vereint zwei meiner Lieben: einmal die Liebe zu dem Freund, der sie mir vor etwa 25 Jahren geschenkt hat. Er hatte sie aus dem Fundus einer Filmproduktion ergattert. Und dann die Liebe zu dem Verein, der draufsteht. Auch wenn es da natürlich komplizierter wird.
Liegt nicht an mir. Es ist der 1. FC Köln, der es einem mit dem Lieben schwermacht. Ständig dieses Verlieren. Und immer dieses »Bis hierhin war alles Mist, aber jetzt werfen wir alles um, hier der Fünfjahresplan, an dessen Ende die Weltherrschaft steht, viele Grüße, euer neuer Vorstand«, dann dieses »Verletzungspech, blöder Rasen, dunkle Mächte, dies, das«, schließlich dieses »Spätestens in zwei Jahren wollen wir wieder aufsteigen, und dann werden wir uns fest in der Spitze etablieren, hier der Fünfjahresplan«. Den 1. FC Köln müsste Christopher Nolan mal verfilmen, da gibt es dauernd exakt gleiche Wiederholungen der exakt gleichen Handlungen und andere Raum-Zeit-Scheiße.
Als ich die Mütze geschenkt bekam, waren die meisten Spieler des Vereins älter als ich es war. Jetzt sind sie jünger, genauer gesagt: Jeder von ihnen könnte mein Sohn sein. Es fühlt sich auch so an. Wie die Sorge um das eigene Kind. Der Stolz, wenn es gewonnen hat. Die als Grimm verkleidete Nachsicht, wenn es verloren hat. Die Geduld, diese nie versiegende Geduld.
Ach, heute setze ich die Mütze mal auf für einen Tag. Marc Schürmann