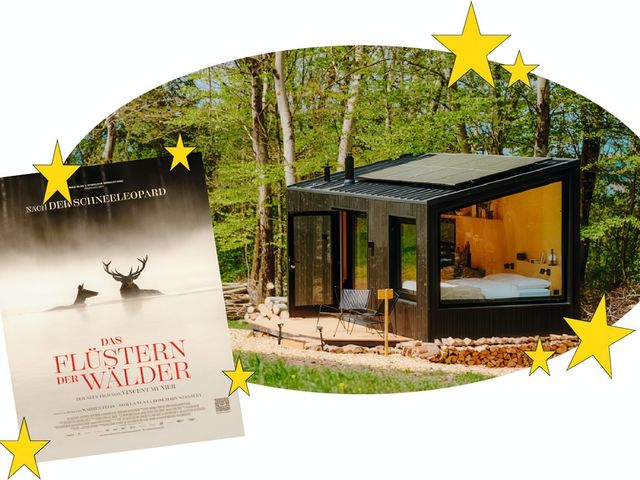Ein Freitagnachmittag im März, Berlin-Mitte, in Nachbarschaft zum Deutschen Theater. Vorderhaus, zweiter Stock. Dass Felicitas Hoppe zu Hause ist, beweist, dass nichts ist wie vor dieser Pandemie. Die Schriftstellerin, 60 Jahre alt, Büchner-Preisträgerin, ist sonst vor allem unterwegs. Für Stipendien, Lesungen, auf der Suche nach Inspiration. Jetzt betrachtet sie die Welt von ihrem Küchentisch aus: »Bitte, nehmen Sie auch Platz.«
SZ-Magazin: Sie haben sich mal als »reisende Schriftstellerin« bezeichnet. Sind Sie jetzt nur noch eine Schriftstellerin?
Felicitas Hoppe: Meine Beweglichkeit ist eingeschränkt, aber innerlich bin ich weiter auf Reisen. Ich glaube an den Bewegungsmodus des Schreibens. Für mich gibt es deshalb keine fertigen Texte. Ich muss bloß irgendwann aufhören, weil ich das Buch abgeben soll.
Ihr Debütroman Pigafetta über einen gleichnamigen Schiffskobold entstand nach einer viermonatigen Reise auf einem Frachtschiff, die Sie 1997 unternommen hatten. Seitdem gehört das Reisen zu Ihrer Arbeit, Sie machen Roadtrips und Forschungsreisen.
Ich bin aber keine gezielt vor Ort recherchierende Schriftstellerin. Ich bin auf diese Kiste hier vor mir, meinen Laptop, angewiesen. Ohne Wikipedia, die Reisen ins Netz, kann ich nicht arbeiten. Trotzdem: Bei jedem meiner Bücher kam es kurz vor Schluss zu einer Stockung. Dann wusste ich: Du musst raus! Meistens bin ich dann an einen Ort gefahren, an dem das Buch spielt. Und da schrieb ich es fertig. Oder kurz danach. Für meinen Jeanne-d’Arc-Roman bin ich mit dem Nachtzug nach Rouen, wo sie verbrannt wurde. Auf der Rückfahrt wusste ich, wie das Buch zu Ende gehen muss. Bei meiner Autobiografie bin ich nach Hause, zu meinen Eltern ins Weserbergland, und dort fertig geworden. Dieses Jahr habe ich ein neues Buch geschrieben, über die Nibelungen, und konnte die ganze Zeit nicht an die Donau fahren. Ja, und jetzt bin ich trotzdem fertig damit.

Felicitas Hoppe wurde als drittes von fünf Kindern in Hameln geboren. Sie studierte in Hildesheim, Tübingen, Eugene (Oregon) und Rom und lebt seit 1996 in Berlin. Für ihre Romane, Erzählungen sowie Kinder- und Jugendbücher, für die sie sich gern auf die Spuren von Abenteurern und Hochstaplern begibt, wurde »Deutschlands fantastischste Fabuliererin« (Die Welt) vielfach ausgezeichnet, 2020 mit dem erstmals vergebenen »Großen Preis des Deutschen Literaturfonds«. Zuletzt erschien von ihr im Verlag S. Fischer der Roman Prawda. Eine amerikanische Reise. Ihr neues Buch Die Nibelungen – Ein deutscher Stummfilm erscheint dort im September.
Foto: Anita Affentranger
Wird man dem Buch anmerken, dass Sie zu Hause saßen?
Ich denke nicht. Ich schreibe ja keine besonders realistischen Sachen. Es ist mehr mein persönliches Problem: Durch Corona habe ich gemerkt, dass das Rauskommen bisher für mich das A und O beim Schreiben war. Ich muss diesen eigenartigen Text gewissermaßen aus dem Fenster halten. Vergangene Woche habe ich den letzten Satz des neuen Buches geschrieben. Aber es hat sich kein Enthusiasmus eingestellt. Ich glaube, weil dieser Kick des Wegseins gefehlt hat.
Haben Sie diesen letzten Satz hier in der Küche geschrieben?
Jetzt haben Sie mich erwischt. Ich bin doch ein bisschen weggefahren. Ich kann zwar derzeit nicht in meine kleine Einsiedelei in den Schweizer Bergen, habe aber eine S-Bahn-Stunde von Berlin einen Ersatz gefunden. In Grünau an der Dahme teile ich mir mit zwei Kollegen eine Bürowohnung. Und wenn ich da sitze, sehe ich Schiffe vorbeifahren. Als der Fährmann in den Nibelungen geköpft werden soll, habe ich eine kleine Fähre über den Fluss genommen. Das hat geholfen. Na ja, das sind so die Hoppe-Mythologien.
Gibt es einen besten Hoppe-Schreibort?
Im Prinzip kann ich überall schreiben. Solange ich allein bin. Ich kann nicht schreiben, wenn jemand anderes da ist. Ich muss für mich und abgeschlossen sein. Ich würde mich nie in den Garten setzen. Mein Prinzip ist »Dach und Tisch und allein«.
Wie viel Zeit haben Sie vor Corona in Berlin verbracht?
In vielen Jahren höchstens die Hälfte. Ich hatte lange Phasen in meinem Häuschen in der Schweiz, und dann kamen viele Lesereisen dazu, Geschäftsreisen sozusagen. So war ich ständig unterwegs.
Und was haben Sie durch den Stillstand über sich verstanden?
Zuerst fand ich die Pause toll. Nicht das Virus. Aber nach 25 Jahren Dauerreisen spürte ich eine gewisse Ermüdung. Was soll das, fragte ich mich. Setz dich doch mal hin. Es gibt so hässliche Ausdrücke dafür: Jemand habe Hummeln im Hintern. Ich sah mich nie als rastloser Mensch. Ich finde das Reisen sogar eher anstrengend. Ich dachte also: Ruhe schadet mir nicht.
Aber?
Womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass die Tatsache, dass plötzlich alle drin saßen, mich regelrecht lähmte. Das Schreiben funktioniert bei mir nur, wenn die Energiepole stimmen. Also draußen in der Welt ist was los – und deshalb habe ich einen Grund, mich von der Betriebsamkeit abzuschotten. Um dann wieder zu sagen: Ich gehe jetzt raus, lade mich mit Energie auf, und die setze ich dann drinnen um. Das ist eigentlich etwas Physikalisches. Und dieses Spannungsverhältnis war mit Corona weg. Mein ganzes Konzept des Rückzugs ist obsolet geworden. Ich habe in den ersten Monaten der Pandemie, obwohl ich unter großem Zeitdruck stand, überhaupt nicht mehr geschrieben. Mein neues Buch hätte viel früher fertig werden sollen. Aber ich habe den Griffel förmlich aus der Hand gelegt. Es kam mir so sinnlos vor.
»Alle kämpfen, von der Welt zu erzählen, die nur noch vor den Computerkameras stattfindet«
Wie sind Sie da wieder rausgekommen?
Ich weiß nicht genau. Durch dieses Refugium vor den Stadttoren. Und durch Selbstdisziplin. So ganz gelüftet ist dieser Schleier aber noch nicht. Ich sehe das auch bei Kollegen: Alle kämpfen, von der Welt zu erzählen, die nur noch vor den Computerkameras stattfindet. Über allem liegt so ein Mehltau. Die Lesungen und Festivals fallen aus. Schrecklich.
An welchem Ort der Welt wären Sie jetzt gerne?
Normalerweise hätte ich jetzt in den USA an der Universität unterrichtet. Und ich wäre gerne in der Schweiz, in meiner Einsiedelei, in Leuk im Rhonetal. Nächste Woche fahre ich erstmals seit Corona wieder hin, mit aller Vorsicht. Ich hatte dort 2004 ein Stipendium, fünf Jahre Wohnrecht in einem kleinen Häuschen hinter der Kapelle. Nach mir zog wieder ein Mönch ein, aber der verschwand 2014, und da habe ich es dauerhaft gemietet. Es ist nicht teuer. Aber für mich doch viel Geld. Nun muss ich sehen, ob ich es weiter behalte, obwohl das Reisen sicher weiter schwierig bleiben wird. Das werde ich vor Ort entscheiden. Ich freue mich auf die Reise, aber ich merke, wie sich eine Beunruhigung breitmacht, weil ich es nicht mehr gewohnt bin. Reisen hat viel mit Übung und mit Routinen zu tun. Ich packe schon lange den Koffer nicht mehr abends vor der Reise, sondern morgens, bevor es losgeht, mit ein paar Handgriffen. Aber gestern lag ich im Bett und überlegte plötzlich: Nimmst du in die Schweiz den Koffer oder den Rucksack?
Was gefällt Ihnen so in Leuk?
Der Ort hat mich gefunden, nicht ich ihn. Ich bin eine fremdbestimmte Reisende, ich suche mir meine Ziele nicht, sondern warte, was kommt. So war es auch mit dem Stipendium in diesem Dorf. Es ist wunderschön, aber ich bin kein Bergtyp. Ich würde das Meer immer vorziehen. Ich gehe in Leuk nie wandern oder so. Touristisch gereist bin ich nie in all den Jahren. Ich bin da zum Schreiben. Mein Problem ist aber, dass ich in Leuk mittlerweile mehr Freunde habe als hier, ein sehr intensives Sozialleben. Ich habe da auch Internet und Telefon. Und trotzdem ist diese Hütte ein magischer Ort für mich. Deswegen bin ich nervös, nach der langen Pause wieder hinzukommen. Wird es noch meine Einsiedelei sein? Orte müssen gepflegt werden. Unbewohnte Orte gehen zugrunde. Wie Menschen, die keine Kontakte haben.
Das gilt ja auch für Kulturorte wie das Deutsche Theater nebenan.
Ja, das ist nur noch Fassade, wie ein Potemkinsches Dorf. Gestern stand ich am Gendarmenmarkt. Das Konzerthaus ist schick angeleuchtet. Mich befiel so ein eigenartiges melancholisches Gefühl. Was war das vorher für ein Ort? War der wirklich so viel lebendiger? Oder auch nur Fassade? Das ist das Fiese oder auch das Gute an Corona: dass wir Dinge, die uns selbstverständlich waren, in Frage stellen. Wir können, wenn das Schlimmste überstanden ist, nicht einfach zum Status quo zurückkehren. Sondern müssen fragen: Was ist wirklich unverzichtbar?
Werden Sie je wieder so reisen wie vor der Pandemie?
Das Merkwürdige ist, wenn wir hier ohne Pandemie säßen, würde ich wahrscheinlich auch sagen: Ich bin aus dem Reisealter raus. Ich habe die ganze Welt gesehen. Bin auf dem Containerschiff einmal rumgefahren. Ich weiß, dass sie rund ist, und jetzt ist gut. Corona hat mich an einem Punkt erwischt, an dem ich sowieso das Gefühl hatte, ich müsste zurückschrauben. Nicht wegen meines ökologischen Fußabdrucks, ich bin bei Weitem nicht so viel geflogen wie andere. Sondern weil ich zweifelte: Wie wichtig ist diese Bewegung für mich, wie exzessiv habe ich das betrieben, und ist dieses Leben nicht zu haltlos auf Dauer? Es gab Tage, da war der Berliner Hauptbahnhof mein zweiter Wohnsitz.
Wenn Sie keine rastlose Person sind: Wie kam es so weit?
Das ist ein Fall für den Psychologen. Ich war ein Stubenhockerkind. Meine Mutter hat mich wirklich in den Sandkasten tragen müssen. Ich wollte ihr lieber beim Staubsaugen zugucken. Ich habe den Kindergarten gehasst. Und die Schule auch. Ich wollte bloß nach Hause, in den geschlossenen Raum. Und daraus wurde mein Schreibraum. Dann hat sich aber im Laufe der Zeit eine Gegenkraft bemerkbar gemacht, weil mir klar wurde: Mit mir stimmt was nicht. Ich habe die Reißleine gezogen. Weil ich ahnte: Wenn du jetzt den Arsch nicht hochkriegst, bleibst du für immer in deinem Schriftstellergehäuse sitzen, und dann nimmt es kein gutes Ende mit dir. Ich musste mich mit der Welt konfrontieren. Das war während des Studiums. Meine Freunde fuhren am Wochenende irgendwohin, und ich saß da und schrieb. Eine innere Stimme rief: Raus hier! So bewarb ich mich für ein Austauschprogramm nach Amerika. Damit fing das Reisen an.
In der kurzen Erzählung Fieber 17 haben Sie gerade Ihre erste Reise als Kind verarbeitet.
Ich erzähle da, was ich lange nicht erzählen wollte, weil ich es zu privat fand. Ich war fünf und wurde zwangsverschickt, auf die Insel Langeoog, zu einer sogenannten Kinderkur. Du wirst verschickt, hieß es. Und so stellte ich mir das auch vor: dass ich in einem Paket zur Post gebracht werde. Ich fragte meine Mutter: Wie kriege ich dann Luft? Es war meine erste Bahnfahrt. Ich habe so geweint, als die unbekannten »Tanten« mich in diesen Zug zogen. Ich wurde erstmals aus meiner Blase gerissen. Die Postkarten nach Hause wurden uns diktiert: Lieber Vater, liebe Mutter, mir geht es gut. Als ich wieder zu Hause war, hatte ich das Gefühl, gewachsen zu sein, aber die fünf Wochen waren ein absoluter Horrortrip. Sowieso ist es ja eine Besonderheit der westlichen Hemisphäre, dass Reisen für uns schon so lange sehr positiv konnotiert sind. Die erste Reise meines Vaters ging als Soldat in den Krieg.
Reiste Ihr Vater später gern?
Er nahm uns zu Verwandten mit, oder wir machten Wanderausflüge. Aber verreist sind wir nie. Wir hatten kein Geld dafür. Ich habe die Sommerferien gehasst. Alle packten ihre Autos voll und verschwanden. Wir hatten nicht mal ein Auto. Ich blieb zurück. Aber vielleicht war das ein gutes Training: Ich war gezwungen, dem Gefühl des Ausgeschlossenseins etwas entgegenzusetzen. Mit sieben fing ich an zu schreiben.
Angesichts dieses Kindheitserlebnisses, wie ein Paket verschickt zu werden, ist es überraschend, dass Sie sich später freiwillig der Route eines Containerschiffs auslieferten.
Ja, irre eigentlich. Ich habe mal einen Text geschrieben, der hieß: Fracht sein ist alles. Das ist natürlich ambivalent, weil wir wissen, wie grausam es ist, wenn Menschen gezwungenermaßen in Zügen transportiert werden oder sich heute in Lastwagen verstecken. Und trotzdem ist für mich das Erstrebenswerte am Reisen eben vor allem, mich der Bewegung zu überlassen, bis ich sozusagen einen Zustand der Bewusstlosigkeit erreiche. Das genieße ich. Verantwortung abzugeben. Mich aus dem Vertrauten wegzubewegen, aber mich zugleich anderen anzuvertrauen. Ich liebe es, hinten im Auto zu schlafen. Die beste Lebenszeit habe ich verpasst, als ich Säugling war und umhergeschoben wurde.
»Meine Fantasie ist ja im wahrsten Sinne des Wortes uferlos«
Reisen macht Sie also glücklich, aber Sie müssen sich immer wieder dazu überwinden?
Und das ist die Analogie zum Schreiben. Auch dazu muss ich mich überwinden. Wenn es mal losgeht, kann ich nicht mehr zurück, dann passiert etwas mit mir. Vor dieser Containerschiffreise damals hatte ich unglaubliche Angst. Aber ich konnte sie nicht mehr absagen. Ein Journalist hatte mich gefragt, was ich mit den 15 000 D-Mark Preisgeld machen würde, die ich gerade bekommen hatte, und ich antwortete aus Jux: eine Weltreise. Ich bekam dann dieses merkwürdige Angebot und sagte sofort zu. Aber nicht aus Abenteuerlust. Sondern weil ich wusste, dass ich physisch vorankommen muss, um auch mit meinem Schreiben voranzukommen. Meine Fantasie ist ja im wahrsten Sinne des Wortes uferlos. Aber es wäre zu bequem, mich nur darauf auszuruhen.
Beim Reisen liefern Sie sich gern aus, aber beim Schreiben haben Sie die Kontrolle, oder?
Ja, also, anders als die Orte finden mich die Texte nicht von alleine. Aber selbst wenn ich beim Schreiben immer ein Ziel habe, heißt das nicht, dass ich auch da ankomme. Ich weiß nie, wie die Sache ausgeht.
Haben Sie heute noch Heimweh?
Nein, überhaupt nicht mehr. Das ist interessant. Aber ich kann mich gut an dieses entsetzliche Heimweh vor 55 Jahren erinnern. Weil ich diese Geschichte auch wirklich erpresserisch eingesetzt habe gegen meine Eltern und ihnen immer wieder ein schlechtes Gewissen gemacht habe. Ich konnte sie damit zum Weinen bringen. Wenn ich heute unterwegs bin, habe ich kein Heimweh. Selbst auf dem Containerschiff nicht. Da gab es Momente der Einsamkeit. Aber ich kann gut alleine sein. Und ich habe mir die ganze Zeit ausgemalt, wie toll es sein würde, nach vier Monaten von dieser Erfahrung zu erzählen. Reisen hat ja auch was Angeberisches. Ich habe viele Reisen als Bewährungsprobe aufgefasst: Ich wollte nie nach Indien. Das war dann meine Feuertaufe. Die Leute wollten mir den immer noch schlimmeren Slum zeigen. Auch da hilft dann das Schreiben: Wenn ich nicht klarkam, habe ich geschrieben.
Ist das Schreiben Ihre Heimat geworden?
Ich denke schon. Ich habe damit ein Instrument zur Verfügung, das nicht viele haben: nämlich aus schlechten Erfahrungen etwas Gutes rauszuholen. Dieser Raum der Weltveränderung, der Umwandlung ist meine Heimat, da haben Sie recht. Ich habe meine Mutter immer bewundert, weil sie die größte Umwandlerin der Welt ist, auf eine viel praktischere Art als ich. Sie hat für alles eine Lösung gefunden. Und sie hat sich nie für ihre Fehler entschuldigt. Sie hat uns mal vergorene Sahne geschlagen, die flockte. Als ich sagte, du, Mutti, was ist mit der Sahne, hat sie geantwortet: Das ist Spätsahne! Das habe ich nie vergessen. Wenn ich irgendwo auf der Welt merkwürdiges Zeug aus diplomatischen Gründen im Halbdunkeln essen musste, dachte ich: Das wird schon Spätsahne sein. Dieser Versuch, die Welt nach eigenem Wunsch zu formen, hat mich zur Künstlerin gemacht.
Wie weit ist Ihre Mutter gereist?
Meine Eltern sind bis heute in der Kirchengemeinde aktiv, und durch verschiedene Austauschprogramme sind sie später im Leben sehr weit gereist, bis nach Brasilien. Meine Mutter liebt Fernreisen und hatte immer darunter gelitten, dass wir als Familie nicht wegkamen. Deswegen hat sie mich bei meinen Unternehmungen auch nie gebremst. Und mein Vater hat sich eine Weltkarte besorgt, als ich auf dem Schiff unterwegs war. Da hat er alle Stationen meiner Reise mit einer Stecknadel markiert und sie mit einem Faden verbunden. Nach den vier Monaten präsentierte er mir das Kunstwerk und sagte: Wenn man ein Kind hat, das so rumkommt, muss man das selber nicht tun.
Reisen ist natürlich ein Privileg.
Absolut, und das Reisen, von dem wir reden, läuft ja in der Regel wie am Schnürchen, abgesehen von den beklagten Verspätungen der Bahn oder so. Von mühsamem Reisen kann nicht die Rede sein, selbst wenn mein Lebensstil oft mühsam ist. Aber den habe ich selbst gewählt. Mein ganzes Leben kommt mir sehr privilegiert vor. Es liegt selbst in dieser Überforderung durch das ständige Unterwegssein eine Lust. Und über dieses Privileg noch lauter nachzudenken, ist durchaus eine Nebenwirkung von Corona. Was nützt mir das Gondeln durch die Welt, wenn ich immer nur bestimmte Milieus treffe? Welche Ausschnitte sehe ich überhaupt? Da kann ich vielleicht auch innerhalb dieser Stadt auf Reisen gehen und Dinge entdecken, die ich in tausend Kilometern Entfernung nicht entdecke. Ich laufe bei meinen Pandemiespaziergängen durch Berlin und denke: Mensch, hier gibt es viele Gegensätze, die ich nie genauer betrachtet habe, obwohl ich schon an allen Ecken der Stadt gewohnt habe. Ich habe auf Lesungen regelmäßig den Vorwurf gehört: Du bewegst dich als Made im Speck des Kulturbetriebs über alle Kontinente.
Und was entgegnen Sie?
Es stimmt ja. Und doch versuche ich, auf meiner Freiheit zu beharren. Meine Art zu leben ist ja auch mit einigen Risiken verbunden. Ich habe keine Rücklagen, keinen doppelten Boden. Wenn ich krank werde, etwa eine Chemotherapie benötige, dann kann ich den Laden dichtmachen. Ich bin gut durch die Pandemie gekommen, weil ich relativ gut wirtschaften kann und nicht nur von der Hand in den Mund lebe. Aber wenn das so weitergeht, weiß ich auch nicht. Ich formuliere es mal positiv zu meinen Gunsten: Ich glaube, es ist schon wichtig, dass es Leute wie mich gibt, die gewisse Dinge vielleicht stellvertretend auch für andere tun und sehen. Der Nutzen durch mich ist vielleicht nicht messbar. Aber ich merke, dass sich bei Leuten etwas öffnet, wenn ich von meinen Reisen berichte.
»Ich habe gelernt, dass die Kunst kleiner ist als die Welt. Aber das macht sie nicht uninteressanter«
Was haben Sie durch das Reisen gelernt?
Dass die Welt nicht so ist, wie ich sie mir vorgestellt habe. Dass sie mit meiner Fantasie nicht zur Deckung kommt, sondern diese Fantasie noch übertrifft. Ich habe gelernt, dass die Kunst kleiner ist als die Welt. Aber das macht sie nicht uninteressanter. Auf der Schiffsreise habe ich die drei Phasen meines Reisens und Schreibens gefunden: Zuerst stelle ich mir die Reise vor. Dann, zweite Phase, mache ich die Reise und hadere zuerst damit. Auf der Schiffsreise dachte ich die erste Woche: Nur Wasser, wie blöd konntest du sein? Und zuletzt kommt die dritte Phase: Ich schreibe über die Reise und gleiche sie mit meiner Vorstellung davon ab. Und genau da entsteht diese faszinierende Schnittmenge, die nur eine Stubenhockerin auf Weltreise finden kann.
Aber dann können Sie doch eigentlich nicht aufhören zu reisen?
Seit einem Jahr fragen mich die Leute: Wie geht es dir in der Pandemie? Und ich sage: Na ja, schwierige Zeiten, ich entwickle gerade alternative Geschäftsmodelle. Aber das ist gelogen. Da ist kein alternatives Geschäftsmodell. Die zunehmende Verzwergung der Welt und die neue Scheu vor menschlichen Begegnungen, so nötig das gerade ist, machen mir große Angst. Es spricht viel gegen das Reisen, global und in meinem Leben. Und doch wäre unsere Welt ohne das Reisen eine schrecklich engstirnige. Allein die Möglichkeit zu reisen ist doch wichtig. Als die Mauer fiel und die Menschen aus dem Osten in die Welt strömten, dachte ich: So viel bin ich bisher nicht rumgekommen. Aber ich hatte eben die Möglichkeit gehabt und war allein dadurch frei gewesen.
Haben Sie Angst vor der Zukunft?
Eigentlich nicht. Aber ich habe kürzlich ein altes Interview mit mir gelesen, in dem ich schon vor Jahren etwas großkotzig behauptet habe: Bald bricht bei uns alles zusammen. Das war lange schon mein Gefühl. Es herrscht auf unserer Seite der Welt ein wahnsinniger Überfluss. Wir sind satt. Zugleich sind unzählige Menschen in existenzieller Not. Das kann nicht gutgehen. Und das Schlimmste ist, wie wenig mir dazu einfällt. Dass ich hoffe, es geht gut und bleibt, wie es ist, obwohl ich sehe, wie viel sich ändern müsste. Wie wenig Konsequenzen ich daraus ziehe.
Werden Sie Ihren Weltfluchtsort in der Schweiz nun eher behalten oder nicht?
Meine Freunde sagen: Das kannst du nicht aufgeben! Aber vielleicht ist diese Ära vorbei. Im Sommer vor zwei Jahren durfte ich in Leuk auf dem Marktplatz eine Rede zum Schweizer Nationalfeiertag halten. Das ist eine Ehre. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Und davon geredet, wie schwer es ist, Gast zu sein. Das hat mich das Reisen gelehrt: Der Gast macht es eigentlich immer falsch. Sagt er zu Gutes, ist er ein Heuchler. Kritisiert er zu viel, hat er die Gegend nicht verstanden. Man muss auf Reisen unglaublich beweglich bleiben und sich in andere hineinfühlen, und das habe ich ziemlich perfektioniert. Aber man muss aufpassen: Es gibt im Reisen auch einen Punkt der Selbstverleugnung. Und ich denke manchmal, ich möchte kein Gast mehr sein, sondern endlich die Gastgeberin.