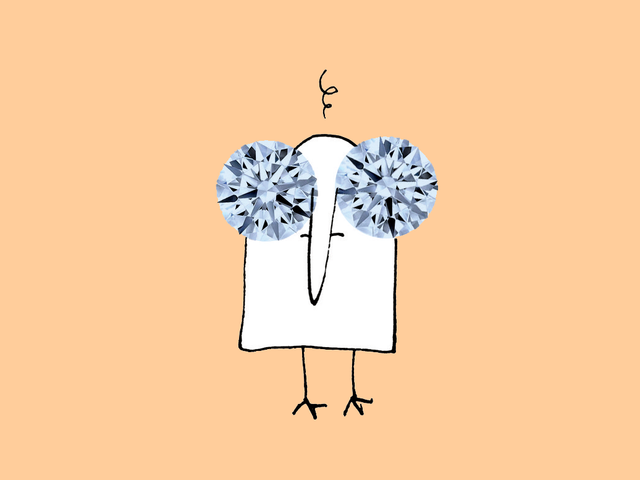Er konnte es kaum erwarten, endlich Einlass zu erhalten. Von außen sah das Schloss aus wie aus Schaum gebaut, ein Märchenpalast aus Erkern und Türmen, vor dem ein von vier Rössern gezogener Streitwagen aus Stein einen Springbrunnen bewachte. Er bekam einen Wink, er durfte eintreten.
Kaum im Inneren, gewann Andrea Di Martino das Gefühl, etwas greife seinen Blick, ein Sog, schon hatte das Gebäude ihn geschluckt. Der Fotograf sah Lüster an den Wänden, goldgetränkte Säle und glänzende Marmorböden, Fresken voll nackter Nymphen und ein mit künstlichen Felsen verkleidetes Kellergelass, in dem um das Rund eines Tisches aus schwerem Holz – wie für die Ritter der Tafelrunde – zehn Sessel standen, die aus Weinfässern geschnitten waren.
Di Martino fragte sich: »Wo bin ich hier?« Die naheliegende Antwort lautete: in einem lächerlichen Wolkenkuckucksheim im Umland der Hafenstadt Penglai, Provinz Shandong, Volksrepublik China. Aber naheliegenden Antworten hatte Andrea Di Martino gelernt zu misstrauen.
Der italienische Fotograf hatte sich lange an Motiven abgearbeitet, die auch die meisten seiner Kollegen ablichteten – Menschen. Bei Tag. Bei Nacht. Auf Arbeit. Am Leben. Eines Tages mochte er nicht mehr. Menschen, immer Menschen. Er fand, der Mensch fotografiere Menschen schon genug. So stieß er auf Gebäude.
Sie fesselten ihn, Strukturen aus Beton oder Stein, in denen Ideen sichtbar wurden, Träume, Wünsche. Er, der Katholik aus Italien, fing mit Kirchen an. Aber nicht – das schien ihm zu naheliegend – mit aktiven. Er wählte die aufgelassenen, die entweihten Kirchen, die nicht mehr dem Gebet, sondern anderen Zwecken dienten, als Autowerkstatt, als Bar, als Pizzeria, als Bank. Es waren strenge, auf die Stelle des einstigen Altars ausgerichtete Fotografien. Er mochte das, Geschichten erzählen, die aus Räumen sprechen. Dann hörte Di Martino von China.
Dort, in Asien, fotografierte er die Grachten Amsterdams, die Pubs von London, den Eiffelturm, die Champs-Élysées – einmal ganz Europa, nur nahe Shanghai. Es waren Kulissen in Neubausiedlungen für Chinas Mittelschicht, die berühmten Ecken Europas nachempfunden waren, bis ins Detail. Auf der Suche nach anderen Motiven stieß er auf die Schlösser, die große Weingüter gerade aus dem Boden stampften.
Wein war China lange fremd. Das Land trinkt Schnaps, aus Reis oder Hirse gebrannt, genannt »Baijiu«, der weiße Alkohol. Wein nennen Chinesen den roten Alkohol, und wenn sie ihn früher überhaupt tranken, dann mit Cola (bei Weißwein) oder Limo (bei Rotwein) gestreckt. Als die ersten Importeure Mitte der Neunzigerjahre in einem Pekinger Restaurant probehalber eine Weinflasche bestellten, erlebten sie entgeistert, wie ein Schwarm Kellner damit kämpfte, die Flasche mit einem Dosenöffner zu entkorken. Doch der wirtschaftliche Boom machte Wein zu einem begehrten Gut, das für Erfolg und Glück steht. Weingüter entstanden, Kellereien, eigene Weinbaugebiete wie in Ningxia, an den Ufern des Gelben Flusses. Sinnbild dieses Aufschwungs wurden die Schlösser, die Weingüter sich bauten – fantastische Paläste, in denen sich verschiedene Baustile kreuzten, der Name aber meistens gleich war: Château, wie die Schlösser der Weingüter um Bordeaux.
Diese Bauten schlugen Di Martino schnell in den Bann. Eines der ersten Schlösser, das der Fotograf aufsuchte, stand nahe der Hafenstadt Penglai, hinter dem Springbrunnen mit Streitwagen. Gefangen im Sog der goldenen Säle, erreichte er das Herz des Gebäudes – einen bonbonbunten Ballsaal, in dem purpurne Sessel prächtige Tafeln säumten, umstellt von Säulen, an denen sich Reben aus Stein emporrankten. »Die erste Reaktion ist: Das ist lächerlich, einfach lächerlich«, sagt Di Martino. »Aber die zweite Reaktion ist: Moment – sich darüber lustig zu machen, ist zu einfach.«
Di Martino fotografierte so viele Schlösser wie möglich. Es dauerte nicht lange, und seine Wahrnehmung wandelte sich: Wunderkammern in Pfauengrün, Triumphbögen mit Leuchtschrift, waschmittelpropagandaweiße Spucknäpfe, nichts überraschte ihn mehr. Die Architektur erinnerte ihn an einen Ausdruck, dem auch Umberto Eco einen Essayband gewidmet hat: Chinas Châteaux waren hyperreal – so überhöhte und idealisierte Abbilder, dass sie wirklicher als die Wirklichkeit wirkten.
Auf ihre Art verdient diese Architektur Respekt, urteilt Di Martino: Sie ist nicht einfach unbedachter Bombast, im Gegenteil – da spielt jemand Symbole aus, im vollen Wissen, wie ikonisch sie sind. Nur aus Di Martinos, aus europäischer Sicht ist es ein lächerliches Kuddelmuddel. Die chinesischen Architekten der Schlösser dagegen, mit denen Di Martino sprach, meinen: Wenn etwas so schön ist, dass andere diese Schönheit kopieren – warum sollen die Kopien dann auf einmal nicht mehr schön sein?
Fotos: Andrea Di Martino