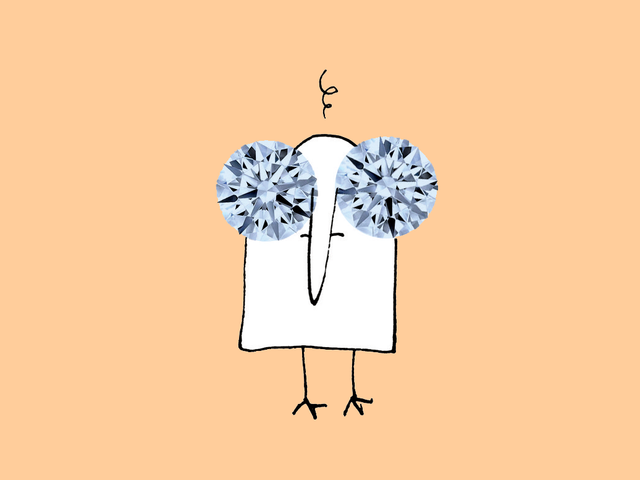Das Gespräch wurde 2019 geführt.
SZ-Magazin: Sie wurden vom britischen Fachmagazin Restaurant als »Beste Köchin der Welt 2017« ausgezeichnet, haben aber keinen einzigen Stern. Und das nur, weil es den Restaurantführer Guide Michelin nicht für Slowenien gibt. Wie sehr regt Sie das auf?
Ana Roš: Früher oder später werden die Michelin-Tester kommen. Ich weiß aber nicht, ob ich überhaupt Sterne haben will. Sie setzen einen Standard, und dann kämpft man sein Leben lang, um reinzupassen. Ich möchte lieber ich bleiben.
Wer sind Sie denn?
Wir sind ein besonderer Ort auf dem Land, das »Hiša Franko« ist unser Zuhause. Wenn man durch die Restauranttür kommt, sieht man unsere Familienfotos. Im Vorzimmer essen mein Mann, meine Kinder und ich täglich zu Abend. Im zweiten Stock leben wir. Draußen jagt die Katze nach Mäusen, auf dem Stuhl neben mir schläft der Hund, ständig muss ich meine Angestellten bitten, seine Haare wegzuputzen.
Heute servieren Sie unter anderem Wildbirne, gefüllt mit Scampi, Liebstöckelöl und Haselnüssen. Das klingt nicht gerade nach traditioneller slowenischer Landküche.
Mein Essen ist eine Symbiose aus der Umgebung, der Jahreszeit und meiner Persönlichkeit: Ich bin neugierig und voller Widersprüche. Deshalb arbeite ich mit Kontrasten, vor allem süß und pikant, und verwende viele Früchte. So entsteht etwas Neues, Unerwartetes. Gleichzeitig folge ich der Natur, die das Soča-Tal zu bieten hat: Die Marmorierte Forelle, für die unsere Flüsse berühmt sind, Wild, Waldfrüchte, Gemüse und Kräuter aus dem Garten hinter dem Haus.

Der Weg zum »Hiša Franko« führt 40 Minuten lang über holprige Straßen, immer den türkisfarbenen Fluss Soča entlang – und mitten durch den slowenischen Teil der Julischen Alpen.
Vor einer halben Stunde kam ein junger Mann in Fleecejacke ins Restaurant und entschuldigte sich bei Ihnen für die schlechte Ausbeute.
Das ist Miha, unser Sammler. Er zieht für uns durch den Wald und kommt mit Kräutern und Gemüse zurück. Wenn er mir sagt, die Herbsttrompeten seien in einer Woche fertig, kreiere ich Gerichte um diese Zutat herum. Vor ein paar Tagen hat sich der Mond verändert, und alle Pilze waren verschwunden. Innerhalb von 24 Stunden musste ich das Menü umstellen. Ich liebe es, wenn uns die Natur überrascht. Mit Druck und Adrenalin im Blut kann ich am besten kreativ arbeiten.
In Ihrer Jugend sah es so aus, als würden Sie als Sportlerin Karriere machen. Sie fuhren in den Achtzigern in der jugoslawischen Nationalmannschaft Ski. Und dann?
Mit 17 wachte ich eines Morgens auf und dachte: Skifahren ist doch nichts für mich. Ich konnte einfach keine Motivation finden, und Motivation ist der Schlüssel zu allem. Ich wollte stattdessen Tänzerin werden, beim Improvisieren konnte ich kreativ sein. Meine Lehrerin sagte mir eine Zukunft in Paris voraus. Dann verletzte ich mich und konnte ein halbes Jahr nicht laufen. Ich war gerade erst 18 und musste mein Leben schon wieder neu definieren.

Das »Hiša Franko« kam 2018 in der Liste »The World’s 50 Best Restaurants« auf den 48. Platz. In den oberen Stockwerken wohnen Ana Roš, ihr Mann, die beiden Kinder und die Schwiegereltern.
Wie kamen Sie dazu, dann an der renommierten diplomatischen Akademie in Triest zu studieren?
Ich bin sehr altruistisch, reise gern und hatte in allen Fächern gute Noten. Das war eine logische Entscheidung. Aber habe ich mir eine Karriere als Diplomatin erträumt? Höchstens als eine Angelina Jolie, die die Welt rettet. In meinem ersten Praktikum im Außenministerium merkte ich, wie bürokratisch der Job in Wirklichkeit ist.
1994 schleppte Ihre Mutter Sie ins »Hiša Franko«, wo Sie Ihren heutigen Mann Valter Kramar kennenlernten: Sohn der Besitzer und Sommelier.
Ich langweilte mich mit den Älteren am Tisch, also lud er mich auf ein Glas Wein ein. Unser Tal ist klein, ich kannte ihn schon mein Leben lang, aber an diesem Abend sah ich ihn zum ersten Mal richtig. Er war neugierig und brannte für Dinge, von denen ich keine Ahnung hatte – Wein und Restaurants. Für mich war er eine Art Held, und das war er tatsächlich: Er revolutionierte den Weinmarkt in der Gegend, täglich bestellte er lokale Hersteller ins Restaurant ein.
Was änderte Ihre Liebe zu ihm?
Als Sportlerin hatte ich diszipliniert gegessen, mit der Beziehung lernte ich zu genießen. Unsere Dates waren mit Essen und Wein verbunden. Statt uns Blumen und Ringe zu schenken, kauften wir ein Ticket nach Eboli und einen Flug nach Barcelona. Wir reisten, besuchten wunderbare Restaurants und Weinmessen. Je mehr ich lernte, desto hungriger wurde ich.

Wenn sie gerade in der Küche arbeitet, vermissten ihre Kinder sie. Wenn sie bei ihren Kindern ist, werde sie im Restaurant vermisst, sagt Ana Roš. »Eine Frau wird immer irgendwo vermisst.«
Kurz bevor Sie einen Job bei der Europäischen Kommission antreten wollten, im Jahr 2000, gingen die Eltern Ihres Mannes in den Ruhestand. Warum entschieden Sie sich für die Küche?
Das »Hiša Franko« war das erste private Restaurant im Soča-Tal und ein besonderer Ort. Als Kind wartete ich mit meinen Eltern und dem halben Dorf auf einen freien Tisch, um Štrukli (slowenischer Strudel, Anmerkung der Redaktion) und den berühmten Rinderbraten zu essen. Valter kümmerte sich um die Weine, da blieb nur ich als Köchin. Meine Mutter war eine angesehene Journalistin, mein Vater Arzt, noch heute nennen mich die älteren Leute im Dorf »Tochter des Doktors«. Für meine Eltern war es, als hätte ich gesagt: »Ich schmeiße mein Gehirn weg und stelle mich in die Küche.« Sie konnten mich nicht verstehen.
Tatsächlich war die Entscheidung sehr merkwürdig: Sie beherrschten fünf Sprachen, aber Kochen hatten Sie nie gelernt.
Wenn ich als Jugendliche spät vom Training kam, stand das Essen schon auf dem Tisch. Ich fing bei null an. Meine Nudeln fielen auseinander, das Fleisch wurde trocken, aber ich wollte mich unbedingt ausprobieren. So verloren wir die Gäste, die günstig und traditionell essen wollten. Mein Ziel war nicht, eine bekannte Köchin zu werden. Die Frage war: Können wir Leute überzeugen, in dieses abgelegene Restaurant auf dem Land zu kommen? Können wir finanziell überleben?
»Kochen ist nichts für dumme Leute«, haben Sie mal gesagt.
Kochen ist natürlich für jedermann, die gehobene Küche erfordert aber sehr viel Intelligenz. Ich legte mir eine ganze Bibliothek an, Sous-Vide Cuisine von Joan Roca beispielsweise verriet mir viel über die Zubereitung von Fleisch. Aber das Entscheidende war, dass ich einfach kochte. Ich ging Schritt für Schritt vor und machte aus allem eine Studie. Wenn man etwas zum dritten Mal versaut, versteht man den Prozess: Ich lernte, indem ich scheiterte.

Fast alle Zutaten kommen aus der Umgebung, die Wildbirnen sogar aus dem hauseigenen Garten.
Erinnern Sie sich an das erste Gericht, das Ihnen gelang?
Eine Forelle mit Kartoffelravioli, gerösteten Algen und Forelleneiern. Wenn man auf die Pasta biss, explodierte sie, und die flüssige Kartoffelfüllung lief hinaus. Es war ein einfaches Gericht, aber es zeigte meinen Respekt vor dem Kochen. Noch heute schwärmen die Leute davon.
Was für Vorteile bringt es, Autodidaktin zu sein?
Ich habe nie Helden gehabt, konnte niemanden kopieren und muss beim Kochen viel mehr nachdenken als andere.
Und die Nachteile?
Manche Techniken habe ich nie gelernt. Vor Kurzem kochte ich mit Joachim (Joachim Wissler, Chefkoch im »Restaurant Vendôme«, Anmerkung der Redaktion) in Bergisch Gladbach ein Drei-Sterne-Menü. Als Pre-Dessert gab es eine Art Brot, das mit flüssigem Gorgonzola gefüllt war. Die Textur war besonders. Ich habe ewig überlegt, wie es gemacht wurde, und kam einfach nicht darauf. So etwas passiert aber nur noch selten.
Ihre Küche sprach sich herum, der Pariser Kritiker Alexander Lobrano empfahl sie, Sterneköche wie Massimiliano Alajmo und Massimo Bottura wollten probieren. Wie haben Sie die überzeugt?
Ich erinnere mich genau daran, wie Massimiliano Alajmo durch die Tür kam. Er war der jüngste Koch, der drei Michelin-Sterne bekam. Ich dachte nur: »Nein, nein, nein, ich kann für diesen Mann nicht kochen.« Anscheinend schmeckte man meine Unsicherheit: Nach dem Essen fragte er, ob ich alles noch einmal zubereiten könne. Ein Gang bestand aus einem süßen Brot, Meerrettich, Leber und Apfel sowie Apfelsaft mit Gewürzen, den ich dazugereicht habe. Nach dem zweiten Mal kam er in die Küche und sagte: »Ich möchte Kilos davon.« Später servierte er eine Interpretation in seinem Restaurant.

Diesen mit Heu aromatisierten Teig soll man aufknacken und dann nur die darin eingebackene Kartoffel essen.
Der vermutlich wichtigste Gast in Ihrem Leben war der Streamingdienst Netflix. Drei Wochen lang wurde die Serie Chef’s Table bei Ihnen gedreht, 2016 wurde die Folge über Sie ausgestrahlt. Einen Tag später wollten Menschen aus aller Welt Ihre Gerichte probieren. Wie haben Sie das in Ihrer Landküche bewältigt?
Eine Zeit lang sah es so aus, als könnten wir mit Catering für Unternehmen ganz gut verdienen. Also haben wir die Küche 2005 umgebaut, mit neuen Arbeitsflächen und Laufwegen. Dann kam die Wirtschaftskrise, slowenische Unternehmen wollten kein Geld mehr ausgeben, die Aufträge blieben aus, und die Küche wurde schrecklich groß. Aber elf Jahre später, nach Netflix, war sie für den Ansturm bereit.
Heute sieht sie aus wie eine typische Edelstahlküche aus der Spitzengastronomie. Was an ihr ist noch persönlich?
Alle Pfannen sind alt, mit einigen haben schon Valters Eltern gekocht. Sie zu ersetzen würde kaum etwas kosten. Aber ich hänge an ihnen. Diese Küche war mein Esszimmer, mein Schlafzimmer, ich habe meine Kinder hier gestillt, auf sie aufgepasst, an meinen freien Tagen und in den Ferien gekocht, sehr viele Menschen bewirtet. Ich wünsche mir, dass sie ein glücklicher Ort ist. Andererseits ist sie mit harter Arbeit verbunden. Sobald ich dort bin, werde ich eingesogen.
Haben Sie einen Lieblingsplatz?
Meine kleine Ecke gleich beim Spülbecken. Ich mag es, dass ich da meine Messer abwaschen kann und es nicht der offensichtliche Platz für eine Chefköchin ist.
Sie reden oft im Plural und betonen, dass das »Hiša Franko« von zwei Leuten geführt wird. Welche Rolle spielt Ihr Mann?
Er ist der Eigentümer und mit seiner Familie die Seele des Hauses. Den Weinkeller hat er angelegt. Wir haben sehr alte und seltene slowenische Naturweine. Wenn ich ein neues Menü entwickelt habe, gibt es eine Weinprobe. Jedes Gericht wird durch einen Wein vollendet, jeder Wein durch ein Gericht. Und dann hat Valter noch seinen Käse. Der Tolminc-Käse aus der Region ist wunderbar. Weil ihn aber kaum ein slowenisches Dorf reifte, machte Valter das selbst. Bis heute bezieht er Käse von lokalen Bauern, fermentiert ihn und lässt ihn bis zu vier Jahre lang in seinem Keller reifen. Ich muss ihm nur sagen, was ich brauche, und er bringt mir den richtigen Käse.

Im »Hiša Franko« werden die Wildbirnen mit Scampi und Nüssen gefüllt und mit Liebstöckelöl zubereitet.
Sprechen Sie dann als Ehefrau oder als Chefköchin mit Ihrem Mann?
Ich selbst merke es gar nicht, wenn ich gestresst bin. Aber manchmal fragt er: »Hey, Ana, kannst du dich mal beruhigen?«
Wie lautet Ihre oberste Regel als Chefköchin?
Gut zueinander sein. Ich habe noch nie unter einem Küchenchef gearbeitet, das macht mich einzigartig darin, wie ich meine Leute behandle. Ich habe fast die Rolle einer Mutter. Wenn jemand krank ist oder weint, versuche ich zu helfen. Nur zwei oder drei Mal im Jahr verliere ich die Nerven.
Es heißt, Sie hätten einmal fünf Leute innerhalb von einer Woche gefeuert.
Fünf Männer, ja. Alle arbeiteten noch auf Probe. Drei davon haben mich nicht als Vorgesetzte akzeptiert. Sie hassten es, dass sie auf eine Art schwächer waren als ich, und konnten mir nicht einmal in die Augen schauen. Ja, ich bin eine Frau, aber in erster Linie bin ich Chefköchin. Und wenn eine Chefköchin nicht die komplette Kontrolle hat, sind die Gäste am Ende nicht zufrieden.
Wann hat zuletzt ein Mann Ihre Autorität hinterfragt?
Ich war als Chefköchin auf ein australisches Weingut eingeladen und kochte mit einem zu 100 Prozent männlichen Team. Er solle die Rinderzunge salzen, wies ich den Souschef ein. Kochen wollte ich sie aber selbst, weil ich die Konsistenz von australischer Rinderzunge noch nicht kannte und deshalb kein Rezept hatte. Als ich von meinen Interviews zurückkam, war sie verkocht. Ich habe dem Souschef vier Stunden gegeben, um mir eine neue Rinderzunge zu besorgen, und ihn aus dem Team entfernen lassen. Das war im November 2017, als ich offiziell die beste Köchin der Welt war.
Die Auszeichnung als beste Köchin ist umstritten. Der Sternekoch Anthony Bourdain fragte schon 2013 auf Twitter, ob Frauen denn Kuriositäten seien. Dominique Crenn, die im Jahr vor Ihnen gewann, sagte: »Ich hoffe, dass es in ein paar Jahren diesen Award nicht mehr gibt.«
Ich sehe das anders. Die Auszeichnung gibt uns eine Plattform, um darüber zu reden, wie schwer dieser Job mit den Verpflichtungen als Mutter, Hausfrau und Ehefrau vereinbar ist. Bei meiner Rede in Melbourne weinten viele sehr berühmte Köche. Joan Roca sagte zu mir, er habe zum ersten Mal verstanden, wie wahr das alles ist.
»Diese Küche war mein Esszimmer, mein Schlafzimmer, ich habe meine Kinder hier gestillt«
Was hat diese Männer so berührt?
Ich sagte, dass ich immer schuldig bin. Wenn ich koche, bin ich schuldig, weil ich meine Kinder allein lasse. Wenn ich Zeit mit ihnen verbringe, bin ich schuldig, weil ich mein Team und meine Gäste vernachlässige. Also arbeite ich 16 Stunden lang im Restaurant und dann zu Hause noch drei Stunden, mache die Wäsche, kümmere mich um meinen Sohn und meine Tochter.
Die Frau als Chef: Ist das auch in Ihrer Ehe ein Problem?
Das ist immer ein Problem. In traditionellen Gesellschaften, gerade hier auf dem Land nahe der italienischen Grenze, gilt der Mann heute noch als Familienoberhaupt. In der Küche dagegen hat der Chefkoch immer recht, auch wenn er weiblich ist. Selbst wenn ich falsch liege, nicken meine Mitarbeiter. Da kann ich nicht nach Hause kommen und plötzlich auf die Knie gehen. Wenn Valter mich fragt, ob ich wirklich so viel arbeiten muss, sage ich: »Würde ich dich als Mann so etwas fragen?«
Sie haben einen neuen Sommelier eingestellt, Ihr Mann hat vor etwa einem Jahr ein zweites Restaurant eröffnet, das »Hiša Polonka«. Wollte er Abstand gewinnen?
Unsere ganze Familie mag am liebsten einfaches Essen. Selbst Valters Eltern, die noch mit uns im Haus leben, essen nie im »Hiša Franko«. Bier zu brauen und traditionelle Küche anzubieten, war ein Traum von Valter. Er hat sich einen bodenständigen Ort geschaffen.
Stimmt es, dass Sie Rezepte träumen?
Ständig. Essen ist Kunst, deshalb lässt sie einen niemals los. Meine Essensträume sind meistens Träume vom Versagen: Ich scheitere, ich bin zu spät, ich verliere die Kontrolle. Diese Nacht waren es die Birnenrollen, die es heute als kalte Vorspeise gibt. Ich weiß nicht mehr, was passierte, aber es war intensiv. Ich wache dann auf wie aus einem Albtraum, und trotzdem entstehen daraus Ideen, die viel kreativer als mein reales Denken sind.
Wie wird aus einem Traum ein Elf-Gänge-Menü?
Früher habe ich alles allein kreiert und ausprobiert, das Essen sollte mein Werk sein. Heute entwickle ich Basisrezepte rund um die Zutaten, die Miha angekündigt hat. Dann teile ich das Team in Gruppen ein, die verschiedene Techniken ausprobieren. Am Ende fügen wir daraus etwas zusammen. Diese Entwicklung hätte ich mir selbst nie zugetraut. Aber das Gute ist, dass das Essen so für meine Mitarbeiter nicht zu etwas rein Handwerklichem wird und ich mich selbst weiter öffne.

Jeden Morgen bricht Ana Roš zu einer 45-minütigen Laufrunde auf.
Die slowenische Küche galt lange als Bauernküche. Auch durch Ihre Präsenz in den Medien hat sich das Bild geändert. Haben Sie den Eindruck, dass Sie in Ihrer Heimat als Heldin gelten?
Wenn ich nach Russland gehe, sagen die Leute, alles, was sie von Slowenien kennen, sind Laibach und mich. In den USA: Melania Trump und mich. In England: Slavoj Žižek und mich. Aber ob die Slowenier stolz sind auf das, was wir tun? Ich glaube, sie verstehen es nicht richtig. Die Leute auf dem Land sehen Essen immer noch als Treibstoff fürs Leben. Sie würden niemals 150 Euro für ein Menü bezahlen.
Sie legen sich nicht auf eine Spezialität des Hauses fest und haben sich lange geweigert, Rezepte aufzuschreiben. Für ein Buch, das in diesem Jahr erscheinen soll, haben Sie es doch getan. Sind Sie eingeknickt?
Die Natur ändert sich ständig. Jede Pflaume muss anders behandelt werden als die nächste. Deshalb finde ich, dass Köche flexibel sein und selbst denken müssen. Aber ich glaubte an einen unmöglichen Traum: Wenn 20 Leute in einer Küche stehen, kann ich mich nicht auf die Intelligenz von jedem Einzelnen verlassen.
Können Ihnen Gäste auch mal auf die Nerven gehen?
Die meisten Gäste übernachten bei uns. Wenn ich morgens um acht vom Laufen zurückkomme, fragen sie mich nach Selfies, egal wie verschwitzt und rot ich bin, egal wie dringend ich eine Dusche brauche. Die Menschen sollen für das Essen kommen, nicht um Küchenchefs zu fotografieren. Das macht uns zu Affen.
Haben Sie je in Ihrer Küche geweint?
Hier draußen, drinnen, überall. Vor allem 2018. Das »Hiša Franko« wurde auf den 48. Platz der 50 besten Restaurants gewählt. Als ich von der Ehrung zurückkam, merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Einen Monat später sagte meine Souschefin, sie könne sich nicht mehr mit unserer Geschichte identifizieren. Mit ihr gingen drei andere. In dem Moment, als wir besonders glücklich und stark hätten sein müssen, brach alles zusammen. Ich war mir nicht sicher, ob wir das überleben würden. Zu sechst mussten wir für 100 Gäste pro Tag kochen. Das Team, das blieb, war unheimlich loyal und arbeitete wahnsinnig viel. Nach anderthalb Monaten waren wir besser und stärker als je zuvor.
Bei so viel Zeit in der Küche bleibt nicht viel Schlaf. Hatten Sie nie Angst, einfach umzufallen?
Natürlich habe ich Angst. Wenn etwas schiefgeht, belastet es mich am meisten. Kürzlich wurde bei mir eine sehr kleine gynäkologische Operation durchgeführt, es war nichts weiter. Aber zwölf Tage später musste ich wieder ins Krankenhaus. Sie brauchten eine halbe Stunde, um meine Blutungen zu stoppen. Meine Ärztin sagte später, das liege auch am Stress. Da habe ich gemerkt, wie verletzlich ich bin.
»Die Leute auf dem Land sehen Essen immer noch als Treibstoff fürs Leben. Sie würden niemals 150 Euro für ein Menü bezahlen«
Wie helfen Sie sich?
Jeden Morgen laufe ich mindestens eine Dreiviertelstunde. Ich gehe shoppen und treffe Freunde wie eine normale Frau. Als ich an meinem Buch schrieb, habe ich ein Apartment angemietet und es dann als Zufluchtsort behalten. Manchmal laufe ich dorthin, schlafe eine Runde, meditiere, bin einfach allein. Und ich verbringe Zeit mit den Kindern.
Mit welchem Essen kann man Sie glücklich machen?
Essen ist etwas sehr Subjektives. Ich bin versessen nach Lamm, weil es das erste Fleisch war, mit dem ich meine Kinder gefüttert habe, als sie sieben Monate alt waren.
Wann hat zuletzt jemand für Sie gekocht?
Privat? Ganz ehrlich, ich erinnere mich nicht. Ich bin ein Kontrollfreak und übernehme meistens das Kommando.
Und wer kocht für Ihre Kinder?
Ich.
Mit René Redzepi sind Sie befreundet, Gaggan Anand nennen Sie »Bruder«, von Leonor Espinosa schwärmen Sie auf Instagram, Sie reisen zu den wichtigsten Köchen der Welt. Wer hat Sie besonders beeinflusst?
Es waren viele Köchinnen auf einmal. Mit meiner Familie fuhr ich in einem Zug aus dem 19. Jahrhundert durch Madagaskar. An jedem Halt stiegen Kinder ein, auf ihren Köpfen trugen sie Körbe voll Essen. Am Ende stopften wir uns die Früchte, Flusskrebse und Garnelen noch in die Taschen. Alles war so sorgfältig zubereitet wie in der Haute Cuisine. Dort habe ich gelernt, wie wichtig die Haltung beim Kochen ist: Das Essen war das glücklichste in meinem Leben, weil es so liebevoll zubereitet war.