Es pocht der Kopf, es sticht das Licht, es pelzt der Mund, es rollt der Magen. Der Kater ist ein Elend, bei dem einem niemand hilft, die Wissenschaft schon gar nicht. Sie hat den Oralverkehr bei Fruchtfledermäusen erforscht und nachgewiesen, dass Schimpansen einander auch an Fotos ihrer Hinterteile erkennen können, sie hat Menschen auf den Mond geschossen und gesund wieder nach Hause gebracht, aber sie gibt ihnen kein Mittel gegen das alkoholische Post-Intoxikations-Syndrom. Warum auch? Der Kater geht von selbst vorbei, da soll der Säufer durch und zweitens dabei lernen, dass er nicht so viel saufen soll, der blöde Hund.
Bis heute hat die Forschung die Ursachen des Katers nicht restlos ermitteln können. Zwei Hauptschulen stehen einander gegenüber. Die Methanol-Theoretiker behaupten, das Schädelbrummen werde vor allem von den Begleitgiften und Fuselstoffen im Alkohol ausgelöst, die der menschliche Organismus schwer verkrafte. Deswegen ist Weißwein bekömmlicher als der Rote, sind Wodkasäufer unverkaterter als Whiskeyfreunde, Billigtrinker gefährdeter als die Privilegierten, die sich guten Stoff leisten können.

Anti-Kater-Präparate sind in der Regel Kombinationen aus Vitaminen, Mineralsalzen und Ähnlichem: Schaden nicht, nützen kaum, abgesehen vom Placebo-Effekt.
Die Äthanol-Fraktion dagegen vertritt die Auffassung, es sei das Acetaldehyd, das den Morgen danach so unangenehm macht, eine giftige Substanz, die beim Alkoholabbau durch die Leber entsteht und bei zu großer Betankung hochkonzentriert durch die Blutbahn schießt, ehe die Leber sie in einem zweiten Arbeitsgang in harmlose Essigsäure verwandelt. Man kann es auch so ausdrücken: Erst holt man sich eine Alkoholvergiftung, dann vergiftet sich der Körper beim Entgiften ein zweites Mal; offensichtlich verträgt der Mensch weder den Rausch noch die Ernüchterung. Ein dritter Erklärungsansatz wird seit Langem von der Wissenschaft zurückgewiesen, ohne dass es sich zu allen Trinkern durchgesprochen hätte: Kater sei nichts anderes als Alkoholentzugsschmerz, weswegen man ihn mit Konterbieren, Bloody Marys und anderen Reparatur-Drinks therapieren könne.

DEUTSCHLAND Hering In Essig eingelegter Fisch, mit Senfkörnern und Wacholderbeeren aromatisiert: Anti-Kater-Wirkung zweifelhaft, aber man muss immerhin nicht kochen.
Warum der Mensch Alkohol so unbefriedigend verkraftet, ist eine Frage, die immer noch ins Spekulative führt. Es muss etwas mit unserem evolutionären Erbe zu tun haben. Die Organismen von Fleischfressern sind auf die Verarbeitung von Alkohol nicht eingerichtet, Pflanzenfresser dagegen, bei ihrer Nahrungssuche eher mit vergorenen Früchten und folglich mit Alkohol konfrontiert, haben im Verlauf der Naturgeschichte Stoffwechselstrategien entwickelt, um dessen Gifte abzubauen. Dabei sind Vögel besonders effizient (allerdings nur, wenn es sich um Frucht- und Beerenfresser handelt), selbst mit 3,1 Promille gelingt ihnen immer noch das Fliegen. Ein Star mit dem Körpergewicht eines Menschen, so hat der Ornithologe Roland Prinzinger ermittelt, könnte jede einzelne Minute ein Glas Wein kippen, ohne davon betrunken zu werden – so bewundernswert viel schafft seine Leber weg. Der amerikanische Evolutionsbiologe Neil Shubin übrigens macht für den Drehschwindel von Verkaterten die Fischnatur verantwortlich, die immer noch im Menschen steckt: Das Karussellgefühl im Kopf stellt sich ein, sobald das Äthanol über die Blutbahn das Gleichgewichtsorgan im Innenohr erreicht, ein evolutionäres Erbe jenes Organs, mit dem Fische Strömungsbewegungen im Wasser feststellen.
Mag die Wissenschaft über alle Ursachen des Katzenjammers immer noch im Dunklen tappen, kann sie doch Auskunft über das subtile Zusammenspiel der mit ihm verbundenen Qualen geben. Der trockene Mund beim Erwachen: dem Umstand geschuldet, dass Alkohol entwässert. Bei seinem Konsum wird die Ausschüttung eines antidiuretischen Hormons namens Vasopressin gehemmt, der Trinker muss öfter raus, das fehlt ihm am Tag danach. Das Schädelweh: durch Gefäßverengungen verursacht, auch sie eine Folge der Entwässerung. Die Übelkeit beruht auf der vermehrten Produktion von Magensäure, die die Magenschleimhaut reizt. Und dass sich die Knie wie Pudding anfühlen, liegt daran, dass beim übermäßigen Pinkeln auch Elektrolyte und Glucose den Trinkerkörper verlassen haben. Ein Spaß ist das nicht.
Mit vernünftigen Argumenten lässt sich kaum begründen, dass die Forschung so wenig Bereitschaft zeigt, ein wirksames Medikament gegen all das zu entwickeln. Erstens könnte man mit einer wirksamen Anti-Kater-Pille vermutlich noch größere Gewinne machen als mit Viagra. Zweitens lässt sich schwerlich leugnen, dass für den Kater nicht nur der Trinker, sondern oft genug die Gesellschaft büßen muss. Katerinduzierte Arbeitsunfälle und Fehlzeiten durch Eintagesgrippe verursachen enormen volkswirtschaftlichen Schaden. Finnland etwa mit seiner Bevölkerung von fünf Millionen Menschen verzeichnet jährlich eine Million Fehltage durch Kater, und eine amerikanische Studie aus dem Jahr 1998 berechnete den Schaden durch Blaumachen und schlechte Arbeitsleistung nach trunkenen Nächten auf 148 Milliarden Dollar pro Jahr. Doch solange den Menschen beim Nüchternwerden nicht wirksam geholfen wird, werden viele von ihnen sich mit dickem Kopf ins Büro schleppen und dort jede Menge Fehler machen. Oder sich in ein Flugzeugcockpit setzen, mit signifikant verschlechterten Reaktionszeiten, obwohl die Promillewerte längst schon wieder legal sind.

ENGLAND Katerfrühstück Speck, Baked Beans, Ei, Würstchen: Hinterher kann man sich wenigstens einreden, dass einem nicht vom Alkohol schlecht ist.
Wie weltumspannend das Leiden nach dem Trinken ist (gleichsam eine anthropologische Konstante), beweist noch der flüchtigste Blick in Geschichte und Völkerkunde. Jede Sprache hat ihre besonderen Ausdrücke dafür, alle zusammen ergeben sie so etwas wie eine Liste jener Indikationen, zu denen endlich das Gegenmittel gefunden werden müsste. Im Englischen heißt der Kater seit Beginn des 20. Jahrhunderts hangover (davor nannte man ihn unter anderem Morgennebel oder Flaschenweh), im Französischen spricht man von der Holzfresse (gueule de bois), im Spanischen von der Meeresbrandung (resaca), der Italiener wird vom Kater stumm (stonato), Schweden klagen über Rückschlag (baksmälla), die Norweger über einen kuppelhue, einen Kuppelkopf, oder über Zimmermänner, die sich im Schädel zu schaffen machen (tømmermenn).
Warum die Deutschen beim Nüchternwerden von einem Kater gequält werden, ist nicht endgültig geklärt. Könnte sein, dass es sich um die sächsische Aussprache des Katarrhs handelt oder um die Erinnerung an ein heftig knallendes Bier namens Kater aus dem 16. Jahrhundert oder um eine Abwandlung des länger belegbaren Ausdrucks Katzenjammer. Übrigens trinken Katzen keinen Alkohol, nicht einen Tropfen, man kann sie ums Verrecken nicht dazu bewegen.
Solange es gegen das Haarweh kein wirksames Medikament gibt, bleibt es die einzige Malaise, bei deren Linderung Folklore, Aber- und Wunderglauben ungehindert zur Anwendung kommen. Die Liste der todsicheren Rezepte und Geheimtipps ist länger als jede Weinkarte in einem erstklassigen Restaurant. Systematischer sortiert als es Süffelköpfen üblicherweise gelingt, lassen sie sich in Vorbeugungsstrategien vor dem Exzess, Schutztechniken während des Trinkens und Erste-Hilfe-Maßnahmen für den Morgen danach einteilen. Wann immer dieser Morgen anbricht.
Wer sich betrinken will, heißt es, solle davor viel und fett essen. Das polstere den Magen aus, verlangsame die Aufnahme des Alkohols und zögere den Katzenjammer hinaus. Falsch ist das nicht – nüchtern betrachtet aber doch bloß eine Verzögerungstaktik von Menschen, die sich möglichst hart die Kante geben wollen. Durchs Essen vor dem Trinken gewinnen sie bloß mehr Zeit, ehe der Rausch und danach der Kater einsetzen. Also mehr Gelegenheiten, noch eine wirklich
allerletzte Runde zu ordern (und dadurch einen noch größeren Kater zu züchten).

CHINA Grüner Tee Allerdings trinkt der Chinese bei jedem Wehwehchen Grüntee, dessen gesundheitsfördernde Wirkungen unbestritten sind.
Ähnlich blauäugig ist die Empfehlung, beim Suff zusammen mit dem Alkohol möglichst viel Wasser zu trinken. Das beuge Flüssigkeitsverlusten vor und möglicherweise auch ein wenig dem Irrtum, Alkohol sei ein geeignetes Mittel, ordinären Durst zu stillen. Allerdings: Je betrunkener man wird, desto weniger denkt man noch an solche Präventionsmaßnahmen. Und Zecherrunden, bei denen solches Trinkverhalten nicht für Spott sorgt, kann man sich nur schwerlich vorstellen. Lebensnäher ist eine zweite Katervorbeugungsregel: nicht zu viel durcheinandertrinken. Das nämlich belastet den Körper mit einer reichhaltigeren Auswahl von Methanolen. Keine besonders gute Idee sind übrigens auch Mischungen wie Wodka-Red Bull. Sie putschen den Trinker auf und lassen ihn glauben, er könne locker noch mehr vertragen.
Könnte allerdings gut sein, dass gerade das ihn anzieht, vielleicht will er sich ja verantwortungslos besaufen, bis nichts mehr geht. Und dazu eine nach der anderen rauchen, obwohl er weiß, dass das für exponentielles Schädelwehwachstum sorgt. All die Tricks, dem Kater schon vor seiner Entstehung Hecken zu ziehen, laufen ja bloß auf eines hinaus: Die Party soll nicht zu wild werden. Doch kann eine Party gut sein, auf der man nicht durcheinandersäuft und wie verrückt raucht? Da könnte man das Trinken ja auch gleich sein lassen.
Nach dem Aufwachen, falls man es so nennen will, ist der Kater da, so mächtig oft, dass die Verzweiflung bei den aberwitzigsten Gegenmitteln Zuflucht sucht, selbst wenn man weiß, dass es nur einen versumpften Tag lang dauert, ehe das Elend wieder aufklart.
»Mische Zichorie mit einem grünen Frosch oder Pestwurzel mit der Zehe eines schwarzen Hundes oder ein grünes Gemüse mit dem Fußschweiß eines Mannes«, empfahlen die Babylonier. Plinius der Ältere rät zu Kohl (»einem Feind der Rebe«) und frischen Euleneiern, Scribonius Largos dazu, auf den Kopfschmerz einen lebenden schwarzen Zitterrochen zu legen. Die Polen halten Essigwasser für eine Katerkur, die Mexikaner Kuttelsuppe, die Japaner eingelegte Pflaumen, die Bewohner der äußeren Mongolei in Tomatensauce geschmorte Lammaugen.
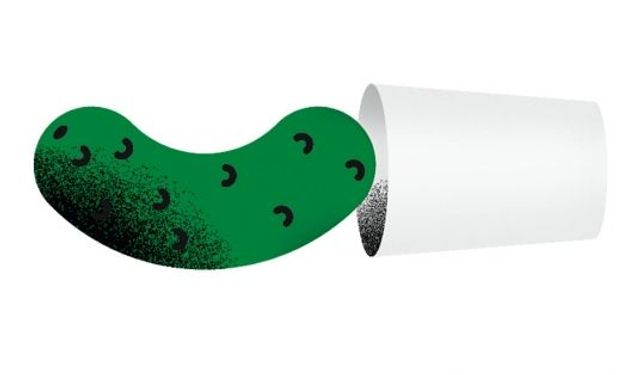
POLEN Essiggurken Genauer gesagt: die Flüssigkeit aus dem Essiggurkenglas. Enthält Antioxidantien, Mineralstoffe, Salz. Und funktioniert ebenfalls nicht.
Bananen sollen helfen. Kokosnusswasser soll helfen. Rollmops soll helfen. Und Espresso (mit einer Prise Salz oder mit einem Schuss Zitrone, je nachdem, ob man einen Franzosen oder einen Italiener befragt). Manche Engländer schwören auf Speck und Eier. Oder verbrannten Toast (eine Art selbst produzierter Aktivkohle). Die Cowboys bekämpften den Kater mit Tee aus Kaninchendung (eine Passage, die aus dem Drehbuch von Brokeback Mountain wieder gestrichen wurde). Wer sich mit der Kulturgeschichte der Katerbekämpfung beschäftigt, lernt: Es gibt nicht vieles, mit dem es die Trinker nicht versucht hätten.
1961 – ein Jahr, in dem man zum Business-Lunch noch ein paar steife Martinis nehmen konnte, ohne Argwohn zu erwecken – veröffentlichte ein gewisser Frank M. Paulsen in der Fachzeitschrift The Journal of American Folklore die Ergebnisse einer Umfrage, für die er sich bei Barbesuchern in zehn Städten nach ihren Hangover-Vertreibungs-Strategien erkundigt hatte. Auf den vorderen Plätzen: Tomatensaft, rohe Eier, Milch, Sex und, mit großem Vorsprung am beliebtesten, irgendeine Variante des Reparatur-Alkohols. Aber es gab auch so exotische Empfehlungen wie: »Drei Aspirin zusammen mit Cola, gefolgt von einer Buttermilchsuppe«, »Backpulver, das in lauwarmem Wasser aufgelöst wurde« oder »der Geruch von Benzin, möglichst tief eingeatmet«.
Nicht alles, was sich die Volksweisheit einfallen lässt, ist hanebüchener Blödsinn, aber selbstverständlich genügt nichts davon den strengen Wirksamkeitskriterien, die für richtige Medikamente gelten. Oft sorgen die Rezepte aus der Kater-Folklore bloß für Ablenkung vom Grundübel: Ein scharfes Chili zum Beispiel lässt den Magen vergessen, dass ihm gerade noch von den Nachwirkungen des Saufens schlecht war. Und ein schönes warmes Trostessen (falls man es denn schon wieder bei sich behalten kann) ist auch nicht verkehrter als der Versuch, das Schädelweh hungrig auszusitzen.

WELTWEIT Konterbier Alkohol zögert den Kater nur kurzfristig hinaus. Es sei denn, man trinkt ununterbrochen - und handelt sich dadurch noch größere Probleme ein.
Viele der auf dem Markt angebotenen Hangover-Präparate funktionieren im Prinzip nicht anders als Bananen oder Rollmops, direkt aus dem Glas gegessen: Sie führen dem Stoffwechsel etwas zu, was man entweder beim Trinken verloren hat oder beim Nüchternwerden gut gebrauchen kann. Vitamine, Mineralstoffe, Fruchtzucker, all das Zeug, mit dem man nichts falsch machen kann. Doch am grundsätzlichen Problem ändert sich nichts. Ehe man sich wieder taufrisch fühlt, muss die Leber den Alkohol und seine Abbauprodukte wegschaffen (nur fünf Prozent des Alkohols verlassen den Menschen über die Haut, deswegen sind auch Saunagänge, Reue-Workouts und Spaziergänge in grellem Tageslicht nicht sonderlich effektiv). Solange das dauert, tut es eben weh. Immerhin gibt einem der Versuch, sich mit einem Katerfrühstück und Multivitaminpräparaten zu kurieren, das schöne Gefühl, den Konsequenzen des eigenen Handelns nicht vollständig ausgeliefert zu sein.
Natürlich könnte man mit dem Trinken auch einfach weitermachen. Sich in die nächste Bar schleppen, den Freund hinter der Theke anjammern und sich von ihm einen Katerbekämpfungsdrink hinstellen lassen, die Auswahl ist durchaus beeindruckend (Barbesitzer Charles Schumann: Bloody Mary mit 5 cl Wodka, 1 cl Zitronensaft, 2 Spritzern Tabasco, 3 Spritzern Worchestersauce, 12 cl Tomatensaft, etwas Pfeffer und Salz und einer Stange Sellerie. Schriftsteller Kingsley Amis: Donald Watt’s Jolt, ein Tumbler »randvoll mit süßem Likör – Grand Marnier oder Bénédictine –, der anstelle des Frühstücks eingenommen wird. Sein Erfinder berichtete mir, dass er es mit einem davon intus schon einmal bei eiskaltem Wetter eine Dreiviertelstunde an einer Bushaltestelle ausgehalten hat, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken«). Kurzfristig lindert das Kontertrinken die Katerqualen. Schon weil einem betrunken das eigene Elend weniger ausmacht, aber auch, weil es die Leber von der Methanol-Front abzieht, wenn man sie erneut an die Äthanol-Front schickt. Nüchtern allerdings kann man sich ausrechnen: Irgendwann muss man mit dem Trinken wieder auf-hören. Und dann kommt der Kater ja doch.
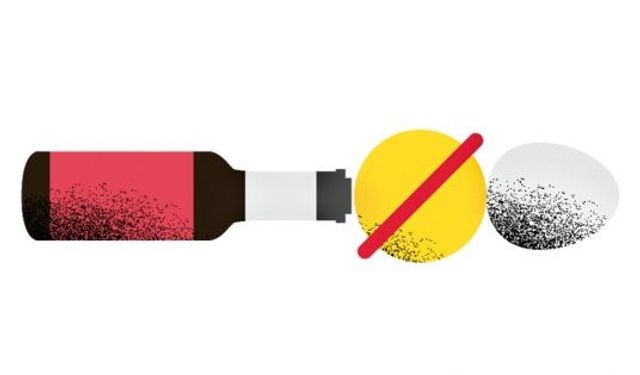
USA Prairie Oyster Worcestersauce, Eigelb, Zitronensaft (wenn man will), eine Prise Pfeffer oder ein Schuss Tabasco. Wichtig für das Auster-Gefühl: das Eigelb ganz lassen.
Gut so, befinden jene, denen die Volksgesundheit ein Herzensanliegen ist. Für sie ist die Angst vor dem Kater eine Blockade auf dem Weg zum Alkoholismus, eine Art Warnung vor dem Missverständnis, man könne sich mit Alkohol das Leben tatsächlich glücklicher trinken. Bei einem volkswirtschaftlichen Gesamtschaden von etwa 25 Milliarden Euro pro Jahr durch Alkoholgenuss und bei jährlich über 70 000 Todesfällen lässt sich das Zögern, in Antikater-Forschung zu investieren, durchaus nachvollziehen. Ganz abgesehen davon, dass Ethik-Kommissionen nicht wirklich medizinische Versuche tolerieren können, bei denen es zur Versuchsanordnung gehört, Menschen systematisch besoffen zu machen.
So findet die Forschung gegen das Katerübel an den Rändern der Branche statt. Und deshalb werden die Mittel, die dabei ersonnen werden, als Nahrungsergänzungsmittel angeboten – der gute alte Trick, mit dem man sich die kostspieligen Prozeduren erspart, die für die Zulassung von Arzneien gelten.
Vor allem in Asien und Russland wird an Hangover-Mitteln geforscht, beides nicht sehr verwunderlich: Viele Asiaten vertragen Alkohol schlechter als wir, weil ihnen ein bestimmtes zum Abbau der Gifte nötiges Enzym fehlt; und in Russland gehört zur
Geselligkeit immer noch die Bereitschaft, sich die Birne wegzuknallen.
Alexander Teslenko zum Beispiel ist ein Mann, der die Menschheit vom Übel des Katers erlösen könnte. Lange war der promovierte Chemiker Wissenschaftler am Allunionsinstitut für Hochreine Biopräparate in Leningrad, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wanderte er nach Deutschland aus, und irgendwann entwickelte er ein Präparat, das die Leber entgiftet und die Kater-Symptome deutlich abschwächt, es enthält, mailt er, »Extrakte aus Curcuma (bekannt auch unter dem Namen ›Indisches Gold‹), Lakritz, Granatapfel, Oligoglukane mit ihrem breiten biologischem Wirkspektrum und andere Substanzen«. Seit anderthalb Jahren ist sein Mittel unter dem schönen polynesischen Namen Koa-Koa im Internet erhältlich, es gibt bereits eine Menge Trinker, die auf seine Wirkungen schwören, und wenn sich das noch ein wenig herumspräche, wäre Teslenko ein gemachter Mann. Wie die Kollegen, die in den USA ein Präparat namens RU-21 vertreiben (ein Wortspiel aus der Abkürzung für Russland und der Frage, ob man schon 21 sei, also legal trinken dürfe), auch als »KGB-Pille« bekannt. Der sowjetische Geheimdienst soll es im Kalten Krieg entwickelt haben, um seinen Agenten das Trinken ohne Katerkopf zu ermöglichen, ein findiger Importeur führte es in den USA ein, ein paar Hollywood-Schauspieler orderten es für ihre Partys, seitdem läuft der Absatz.
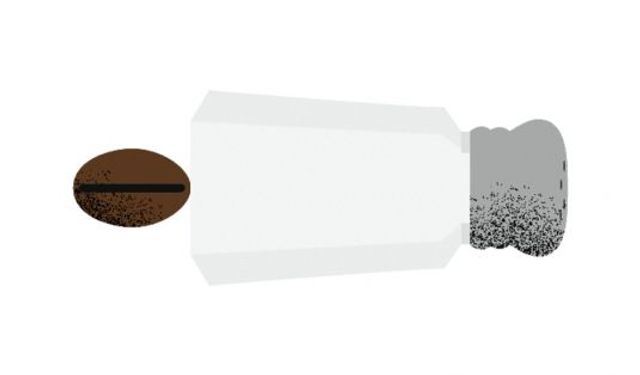
FRANKREICH Espresso mit Salz Der Kaffee macht wach genug, um sich ins Büro zu schleppen, das Salz soll jenes ersetzen, das man beim Saufen ausgeschieden hat.
Vielleicht aber ist der Drang, den Kater loszuwerden, nur ein Symptom eines anderen zeitgenössischen Zivilisationsleidens – der Wehleidigkeit, die zu jedem Schmerz gleich nach einem Gegenmittel verlangt. Der traditionsbewusste Trinker dagegen zähmt den Kater nicht, indem er ihn eliminiert, sondern indem er sich mit ihm zu versöhnen versucht, als Teil des Vergnügens, als Konsequenz, die man ertragen muss. Der Kater
ist schließlich mehr als Kopfschmerz und Bauchgrimmen, er versetzt den von ihm Befallenen auch in den Stand der Erkenntnis: Nie lernt er sich in seiner Dürftigkeit und Bedürftigkeit besser kennen als in den Stunden, in denen der Rausch abklingt. Die Feinfühligkeit, die er jetzt hat! Die Scham, die er empfindet! Seine Bereitschaft, auf die Welt da draußen zu pfeifen! Lauter Erfahrungen sind das, die man nicht mehr allzu oft machen darf. Tatsächlich wird der Kater ja nur dann zum Problem, wenn er das Funktionieren des Lebens behindert. Spricht es also nicht möglicherweise gegen unsere Einrichtung des Lebens, wenn ein Kater gar so schlecht in den Lauf der Dinge passt? Wollen Sie wissen, warum so viele Schriftsteller Säufer sind, hat Kingsley Amis, ein begnadeter Schriftsteller und begnadeter Säufer, einmal gefragt und die Antwort gleich hinterhergeschoben: weil sie es sich leisten können, blauzumachen.
Der smarte Säufer weiß: Der Kater ist ein Augenblick der Wahrheit, in dem die Welt sich zeigt, wie sie ist. Die Kunst, mit dieser Wahrheit umzugehen, besteht darin, sie
stoisch zu ertragen. Der Kater geht vorbei. Das kann man leider nicht von allem sagen.
Illustrationen: Martin Nicolausson

