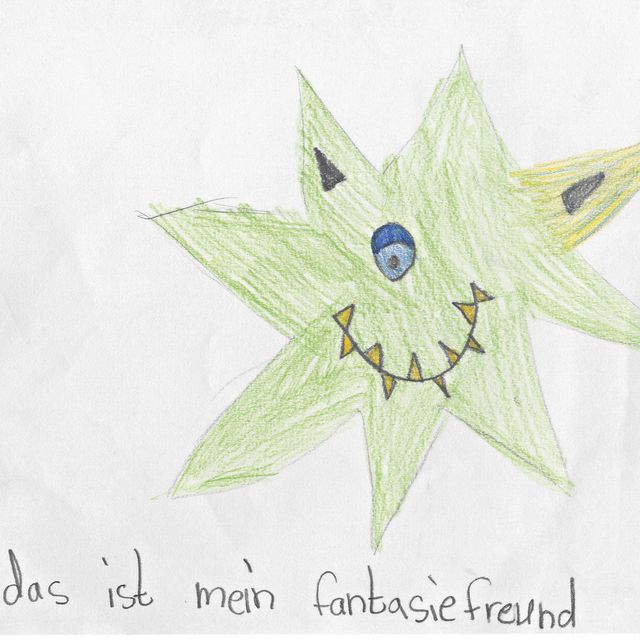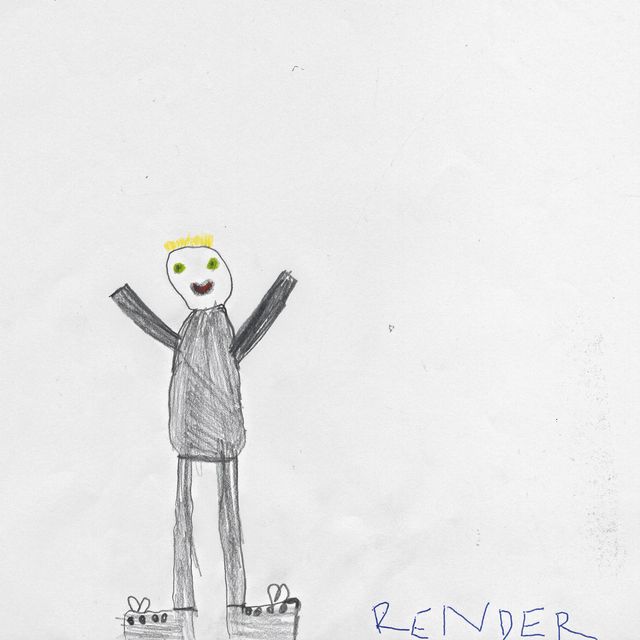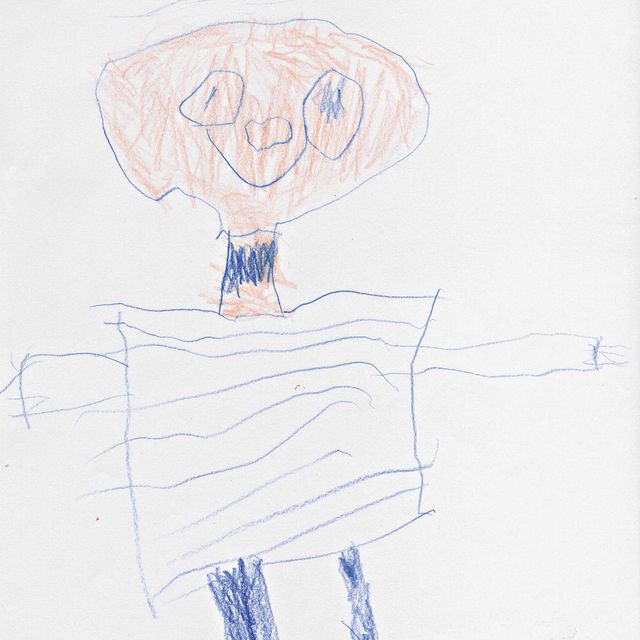Plötzlich war Crabby da. Blau, klein, mit Krabbenarmen und einem Krabbenkörper, aber menschlichen Wesenszügen. Nach einer Nacht mit schlimmen Ohrenschmerzen krabbelte Crabby dem kleinen Fisher aus dem Ohr und nahm den Schmerz gleich mit. Danach verbrachte er den restlichen Urlaub mit dem damals Dreijährigen, seinem Vater und seiner Mutter Paige Davis. Crabby, das war fortan Fishers neuer Freund, und nur Fisher konnte ihn sehen.
Dass ausgerechnet Dr. Paige Davis’ Sohn im vergangenen Sommer einen imaginären Freund erfand, kann man als glückliche Fügung bezeichnen. Davis ist Psychologin an der York St John University im englischen York und forscht bereits seit 2005 zur Funktion imaginärer Freunde und deren Auswirkungen auf Kinder und Erwachsene. »Crabby verbrachte den Urlaub in Norwegen mit uns. Als wir wieder zu Hause waren, verschwand er und tauchte erst wieder im nächsten Urlaub auf«, erzählt Davis. »Ich glaube, dass sich Fisher in der ungewohnten Situation ohne die Routinen von zu Hause einen Freund ausgedacht hat, der ihm dabei hilft, fremde Situationen besser zu meistern.«
Bis zu 65 Prozent aller Kinder haben, wie Studien besagen, irgendwann in ihrer Kindheit einen Fantasiefreund. Manche Psychologen machen einen Unterschied zwischen personifizierten Objekten wie Puppen, Kuscheltieren oder Spielfiguren und komplett erdachten Freunden. Die Funktion aber, sagt Davis, sei die gleiche: Kinder kreieren einen »Geist« – weswegen Davis selbst die Unterscheidung auch nicht vornimmt. Meist tauchen die »Imaginary Compan-ions«, wie sie im Englischen heißen, im Alter von drei bis fünf Jahren auf, die Gründe dafür können genauso unterschiedlich sein wie die Kinder, die die Freunde erdenken. »Oft ist es einfach Langeweile«, sagt Davis und verweist darauf, dass Erstgeborene oder Einzelkinder eher dazu neigen, sich bei Mangel an echten Spielkameraden einfach welche auszudenken. Daneben helfen die eingebildeten Freunde den Kindern, Grenzen auszutesten, sie dienen als Sündenbock für kaputte Fensterscheiben oder unaufgeräumte Zimmer und bekräftigen die Wünsche der Kinder, etwa nach späterer Zubettgehzeit oder einem bestimmten Lieblingsessen. So war es auch bei Fisher. »Mein Sohn will am liebsten jeden Tag Käsenudeln zum Abendessen. Und behauptet dann, Crabby wolle das auch«, erzählt Davis. »Imaginäre Freunde sind eine Art Erweiterung des Kindes.«
Auch wenn diese »Erweiterungen« der Fantasie des Kindes entspringen, können eingebildete Freunde durchaus ein Eigenleben entwickeln. Sie müssen nicht unbedingt auftauchen, wenn das Kind es will, ebensowenig verschwinden sie auf Kommando. Davis selbst hatte in ihrer Forschung mit Kindern zu tun, die davon berichteten, in manchen Situa
tionen »überrascht« vom Verhalten ihres imaginären Freundes gewesen zu sein. Es kommt sogar vor, dass eingebildete Freunde ziemliche Rüpel sind, die gemein zu dem Kind sein können und mit ihm in Streit geraten – wie echte Spielkameraden auch. »Die Theorie dahinter ist, dass Auseinandersetzungen mit dem imaginären Freund die Fähigkeit des Kindes trainieren können, generell mit Streitigkeiten und Auseinandersetzungen umzugehen«, erklärt Davis.
Es kommt vor, dass eingebildete Freunde ziemliche Rüpel sind
Lange Zeit hatten Fantasiefreunde nicht eben den besten Leumund. »Man ging früher davon aus, dass ihre Existenz etwas Schlechtes bedeutet. Etwa dass es dem Kind an etwas mangelt«, sagt Davis. Oft wurden eingebildete Freunde als Anzeichen psychischer Probleme gedeutet, in manchen Fällen gar als Besessenheit. Mittlerweile weiß die Wissenschaft: Das Gegenteil ist der Fall, die Effekte sind positiv.
»Imaginäre Freunde bringen eine Menge Vorteile mit sich«, sagt Davis. Wichtige Pionierarbeit leistete die US-amerikanische Psychologin Marjorie Taylor, deren Buch Imaginary Companions and the Children Who Create them als Standardwerk gilt. 1997 zeigte eine Studie von Taylor und ihrer Kollegin Stephanie Carlson, dass Kinder mit imaginären Freunden viel besser darin sind, sich in ihr Gegenüber hineinzuversetzen. Davis bezeichnet diese Studie als eine Art Startschuss, nach dem die positiven Effekte des Phänomens in den Forschungsmittelpunkt rückten. Auch in ihrer eigenen Arbeit. In einer Studie forderte sie Kinder auf, ihre realen Freunde zu beschreiben. Kinder, die angaben, keine imaginären Freunde zu haben, beschrieben ihre realen Freunde eher durch Äußerlichkeiten, Haar- und Hautfarbe, Frisur etc. Kinder mit Fantasiefreund beschrieben ihre realen Spielkameraden hingegen durch Charakterzüge: Humor, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft. Davis glaubt: Weil das Kind einen »Geist« erfunden und spielerisch und dialogisch ausprobiert hat, ist es besser in der Lage, sich in die Persönlichkeit anderer Menschen hineinzuversetzen, und legt dementsprechend den Fokus auf innere Werte. Das Rüstzeug, diese besser zu erkennen, hat es sich spielerisch angeeignet.
Auch zeigen Studien, dass Kinder, die sich einen Spielgefährten ausgedacht haben, kreativer und fantasievoller sind. Was freilich die Frage nach Ursache und Wirkung aufwirft: Haben Kinder mit einem Fantasiefreund von vornherein eine ausgeprägtere Einbildungskraft und sind eben deshalb auch in der Lage, sich einen Spielgefährten auszudenken? Oder verfügen Kinder mit einem Fantasiefreund über eine Art Trainingssituation, in der kreative Fähigkeiten geschult werden? Davis vertritt letztere Ansicht.
Die positiven Auswirkungen eines eingebildeten Freundes, glaubt Davis, machen sich auch dann noch bemerkbar, wenn dieser längst verschwunden ist – was in den meisten Fällen irgendwann von allein geschieht. Teenager, die in ihrer Kindheit einen ausgedachten Spielgefährten hatten, sind eher in der Lage, schwierige soziale Situationen zu meistern, zum Beispiel weil sie bei Problemen eher bereit sind, sich anderen zu öffnen, anstatt alles in sich hineinzufressen. Auch Übergangsphasen, etwa bei einem Schul- oder Klassenwechsel, stecken diese Teenager besser weg, sagt Davis: »Sie sind sozial besser entwickelt.« Selbst im Erwachsenenalter können die positiven Effekte eines imaginären Freundes noch spürbar sein, etwa durch eine höhere Kreativität und ein besseres emotionales Verständnis der Mitmenschen, wie etwa eine Studie von Tracy Gleason, Raceel Jarudi und Jonathan Cheek zeigte, die schon vor Jahren im Fachmagazin Social Behavior and Personality erschien.
Trotzdem ist es noch immer für viele Eltern beunruhigend, wenn das Kind von einem Freund erzählt, der nicht da ist. Sorgen um das geistige Wohl sind laut Davis aber unangebracht, vor allem auch, weil die überwältigende Mehrzahl der Kinder ganz genau weiß, dass ihr Begleiter nur ausgedacht ist. Der Tipp der Psychologin: gelassen bleiben, einfach mitspielen. So wie sie es mit ihrem Sohn Fisher und dem kleinen Crabby macht, der nach diversen gemeinsamen Urlauben nun dauerhaft bei Familie Davis wohnt, laut dem mittlerweile vierjährigen Fisher in einem Zimmer unter dem Dach. Bis er dann irgendwann verschwindet und nur noch als kreative Ader in Fisher weiterlebt.