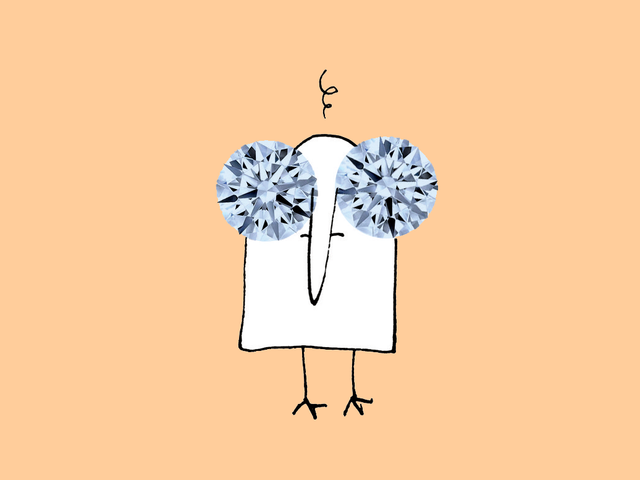In Deutschland ein Star, im Ausland interessiert sich kein Schwein dafür? Nein, die Rede ist nicht von Herbert Grönemeyer, sondern vom Spezi, das je nach Region auch Kalter Kaffee (Saarland), Moorwasser (Ostfriesland), Dünnpfiff (Norddeutschland) oder Diesel (Rheinland) genannt wird. Da, wo ich herkomme, aus dem Bayerischen Wald, sagt man Gwasch, was so viel heißt wie »Gewäsch« und für trübe Flüssigkeiten von einer zu dünn geratenen Suppe bis zu Spülmittel verwendet wird.
Die Sache mit dem Begriff ist übrigens gar nicht so einfach, weil Spezi beides ist: ein Markenname (seit 1956), aber auch ein Gattungsbegriff für alle mehr oder weniger genießbaren Mischungen aus Cola und Orangenlimonade, die tatsächlich fast ausschließlich im deutschsprachigen Raum angeboten werden. Schon eigenartig: Da dachte man immer, typisch deutsch seien Pünktlichkeit, Rammstein oder eine akkurat gestutzte Thujenhecke, dabei ist es ein kackbrauner Softdrink. Sämtliche Versuche, das Getränk im europäischen Ausland oder in Amerika einzuführen, sind gescheitert, im Wall Street Journal stand mal, Spezi schmecke wie Sumpfwasser mit Kohlensäure und sehe aus wie Hustensaft.
Meine Liebe zum Spezi begann in der Kindheit. Mein Vater war Arzt in einer kleinen Stadt, am Wochenende fuhren wir gemeinsam ein paar Dörfer, ein paar Wirtshäuser ab und hörten Heute im Stadion auf Bayern 1. Während er der Wirtin eine Spritze gegen die verfluchten Nackenschmerzen verpasste, hockte ich in der Stube und trank ein Gwasch und wenn ich Lust hatte: zwei. Im Winter stellte man mir einen kleinen Kupfereimer mit heißem Wasser dazu, zum Anwärmen, ich war ein kränklicher Junge.
Es ist tatsächlich so, dass ich die Bilder von damals alle noch in mir trage, die roten Gesichter der Männer am Stammtisch, die Schreie der Kartenspieler, die Kirchenglocken, die Dreschflegel und ausgestopften Fasane an der holzverkleideten Wand – eine Welt, die es fast nicht mehr gibt, eine Dorfgemeinschaft, ein Stück Herkunft, ein Stück Heimat. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich kein Bier, keinen Wein und eigentlich überhaupt keinen Alkohol trinke, wenn ich traurig bin, sondern Spezi – weil es mich so verlässlich tröstet, weil es mir ein Gefühl der Geborgenheit gibt, indem es mich mit etwas verknüpft, das größer ist als ich selbst: mit der Zeit, in der alles, aber auch wirklich alles in Ordnung war oder zumindest schien. Es sind diese Erinnerungen, die Spezi zu meinem absoluten Lieblingsgetränk machen. Wenn ich eines trinke, bin ich ganz bei mir, ohne doppelten Boden, ohne Show, ohne Kalkül. Ich trinke es verkatert, wenn ich die Nacht zuvor gefeiert habe (das Glas randvoll mit Eiswürfeln), ich trinke es nach 500 Kilometern auf der Autobahn, an irgendeiner Raststätte (aus der Dose, die ganz hinten im Kühlfach steht), ich trinke es, wenn ich meine Eltern besuche und wir in dem einzigen Wirtshaus von damals sitzen, das es noch gibt, wo tatsächlich noch derselbe Wirt am Zapfhahn steht, Mitte achtzig, leicht verwirrt, aber immer noch mit hochgekrempelten Hemdsärmeln und Pantoffeln.
Und ja, ich weiß, wie ungesund so ein Spezi ist. Mein Bauch wird immer dicker, die Zähne in ständiger Gefahr, von Karies zersetzt zu werden. Es ist ein bisschen provinziell, klebrig und viel zu süß – aber das ist mir vollkommen egal. Sollte ich eines Tages den Menschen, der mir ständig die Zeitung aus dem Briefkasten klaut, doch umbringen, für meine schändliche Tat in der Todeszelle landen und meine Henkersmahlzeit bestellen dürfen – ich müsste ausschließlich über das Essen nachdenken.