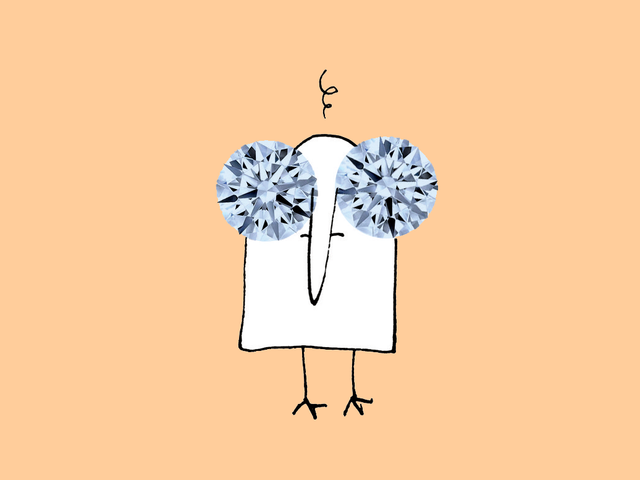Dass nun diese Katzen-Diva bei uns Gelassenheit und Fellflusen verteilt, gehörte bis vor Kurzem zu den Dingen, die man sich zwar vorstellen konnte, allerdings nicht in diesem Leben. Zu groß die Stadt, zu voll der Alltag, wohin mit dem Tierchen, wenn wir verreisen? Außerdem: Katzen fressen Fleisch, und die Herstellung von Katzenfutter trägt sicher nicht zur Rettung des Planeten bei. Das waren die Gründe, die wir den Kindern aufzählten, wenn sie wieder Zettel geschrieben hatten, auf denen sie festzuhalten bereit waren, dass allein sie sich um ein Haustier kümmern würden – füttern, streicheln, spielen, Katzenklo sauber machen. Sie schrieben alle paar Wochen neue Zettel, sie waren beharrlich. Ich war mit einer Katze aufgewachsen, ich weiß, wie sie zu dir hält, wenn alle Menschen um dich herum nerven. Aber jetzt wollte ich nicht als Type beäugt werden, die am Geburtstag des Haustiers Kuchen aus Leckerli bastelt, mehr noch: Ich hatte keine Lust auf den Spruch, wonach »das letzte Kind Fell« habe.
Dann kam es anders, zunächst. An einem bleistiftgrauen Tag im März, ein Jahr nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte, fragte die Nachbarin, ob wir einen großen schwarzen Kater mit Fluchtgeschichte aufnehmen könnten. Ihre Mutter habe ihn aus Odessa mitgebracht, er brauche dringend ein neues Zuhause. Als die Nachbarin uns den Kater brachte, untersuchte er jede Ecke seines neuen Territoriums, maunzte eine Weile, und am Abend sprang er zwischen uns aufs Sofa, rollte sich ein, ließ sich kraulen, es war um uns geschehen. Allerdings zeigte sich, dass mein Mann sich seine leichte Katzenallergie nicht ausgedacht hatte. Es brannten ihm die Augen, immer wieder nieste er und zog sich schließlich in ein Zimmer zurück. Als er früh am nächsten Morgen zu einer mehrtägigen Dienstreise aufbrach, hinterließ er uns einen Zettel, der klarmachte: Mit diesem Kater könne er leider nicht zusammenleben. Ich schloss das Thema Katze ab. Bis zu einem späten Nachmittag im Herbst.
Es war für den Monat ein erstaunlich blauer Tag, Menschen hockten auf den Gehwegen und tranken Kaffee. Ich war mit jemandem zum Interview verabredet. Mehrere Stunden hatten wir eingeplant. Wir fanden uns in einem ruhigen Raum zusammen. Mein Gesprächspartner wirkte gelöst, es sollte um seine Erfahrungen in der Kunstwelt gehen, von der er sich zu verabschieden gedachte, um schwierige wie auch wunderbare Menschen, denen er begegnet war, und wir wollten über die Kraft von Kunst sprechen.
Nach gut eineinhalb Stunden stockte er. Er wiederholte das Wort, das er eben ausgesprochen hatte. Mehrmals wiederholte er es. Ich sah, wie das Licht, das in seinen wasserhellen Augen geleuchtet hatte, erlosch. Er sank zur Seite. Die Sekunden dehnten sich auf. Ich schrie seinen Namen, rannte um den Tisch, um ihn zu stützen. Ein Kollege stürzte herbei, er begann die Herzmassage. Ich rannte aus dem Raum, rief um Hilfe. Kollegen riefen die Rettung. Andere schafften den Defibrillator herbei. Ich hörte, wie sie ihn einsetzten, wie das Gerät metallen zu ihnen sprach. Dann ein langer, hoher Ton, wahrscheinlich die Nulllinie. Im Nachhinein rekapitulierte ich, dass die Sanitäter innerhalb von sechs Minuten da gewesen sein müssen. Aber meine Zeitwahrnehmung war in eine andere Dimension katapultiert worden. In meiner Wahrnehmung standen zu viele Menschen wie Spielfiguren im Raum, starr. Einer trug absurd bunte Turnschuhe. Immer wieder dieser lange, hohe Ton. Ich entwickelte Hyperaktivität, rief mehrere Personen an, um Telefonnummern der Angehörigen meines Gesprächspartners herauszufinden, damit sie herkommen konnten, ihm beizustehen. Ich hörte die Nulllinie. Ich sprach mit einer Angehörigen, beschrieb ihr den Weg, informierte den Pförtner, dass er sie aufs Gelände ließ. Als sie ankam, waren die Sanitäter schon da, sie hatten Fläschchen mit durchsichtigen Flüssigkeiten auf den Tisch gestellt, an dem wir eben noch gesessen hatten, ihre Warnwesten blendeten neongelb, sie führten viele Handgriffe aus. Immer wieder die Nulllinie. Als sie ihn auf die Trage legten, um ihn in die Klinik zu fahren, überredete ich den Notarzt, seine Angehörige mitzunehmen. Sie ließ meine Hand nicht los, und so fuhr auch ich im Rettungswagen mit, durch den Feierabendverkehr, tanzende Rücklichter und zu helle Scheinwerfer.
»Vielleicht wollte ich mir zeigen, dass der Tod nicht mich gemeint hatte«
Der Notarzt trug ein großes Muttermal unter dem Auge. Als mein Gesprächspartner im Inneren der Klinik verschwunden war, wandte der Notarzt sich zu mir, versicherte, wir hätten alles getan, und wenn es noch eine minimale Chance für ihn gäbe, dann, weil meine Kollegen so beherzt gehandelt hätten. Mich wies er auf mögliche Nachwirkungen des Traumas hin. Ich solle gut essen, viel spazieren gehen, darauf gefasst sein, dass in den nächsten ein bis zwei Wochen alle Fähigkeiten, die nicht überlebensnotwendig seien, unterdrückt würden. Ich würde also wahrscheinlich nicht schreiben können. Später betrat ein Chefarzt den Raum, in dem wir warteten. Er sagte, er habe nichts mehr tun können. Als weitere Angehörige eintrafen, verließ ich die Klinik. Für sie würde sich nach dem Tod nun ihr Leben verändern.
In den folgenden Nächten schlief ich wenig. Auch darauf hatte mich der Arzt vorbereitet. Ich spürte keine Müdigkeit, der Körper musste die Stresshormone abbauen. Ich konnte tatsächlich nichts schreiben. Dafür kochen, einkaufen, aufräumen, ausmisten, zwei Gedanken entwickeln: Das Leben ist kurz. Ich brauche eine Katze.
Diesen Zusammenhang zu erklären fällt mir etwas schwer, denn ich hatte ja gute Gründe dagegen gesammelt, mit einer Katze zusammenzuleben – Verantwortung, Fellflusen, Kommentare von Bekannten, Alltag, Jagdtrieb, die armen Vögel. Aber es waren Einwände, die mit dem, was ich mir offenbar wünschte, nichts zu tun hatten. Der Tod schien diese Einwände in Bedeutungslosigkeit aufgelöst zu haben.
Nur einer hatte weiter Bestand. Ich brauchte eine Katze, die niemandem in unserer Familie die Augen tränen lässt. Jemand hatte mir erzählt, es solle bestimmte Katzenarten geben, die weniger Allergene verteilten, Kätzinnen weniger als Kater. Und überhaupt, so hieß es im Internet, seien Allergene individuell abhängig vom Tier, es dürfe nur keine ganz junge Katze mehr sein. Wissenschaftlich belegt war das alles nicht. Aber das Internet weiß, was man lesen will.
»Was man tun will, muss man jetzt tun. Das Leben geht vorbei, und manchmal sehr unerwartet«
Ich schlussfolgerte, mein Mann müsse nun verschiedene Katzen bei verschiedenen Züchtern besuchen, und irgendwann würde es eine geben, die kein Augenjucken bei ihm auslöste. Dann bräuchten wir bestimmtes Katzenfutter, das Allergene reduzieren soll, eine Fellbürste, eventuell einen Luftreiniger. Nicht aufschieben, nicht grübeln, sondern Ziel lokalisieren, Probleme erkennen und lösen, handeln, Ziel erreichen. Vielleicht lag das an den Stresshormonen.
Vielleicht aber wollte ich auch aktiv sein, um mir zu zeigen, dass der Tod nicht mich gemeint hatte, auch wenn ich dicht neben ihm gesessen hatte. Vielleicht hatte diese andere Zeitdimension, in die ich katapultiert worden war, mich fühlen lassen, was wir alle wissen: Das Unvorstellbare wird eintreten. Kinder wachsen und werden gehen. Was man tun will, muss man jetzt tun. Das Leben geht vorbei, und manchmal sehr unerwartet.
Seit jenem Nachmittag im Spätherbst rede ich nicht mehr davon, dass ich öfter schwimmen will, weil ich das Wasser liebe. Ich gehe schwimmen. Small Talk halte ich noch weniger aus, ich meide ihn. Ich treffe keine Verabredungen mit Menschen mehr, die ich nicht treffen muss oder treffen will. Ich gehe achtsamer mit meiner Zeit und der Zeit anderer um.
Und es ist noch etwas. Als an jenem Tag mein Gesprächspartner zur Seite sank, konnte ich mich nicht mit Gedanken aufhalten, was zu tun sei. Ich tat, was die Intuition nahelegte. Seitdem übe ich, ihr mehr zu vertrauen. Sie zeigt sich als Fiepen im Ohr, als Ziehen in der Magengegend, als Störgefühl. Sie zählt als guter Grund gegen etwas. Oder auch für etwas. Für eine Katze zum Beispiel.
Mein Mann war nicht von Stresshormonen durchflutet. Trotzdem stellte er sich darauf ein, jeweils eine Weile in einer fremden Wohnung mit einer fremden Katze zu verbringen. Er war sogar bereit, sich anschließend für mehrere Stunden einen Streifen mit Katzenhaar auf den Unterarm zu kleben, um zu prüfen, ob sich rote Pusteln entwickelten, wie im März, beim Fell des schwarzen Katers.

Wie ein Kuscheltier von der Tankstelle: die neue Mitbewohnerin unserer Autorin
Schon bei der ersten Katze blieb die Reaktion aus. Sie sehe aus wie ein Kuscheltier von der Tankstelle, sagte er, als er zu Hause den Klebestreifen von der unversehrten Haut pulte, plüschig, mit übergroßen Augen und kleiner Schnauze. Sie haare enorm. Ob das sein müsse? Ich fuhr los und besorgte einen potenten Staubsauger.
Und jetzt liegt sie auf dem Schreibtisch, auf der Tastatur, die Beine lang ausgestreckt, über Kreuz, elegant wie eine Filmdiva aus den Sechzigern. Sie blinzelt mit dem Jadegrün ihrer Augen, genießt, wenn sie am Hals gekrault wird, und sie beschenkt den Raum, den sie erwählt hat, mit der Gelassenheit, die nur Katzen zu eigen ist.