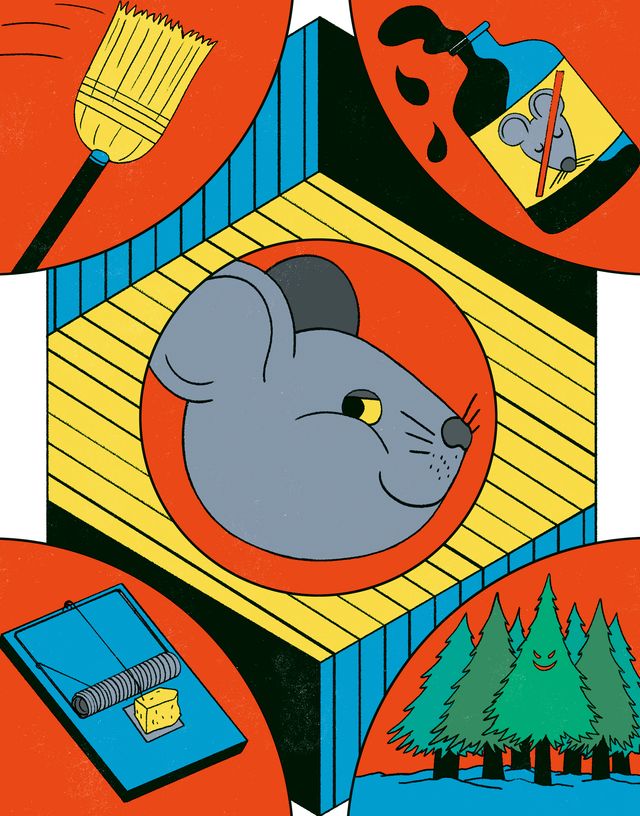Vielleicht hätte ich sie an dem Abend, an dem wir uns zum ersten Mal begegneten, töten sollen, kurz und schmerzlos, ein harter Schlag, einem ersten Impuls folgend. Sie saß in einem etwa fünf Zentimeter breiten Spalt zwischen unserem Kleiderschrank und der Wand in der Falle. Ich hatte ihr mit einem dicken Buch den einzigen Ausgang versperrt und einen Besenstiel in der Hand. Keine Ahnung, welcher Instinkt mich zu dieser Idee getrieben hatte. Als meine Freundin ins Zimmer kam, sagte sie erschrocken: »Was machst du da?« Und dann: »Bist du verrückt? Du kannst sie doch nicht erschlagen!« Neben ihr, das sah ich erst jetzt, stand unser zweijähriger Sohn. Er trug schon seinen Schlafanzug, auf den in Brusthöhe eine Maus gestickt ist. Er sagt dazu »Mauf«, und ich schmelze jedes Mal dahin. Eine Mauf mit einem Besenstiel umbringen? Sie überhaupt umbringen? Wer macht denn so was, dachte nun auch ich und legte den Stiel beiseite. Das Buch fiel dabei um, die Maus rannte ins Zimmer und dann tief unter unseren Kleiderschrank.
Was dann begann, lässt sich mit etwas Abstand als eine ungute Mischung aus Mitleid, Selbstliebe und Unwissen, ja Ignoranz beschreiben. Typisch für unsere Zeit, aber dumm.
Überzeugt, jetzt das Richtige zu tun, obwohl wir nicht lange darüber nachgedacht hatten, radelte ich am nächsten Morgen in den Baumarkt und kaufte eine sogenannte Lebendfalle: ein graues Plastikkästchen, in das die Maus mit-hilfe von Erdnussbutter gelockt werden sollte. Sei sie darin gefangen, könne man sie aus der Wohnung bringen – ohne sie anzufassen, ohne sie zu sehen und ohne ihr etwas anzutun, so versprach es der Hersteller, ein Schweizer Unternehmen. Auf der Packung stand noch der Hinweis, man solle die Maus mehr als einen Kilometer von der eigenen Wohnung entfernt freilassen, damit sie nicht zurückfindet.
Wir fühlten uns wohl mit dieser Falle, auch wenn sie in den ersten Tagen nicht den erhofften Erfolg brachte. Um den Kleiderschrank hatte ich mit Holzlatten eine Art Zaun errichtet, damit die Maus nicht in ein anderes Zimmer rennt. Innerhalb des Zauns stellten wir die Falle auf, daneben eine Schale mit Wasser, damit die Maus nicht verdurstet.

Jeden Morgen rannte unser Sohn zu dieser seltsamen Kleintierkoppel, um die Maus zu begrüßen: »Halloooo, Mauf!« Aus dem Schädling war in kürzester Zeit eine Art Haustier geworden, zumindest für ihn. Uns rührte das, obwohl wir ziemlich müde waren, denn die Maus weckte uns jede Nacht. Sie nagte dann an irgendwas. Der Schrankwand? Der Fußleiste? Es klang, als würde sich ein Biber an einem Baum zu schaffen machen. Jedes Mal stieg ich in Boxershorts aus dem Bett und legte mich bäuchlings auf den kalten Boden, presste mein Gesicht auf die Dielen und leuchtete mit einer Taschenlampe unter den Schrank, doch ich sah nur Staub und einen Socken. »Komm zurück ins Bett!«, rief meine Freundin dann. Ich würde der Maus Angst machen, meinte sie. Wir waren wütend auf die Maus, das schon, aber wir wollten es nicht an ihr auslassen. Das Nagen war Teil ihrer Natur, dachten wir. Was konnte sie dafür?
Nach sieben Tagen ging sie in die Falle. Sie hatte sich mittlerweile in die Küche geflüchtet, wir wissen nicht, wie und wann sie das geschafft hatte. Am Nachmittag hörten wir hinter dem Kühlschrank, in dem wir Bio-Milch und Fleisch aus »artgerechter Tierhaltung« lagern, ein Kratzen. Wir stellten die Falle auf und schlossen die Tür. Gegen ein Uhr in der Nacht schreckte ich aus dem Schlaf und hörte ein lautes Geklapper. Die Maus tobte in der Falle – aus Angst, so klang das. In dem Moment fiel mir auf, dass wir die Sache nicht zu Ende gedacht hatten: Wohin mit der Maus um so eine Zeit? Sollte ich jetzt einen Kilometer durch die Dunkelheit rennen?
Was dann geschah, dafür schäme ich mich etwas: Ich drückte mir Oropax in die Ohren und versuchte wieder einzuschlafen. Vielleicht hätte ich sie doch mit dem Besenstiel …, dachte ich.
Seit Jahrtausenden jagen Menschen Mäuse mit Fallen. Der Journalist Wolfhard Klein hat darüber ein Buch geschrieben, eine »Kulturgeschichte der Mausefalle«. Auch Lebendfallen seien seit dem Mittelalter eingesetzt worden, schreibt er. Allerdings habe man die gefangenen Mäuse anschließend erschlagen oder ersäuft. »Lebend« war also nur kurzfristig gemeint. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg und mit der zunehmenden Verstädterung seien Lebend-fallen so vermarktet und eingesetzt worden, wie wir es heute erwarten. Zu einer Zeit also, in der es normal wurde, Tiere nicht nur zu jagen, zu melken oder zu schlachten, sondern mit ihnen zu kuscheln, und in der eine Milliardenbranche rund um den »Heimtierbedarf« entstand. Unsere Maus ist vermutlich durch eines der Löcher, aus denen die Heizungsrohre in unsere Altbauwohnung laufen, zu uns gelangt. Wir hätten uns eine Maus aber auch in der nächsten Zoohandlung kaufen können.
Die Maus weckte uns jede Nacht. Wir waren wütend auf sie, aber wir wollten es nicht an ihr auslassen
In unserer Küche sah ich am Morgen die Spuren des Kampfes: Plastikraspel, die neben der Falle lagen. Unsere Maus hatte wohl versucht, sich in die Freiheit zu nagen. Jetzt war sie ruhig, vermutlich schlief sie. Ich griff nach der Falle wie nach einer vollen Windel, legte sie in einen Schuhkarton, steckte den Karton in eine Tüte und ging damit in den Hof, um mein Fahrrad zu holen. Es war halb acht und nieselte. Ich wusste, dass nun alles noch schlimmer würde, denn gleich nach dem Aufstehen hatte ich gegoogelt: »maus lebendfalle aussetzen wo«.
Fragt man den Deutschen Tierschutzbund, welche Methode sie empfehlen, um eine Maus aus einer Stadtwohnung wie der unseren zu schaffen, bekommt man die Antwort: Lebendfalle, ganz klar. Fragt man professionelle Schädlingsbekämpfer oder einen Amtstierarzt wie den vom Bezirk Berlin-Neukölln, in dem wir wohnen, klingt das anders: Lebendfalle? Katastrophe! Tierquälerei! Denn das Problem, auf das ich an dem Morgen beim Googeln bereits gestoßen war, ist: Wohin mit der Maus?
Unsere Maus war mit 99,9-prozentiger Sicherheit eine Hausmaus, die irgendwo im Gemäuer unseres Altbaus geboren worden war. Ihr Revier: vielleicht zwanzig Quadratmeter. Den Himmel hatte sie bisher nur durch unsere Fenster gesehen. Setze man so eine Maus auf der Straße aus, niste sie sich womöglich in der nächsten Wohnung ein, erklärte mir der Neuköllner Amtstierarzt. »Aber vermutlich stirbt sie, weil sie nicht an den neuen Lebensraum gewöhnt ist.« Und im Park? »Da hat sie überhaupt keine Chance.«
Tierliebe, das beschreibt der Psychoanalytiker und Hundebesitzer Jürgen Körner in mehreren Büchern, ist ein historisch recht junges und trügerisches Gefühl: Wir denken, unsere Hunde, Katzen, Hamster und Mäuse zu lieben, wir kaufen ihnen deshalb Futter mit Lachs und Rinderleber, Kissen und Spielzeug, wir baden sie und nehmen sie mit ins Bett, aber eigentlich lieben wir uns selbst – dafür, was für gute Menschen wir sind.
Nicht nur unsere Maus hatte in der Falle überleben sollen, sondern auch unser Selbstbild. Das vor allem.
Als ich auf dem Fahrrad saß, unsere Maus im Karton auf dem Gepäckträger, musste ich an meine Mutter denken: Wenn in meinem Kinderzimmer früher eine Spinne saß, kam sie mit dem Staubsauger angerückt. Flopp! Obwohl ich mich vor Spinnen ekle, fange ich sie heute mit einem Glas und einem Bierdeckel und bin darauf einigermaßen stolz. Anschließend halte ich das Glas aus dem Fenster und schüttele die Spinne hinaus. Wir wohnen im zweiten Stock. Ich habe nie gegoogelt, ob Spinnen so einen Sturz überleben. Ich will es gar nicht wissen.
Im Park angekommen, schaute ich mich um, ob mich jemand beobachtet. Ich wollte nicht dabei gesehen werden, wie ich die Maus in den sicheren Tod entlasse. Nur Großstadtidioten wie wir kaufen eine Lebendfalle, dachte ich. Und in dem Moment war mir nicht einmal klar, dass ich mich moralisch und juristisch schuldig machte. Denn das Tierschutzgesetz, erklärte mir der Amtstierarzt später, hätte es mir erlaubt, die Maus in unserer Wohnung zu töten, »wenn hierbei nicht mehr als unvermeidbare Schmerzen entstehen«. Also mit einer richtig eingesetzten Schlagfalle zum Beispiel. Diese Option sei aber verpufft, seit die Maus in der Lebendfalle saß. »Ab diesem Zeitpunkt haben Sie die Verantwortung, die Fürsorge für dieses wilde Tier übernommen und hätten es artgerecht behandeln müssen.« Das bedeute: kein Ertränken oder Erschlagen, kein Aussetzen im Park, kein Verfüttern an die Schlange im Terrarium eines Bekannten. Wir hätten die Maus wohl in unserer Wohnung wieder laufen lassen müssen.
»Warum werden Lebendfallen an Amateure wie mich überhaupt verkauft?«, fragte ich den Amtstierarzt. »Schuld hat immer der, der sie benutzt, nicht der, der sie anbietet«, antwortete er.
Unsere Maus schien immer noch zu schlafen, als ich die Falle im Park vorsichtig öffnete. Ich schüttelte. Nichts passierte. Ich blickte in das Plastikkästchen. Da war keine Maus. Das gibt es doch nicht, dachte ich. Sie hatte sich tatsächlich über Nacht aus der Falle gebissen. Sie war noch in unserer Wohnung.
Uns blieb nur noch die Kapitulation. Vor der Maus und uns selbst. Wir wollten sie und unser Gefühl der Verantwortung, in dem wir uns anfangs so gut gefallen hatten, endlich loswerden. Noch am selben Tag rief ich einen professionellen Schädlingsbekämpfer an. Er kam mit einem schwarzen Koffer, schmunzelte über unsere Geschichte und schob einen Köder mit Gift unter unseren Kleiderschrank, ohne nach unserer Meinung zu fragen. In der Nacht hörten wir Knabbergeräusche. Seitdem ist Ruhe.
Unser Schrank ist ein schweres Tischlerstück, wir können ihn nicht eigenhändig abbauen oder auch nur um einen Zentimeter verschieben. Aber vielleicht ziehen wir irgendwann um. Und vielleicht finden wir dann ein Mäuseskelett. Unserem Sohn haben wir versprochen, dass wir es dann im Park anständig beerdigen.