Nur fünf Websites werden weltweit häufiger besucht als die Online-Enzyklopädie Wikipedia, die damit knapp hinter Google und Facebook liegt, aber deutlich vor eBay und Tumblr. Der Unterschied zu diesen Milliardenunternehmen: Wikipedia macht keinen Gewinn, strebt ihn noch nicht einmal an. Es ist ein spendenfinanziertes Projekt. Und es wird von einer Frau geleitet – auch das ein Unterschied zu der von Männern dominierten Internetbranche: Sue Gardner steht an der Spitze der Wikimedia Foundation, einer Stiftung, die unter anderem die Wikipedia-Websites betreibt. Im Frühjahr hat sie überraschend angekündigt, diesen Job aufzugeben.
SZ-Magazin: Frau Gardner, um zu verstehen, was Sie bei Wikimedia erreicht haben: Wie sah die Organisation aus, als Sie vor sechs Jahren dort begonnen haben?
Sue Gardner: Damals arbeiteten sieben Leute für die Stiftung in einem kleinen Büro in St. Petersburg in Florida, das wir uns mit Steuerberatern und Immobilienmaklern geteilt haben. Über mein Einstellungsgespräch müssen wir heute noch lachen: Zwei Mitglieder des Stiftungsrats hatten mich in ein Café eingeladen. Die eine war eine Jurastudentin aus den USA, der andere machte irgendwas mit Technik und kam aus Holland. Der Stiftungsrat wird von den Wikipedia-Nutzern gewählt. Wir unterhielten uns eine Weile, und irgendwann meinten die beiden, ich sollte mal eine Runde um den Block gehen. Als ich wiederkam, sagten sie, dass sie mich mögen und ich den Job haben kann. Heute läuft das nicht mehr so ab, wir haben eine Personalabteilung und insgesamt 180 Mitarbeiter.
Sie sind mit der Stiftung nach San Francisco gezogen, also in die Nähe des Silicon Valley. Wie sieht es jetzt bei Ihnen aus?
Auf der einen Seite wie in einer typischen, jungen Technologiefirma: Alle sind superlässig angezogen, es gibt keine festen Arbeitsplätze, in der Küche stehen Essen und Getränke, die sich jeder umsonst nehmen kann. Abends veranstalten wir öfter Partys, mit Karaoke oder Filmvorführungen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch wie eine typische gemeinnützige Organisation. Wir sind radikal transparent, wir veröffentlichen alle unsere Finanzen. Die Mitarbeiter stellen sich regelmäßig online den Fragen der Wikipedia-Autoren und Spender. Manche Konferenzen streamen wir live im Internet.
Zum Verständnis: Die Mitarbeiter der Wikimedia Foundation kümmern sich um die Technik, die Server zum Beispiel, auch um Öffentlichkeitsarbeit und um rechtliche Fragen. Die Artikel selbst werden jedoch von denen geschrieben und korrigiert, die Lust darauf haben, im Endeffekt kann das jeder Mensch mit einem Internetzugang sein, Geld bekommt dafür niemand. Dennoch gibt es Wikipedia in mehr als 280 Sprachen und allein die deutsche Version hat etwa 1,6 Millionen Einträge. Warum wollen Sie dieses einzigartige Projekt nun verlassen?
Ich möchte mich stärker für ein freies und offenes Internet engagieren. Ich habe mir das Netz immer als eine Stadt vorgestellt. Und natürlich sollte es in dieser Stadt Kinos geben und Banken und Schuhgeschäfte und Plakatwände für Werbung, aber eben auch Büchereien und Schulen und öffentliche Parks. Unter den 50 meistbesuchten Websites der Welt ist Wikipedia aber im Moment die einzige, die nicht am Profit orientiert ist, sondern nur am öffentlichen Wohl.
Sie sind umzingelt von Google, Amazon und eBay. Wird das Internet zur Shopping Mall?
Ich denke schon. Ich habe nichts gegen diese Seiten, ich nutze sie selber, aber ihr vordringliches Ziel ist es nun mal, Geld zu verdienen. Dass sie den Menschen helfen, ist zweitranging. Ihre Dominanz hat in meinen Augen dazu geführt, dass das Ökosystem des Internets aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und noch eine andere Entwicklung, die damit zusammenhängt, stört mich: Das Großartige am Internet war doch mal, dass es den Leuten die grenzenlose Möglichkeit gibt, selber Inhalte zu produzieren, Blogs sind dafür nur ein Beispiel. Heute nutzen die Leute jedoch am liebsten Seiten, die ihre Ausdrucksmöglichkeiten beschneiden. In den USA verbringen die Menschen zehn Minuten von jeder Stunde, die sie online sind, auf Facebook. Dort können sie den »Gefällt mir«-Button klicken oder Inhalte verlinken, aber kaum noch eigene kreieren.
Drückt sich diese Tendenz der verringerten Möglichkeiten nicht auch in den neuen Geräten aus, mit denen wir das Internet betreten, den Tablets zum Beispiel?
Tablets wie das iPad sind Geräte ohne Tastatur, man kann mit ihnen wunderbar Videos gucken, aber nur schwer längere Texte schreiben. Sie sind für das Konsumieren optimiert, nicht für das Produzieren. Natürlich haben sie trotzdem ihre Berechtigung, nur wenn wir nicht aufpassen, verlieren wir die Möglichkeiten, die uns das Internet gibt. Die Geschichte der Medien hat sich bisher immer wiederholt, Tim Wu, ein amerikanischer Autor und Medienanalytiker, hat darauf in seinem großartigen Buch The Master Switch hingewiesen: Auch das Radio und das Fernsehen wurden in ihren Anfangstagen gefeiert, weil sie als Medien die Menschen verbinden und den
Informationsfluss befeuern. Völlig zu Recht. Ich habe mir alte Radioprogrammpläne durchgesehen: Da haben Uniprofessoren ihre Hörer in Mathematik unterrichtet. Heute sind Radio und Fernsehen zumindest in den USA Kommerzwüsten und werden von einigen wenigen Konzernen kontrolliert.
»Technologie ist die entscheidende Macht heute.«

Diese Monopolisierung hat auch in der Internetbranche längst stattgefunden. Aber kann man Unternehmen vorwerfen, erfolgreich zu sein?
Nein, wenn du ein profitorientiertes Unternehmen leitest, ist es natürlich dein Job, den Profit zu steigern, den Börsenwert zu maximieren. Und dazu gehört es auch, immer größer zu werden und sich Konkurrenz vom Leib zu halten. Im Silicon Valley haben wir deshalb im Moment die Situation, dass viele kleine innovative Technologie-firmen von den wenigen großen Konzernen aufgekauft werden – die Großen aber nichts mit den Innovationen machen. Sie legen sie geradezu auf Eis.
Als Google-Chef Eric Schmidt 2011 seinen Führungsposten aufgab, bekam er 100 Millionen Dollar in Google-Aktien als Abschiedsgeschenk. Wenn Sie nun bei Wikimedia aufhören: Was bekommen Sie?
Niemand arbeitet bei der Wikimedia Foundation, um reich zu werden. Ich nehme ein paar schöne Erinnerungen mit. Letztes Wochenende habe ich zum Beispiel stundenlang mit anderen Wikipedia-Autoren über den Artikel zu Bradley Manning diskutiert, dem Whistleblower. In meiner Freizeit arbeite ich selbst gern an Artikeln. Die Frage war, wie in dem Wikipedia-Eintrag Mannings Wunsch einer Geschlechtsumwandlung berücksichtigt wird und dass er nun Chelsea Manning heißen will.
Und?
Der Eintrag wurde erst in Chelsea Manning umbenannt und dann wieder in Bradley Manning. Ich finde das falsch, aber es war Mehrheitsmeinung.
Auf der Wikimedia-Website kann man in einem Bericht nachlesen, dass Sie etwa 200 000 Dollar im Jahr verdienen. Werden Sie von den Apple- und Facebook-Managern eigentlich belächelt, dass Sie keine Millionärin sind?
Doch, ich denke schon. Und viele sind richtig perplex, dass Wikipedia eine halbe Milliarde Leser im Monat hat und wir nicht versuchen, daraus Gewinn zu schlagen. Aber ich erinnere mich auch noch gut an ein Interview, das ein junger Facebook-Mitarbeiter einmal gegeben hat. Er war ein Überflieger, hat richtig Karriere gemacht, sagte dann aber diesen tollen Satz: »Die besten Köpfe meiner Generation denken nur noch darüber nach, wie man Menschen dazu verleitet, auf Werbung zu klicken. Das ist doch beschissen.« Und ich finde, er hat recht.
Der New Yorker hat neulich beschrieben, wie das soziale Leben in San Francisco wegen der Tausenden Silicon-Valley-Millionäre immer mehr auseinanderdriftet. Die Mieten steigen ins Unbezahlbare. Wie ist Ihr Eindruck?
Viele Menschen aus der Technologiebranche leben hier in einer Art Blase. Sie fahren mit dem Google-Bus zur Arbeit, ihre Wäsche wird abgeholt, sie müssen noch nicht mal mehr zum Friseur gehen, weil der bei ihnen im Büro vorbeikommt. Ich glaube, diese Abschottung wirkt sich auch auf die Produkte aus, die diese Menschen entwickeln. Das lässt sich vor allem an den Apps beobachten, die hier entstehen. Eine sehr erfolgreiche App ist zum Beispiel Uber, die es einfacher macht, ein Taxi zu bekommen …
… vor allem Luxusautos wie die Mercedes-S-Klasse oder einen 7er BMW.
Die App ist fantastisch, aber sie löst natürlich ein Problem für Menschen, die eigentlich keine Probleme haben.
Unter den zehn meistbesuchten Websites der Welt gibt es nur zwei, an deren Spitze eine Frau steht: Yahoo wird von Marissa Mayers geleitet und Wikipedia von Ihnen. Ist die Männerdominanz ein Problem?
Definitiv! Technologie ist die entscheidende Macht heute. Aber bisher wird sie fast ausschließlich von Männern erdacht, entwickelt und vermarktet. Ich denke, dass es eine größere und spannendere Vielfalt an technologischen Produkten geben könnte, wenn mehr Frauen in der Branche engagiert wären, nicht nur im Management, sondern auch als Programmiererinnen und Ingenieurinnen.
Eines Ihrer Ziele bei Wikipedia war es, auch dort mehr Frauen als Autorinnen zu gewinnen, denn bisher lag deren Anteil bei zehn bis 15 Prozent. Ist Ihnen das gelungen?
Nein, das braucht Zeit. Sich bei Wikipedia zu engagieren ist ein absoluter Minderheitengeschmack. Auch 99 Prozent der Männer werden nie im Leben einen Artikel schreiben. Es bedarf gewisser Charakterzüge, um daran Gefallen zu finden: Man muss ein wenig pedantisch sein und die Recherche mögen, man braucht technisches Verständnis und relativ viel Freizeit. Die meisten Autoren sind Geeks: junge, technisch interessierte Menschen. Eine breite Marketingkampagne für Frauen wäre deshalb falsch. Wir versuchen stattdessen gezielt, mit Universitäten in Kontakt zu treten, damit zum Beispiel die Professoren mit ihren Studenten an Artikeln arbeiten. So entdecken vielleicht mehr Frauen ihr Interesse daran. Es wäre sehr wichtig, denn Wikipedia ist stark bei Themen wie Mathematik oder Technik, aber schwach, wenn es um Feminismus, Gender-Theorie, aber auch Mode geht.
Über eine Gefahr, die unsere Freiheit im Internet bedroht, haben wir noch gar nicht gesprochen: die staatliche Überwachung. Waren Sie überrascht, als Edward Snowden die Methoden des amerikanischen Geheimdienstes NSA aufgedeckt hat?
Ja, die Dimensionen haben mich sehr gewundert.
Was antworten Sie Menschen, die sagen: Ich bin kein Terrorist und kein Verbrecher, wenn ich überwacht werde – was solls.
Das ist eine gefährliche Argumentation. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es so viele Gesetze gibt, dass wir ständig Gefahr laufen, eins zu brechen. Die Frage ist, welche durchgesetzt werden – und das kann sich ständig ändern. Die Überwachung macht also jeden verletzlich.
Durch den NSA-Skandal ist auch die Infrastruktur des Internets in den Fokus geraten: die Kabel, durch welche die Daten weltweit verschickt werden. Netzaktivisten kritisieren manche Kabelbetreiber schon lange dafür, dass sie ein Zwei-Klassen-Netz einführen wollen. Was meinen die Netzaktivisten damit?
Das ist ein kompliziertes Thema, das sich vor allem um den Begriff der Netzneutralität dreht. Die grundlegende Frage ist, ob wir das Internet als öffentlichen Raum behalten wollen, als eine Stadt mit einem Netz von Straßen, auf denen sich jeder bewegen kann. Oder ob wir das Internet als privates Gut betrachten. Dann würden über kurz oder lang die, die mehr bezahlen, ein besseres Netz bekommen als die weniger Privilegierten. Für mich ist die Netzneutralität sehr wichtig, und ich denke, dass es Regeln geben sollte, damit das Internet ein öffentlicher Raum bleibt.
Zu Beginn haben Sie gesagt, dass Wikipedia als gemeinnütziges Internetprojekt ziemlich allein dasteht. Gibt es keine anderen spannenden Websites dieser Art?
Doch, natürlich. Mir gefällt zum Beispiel »Terms of Service; Didnt Read«, das ein junger Deutscher mitentwickelt hat. Die Idee dahinter ist ganz einfach: Kaum jemand liest die Nutzungsbedingungen von Websites, von Google oder Facebook.
Weil sie viel zu lang und kompliziert sind.
Genau. »Terms of Service; Didnt Read« bietet nun zwei Dinge: Einerseits eine Online-Plattform, auf der man die Nutzungsbedingungen großer Websites bewerten kann. Anderseits ein kleines, kostenloses Programm, das diese Bewertungen automatisch einblendet, wenn man zum Beispiel die Google- oder Facebook-Seite besucht. Das Ganze ist ein spendenfinanziertes Projekt. Und ein sehr wichtiger öffentlicher Service.
Die zehn meistbesuchten Websites der Welt*
1 google.com
2 facebook.com
3 youtube.com
4 yahoo.com
5 baidu.com
6 wikipedia.org
7 qq.com
8 linkedin.com
9 live.com
10 twitter.com
*laut www.alexa.com, Stand: 1. Oktober 2013
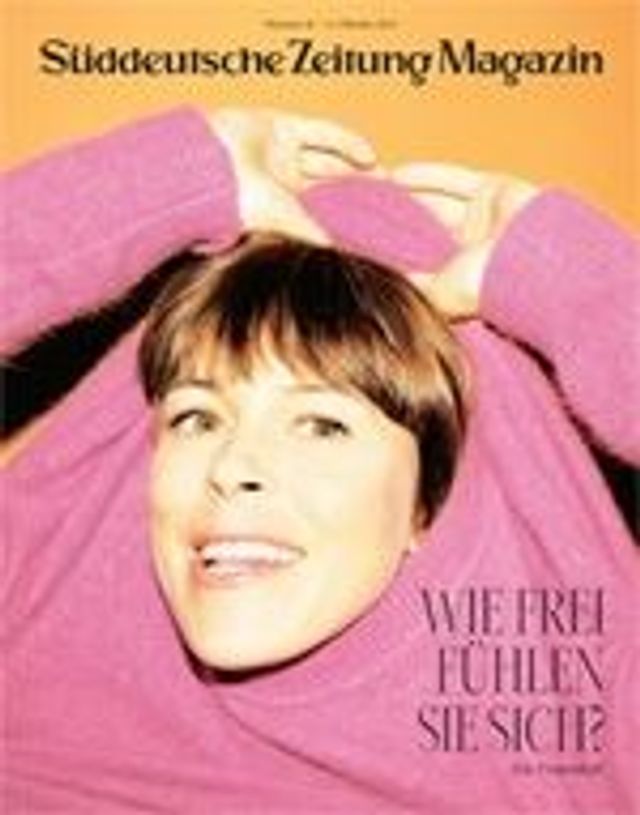
Dieser Artikel erscheint im heutigen SZ-Magazin: Ein Heft zum Thema Frauen und Freiheit – sehen Sie hier schon alle Themen.
Foto: Victoria Will







