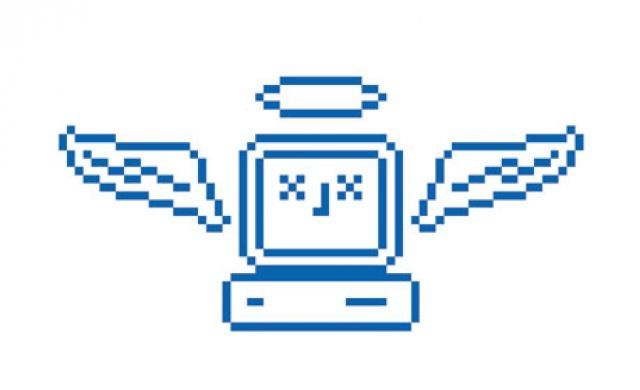Anfang März 2009 hat Michael Krähmüller seinem Sohn Matthias ins Ohr geflüstert: »Du musst nicht weiterleben, wenn du nicht mehr kannst.« Matthias, zwanzig Jahre alt, konnte nicht mehr, nach zwei Jahren war der Kampf gegen die Leukämie aussichtslos geworden. Am nächsten Tag war er tot. Wie die meisten Zwanzigjährigen hatte Matthias Krähmüller einen Großteil seines Lebens im Internet dokumentiert, er hatte mehrere E-Mail-Adressen und war Mitglied beim Online-Netzwerk Lokalisten. Vor ein paar Jahren noch hätte sein Vater vielleicht Tagebücher oder Briefe seines Sohnes gefunden, jetzt fand er Beileidswünsche auf der virtuellen Pinnwand von Matthias. »Mein Sohn hatte ein richtiges Leben im Internet«, sagt Michael Krähmüller, »das hat mir Kraft gegeben.«
Bald gibt es in Deutschland mehr Mitglieder in sozialen Netzwerken als Festnetzanschlüsse. Wer stirbt, hinterlässt Daten, gespeichert auf der ganzen Welt. Und im Umgang mit den Daten seiner Toten zeigt sich das Internet von seiner schlechtesten Seite: Es ist unübersichtlich, verletzend, oft auch ziemlich teuer. Das fängt mit Fundstücken im Netz an, die »Angehörige negativ überraschen können«, wie der Bundesverband Informationswirtschaft in einem Ratgeber für Hinterbliebene warnt – zum Beispiel, dass der tote Ehemann Mitglied bei einer Seitensprung-Website war.
Dann gibt es Fälle wie bei Christoph Schlingensief, der Facebook-Nutzern auch nach seinem Tod noch als Freund vorgeschlagen wurde. Und wirklich hart wird es, wenn Angehörige auf die Daten von Verstorbenen zugreifen wollen: Fast alle Internetfirmen haben dafür ihre eigenen Regeln. Man muss länger suchen, um herauszufinden, dass man eine beglaubigte und ins Englische übersetzte Kopie von Sterbeurkunde und Erbschein zu Google nach Kalifornien schicken muss, um E-Mails bei Gmail zu lesen. Ansprechpartner in Deutschland gibt es nicht. Bei Twitter kann man – ebenfalls nur per Post oder Fax nach Amerika – die Stilllegung des Kontos beantragen, private Nachrichten sind dann nicht mehr lesbar. Und Netzwerke wie Facebook schalten die Seiten von Verstorbenen in einen sogenannten Erinnerungsmodus, sobald sich Hinterbliebene dort melden. Dann können Freunde und Familie noch letzte Beileidswünsche unter das Bild des Verstorbenen schreiben, aber alle persönlichen Nachrichten des Toten werden gelöscht.
Michael Krähmüller sagt: »Ich will selbst bestimmen können, was mit dem Profil von Matthias passiert.« Er hat das Recht dazu, als Erbe gehört ihm auch der digitale Nachlass. Aber bis ein Erbschein ausgestellt ist, haben manche E-Mail-Anbieter die Postfächer schon gelöscht, das passiert automatisch nach wenigen Monaten, wenn sich niemand einloggt. Pro Jahr sterben in Deutschland rund 850 000 Menschen, aber bei den größten deutschen E-Mail-Diensten GMX und Web.de werden nur etwa 2000 Postfächer an Erben übergeben. Dabei hat der elektronische Posteingang längst die Rolle der Schreibtischschublade übernommen, als Sammelstelle für Bankdaten, Versicherungsbelege, Nachrichten, die Adressen von Freunden. Alles Dinge, die in der Zeit nach dem Tod sehr hilfreich sein können.
Weil es heute dazugehört, nach dem Tod nicht nur Zeitungsabos, sondern auch Online-Accounts zu kündigen, gibt es Firmen wie Legacy Locker oder Stayalive, die sich um den digitalen Nachlass kümmern. Sie vermieten eine Art Tresor im Internet, dort kann man alle Kennwörter hinterlegen und bestimmen, wer dieses Online-Erbe nach dem Tod sehen darf. So muss niemand auf einen Erbschein warten, und manche Nachrichten bleiben für immer privat, denn nicht jedes Online-Profil und jede flüchtige Mail sind ja für die Nachwelt bestimmt. Bis zu 500 Euro kostet der Service. Aber was, wenn so eine Firma noch zu Lebzeiten pleitegeht? Matthias Krähmüller hat es seiner Familie leichter gemacht: Er hat drei Monate vor seinem Tod alle Passwörter aufgeschrieben. So konnte Michael Krähmüller die E-Mails seines Sohnes lesen und sehen, dass er noch vom Krankenbett aus Texte auf seiner Lokalisten-Seite hinterlassen hatte. Als Motto stand dort: »Leb dein Leben so wie du es willst, es kann jeden Moment vorbei sein.«
Hier schreibt Max Scharnigg über das Leben im Internet.
Illustration: Dirk Schmidt