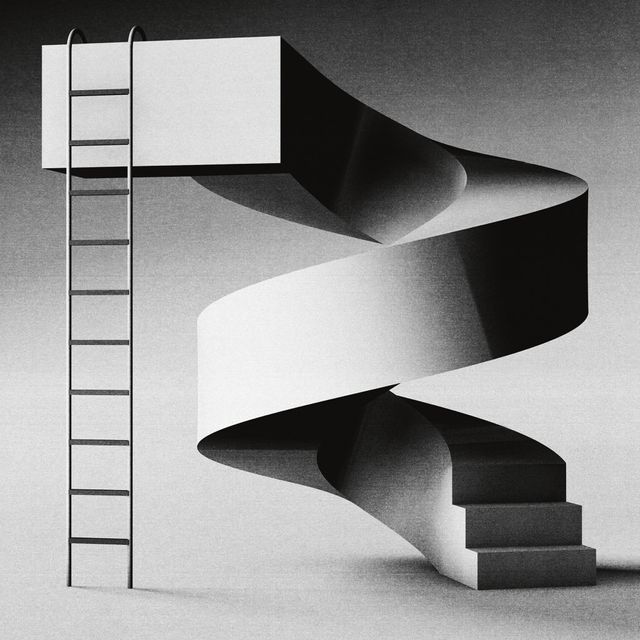Neben Vogelkunde, Französisch und Karaoke-Singen gehört die Ökonomie zu den Dingen, von denen ich am wenigsten Ahnung habe. Einmal lachte mich mein Chefredakteur aus, als ich meinte, dass ich den Plot von Bad Banks bis heute nicht ganz verstanden habe, einer Fernsehserie, in der ständig irgendjemand Geld auf wundersame Weise vermehren muss, egal wie. Mich fesselte die Serie eher aus anthropologischen Gründen, um zu verstehen, was Geld aus Menschen machen kann. Heute weiß ich: Auch eine Pandemie hält niemanden davon ab, einen guten Schnitt machen zu wollen, und sei es mit zwielichtigen Maskendeals.
Was das Geldvermehren angeht, bin ich ein blutiger Anfänger. Ich habe nie eine Aktie besessen, kenne Bankberater nur aus der Fernsehwerbung und schiebe die paar Euros, die einem als einfacher Angestellter in einer Stadt wie München bleiben, brav jeden Monat auf ein Tagesgeldkonto. Nicht für mich, sondern für meine Kinder, damit sie dereinst ein kleiner warmer Geldschauer empfangen, wenn der Ernst des Lebens beginnt. Vor allem aber in der Hoffnung, dass sie ihrem treusorgenden Vater dann aus Dank ein letztes Mal um den Hals fallen.
Glaubt man Finanzfachleuten, könnte nichts unvernünftiger sein, denn Tagesgeldkonten werfen, wenn überhaupt, nur noch mikroskopische Renditen ab. Bei mir waren es bis vor Kurzem 0,1 Prozent. Bald, so war meine Sorge, könnte der Zins ins Negative rutschen, so wie bei vielen Banken schon geschehen. Dann wäre ich der Rabenvater, der das Geld seiner Kinder schröpft, anstatt es zu mehren. Aber es kam anders. Die Bank kündigte mir, sie stieß mich ab wie unnötigen Ballast.
Seit Negativzinsen zur Normalität geworden sind, machen sich in Deutschland Angst und Empörung breit
Seit Negativzinsen auf Sparkonten von einer Drohung zur Normalität geworden sind, machen sich in Deutschland Angst und Empörung breit. Von schleichender Enteignung ist die Rede, von Bankenwillkür, von Strafgebühren. Das ist verständlich in einem Land, in dem das Sparen zur kulturellen Identität gehört. Laut Bundesbank verfügen die Deutschen über ein Geldvermögen von rund 7,1 Billionen Euro, ein großer Teil davon liegt auf Sparbüchern und Tagesgeldkonten. Der Sparer erwartet, dass dieses Geld »arbeitet«, sprich Gewinne abwirft. So war es seit jeher, so haben wir es gelernt. Ein Ausbleiben von Zinsen oder sogar Verluste sind in dieser Gleichung nicht vorgesehen. Der Finanzrechtler Paul Kirchhof geht noch weiter. Negativzinsen, sagt Kirchhof, seien verfassungswidrig. Schon fangen Verbraucherschützer an, Banken wegen Strafzinsen zu verklagen.
Es mag an meinem kleinen Sparvermögen liegen, aber ich habe aufgehört, mich darüber aufzuregen. Irgendetwas in mir findet, dass vor allem die Sparenden dafür verantwortlich sind, dass sich das eigene Geld vermehrt, nicht die Bank. Durch beständigen frischen Nachschub zum Beispiel. Für mich ist ein Konto in erster Linie das, was dem Eichhörnchen sein geheimes Erdloch ist: ein gut gesicherter Ablageplatz.
Mein nächstes Tagesgeldkonto suche ich nur noch nach Krisenbeständigkeit, also ihrer Einlagensicherung aus, das Thema Zinsen hat sich ohnehin erledigt.
Das war nicht immer so. Als ich 2007 anfing, monatlich was zur Seite zu legen – meine Tochter war gerade geboren –, freute auch ich mich über die drei Prozent, die es aufs Tagesgeld gab. Ich rechnete Zins und Zinseszins auf projizierte 18 Jahre aus und war überzeugt, ein Bombengeschäft gemacht zu haben. Dabei galt einer wie ich damals als Zauderer. Es war die goldene Zeit des Investmentbankings, in der alle ihr Stück vom Kuchen wollten. Viele meiner Bekannten investierten in Aktien. Kollegen prahlten beim Mittagessen mit ihren Kursen, deren Entwicklung sie stündlich prüften. Es war wie ein Fieber. Sogar mein Vater riet mir damals zu einem fein justierten Portfolio aus Bausparverträgen, Aktiendepots und Schiffsanleihen, einem Mix, mit dem er seit Jahren stattliche Gewinne einfuhr, als Rentner. Fast hätte er mich so weit gehabt, da platzte die Blase. Und ich war froh, auf der richtigen Seite geblieben zu sein.
Ich fühlte mich bei meiner Bank wie in einem sicheren Hafen, während um mich herum eine Welt unterging. Dafür bekam ich nun immer öfter automatisierte E-Mails mit neuen, gesunkenen Zinssätzen. Ich wechselte von einer Bank zur nächsten, nur um dort ein Zehntelprozent mehr abzugreifen. Als der Zins auf unter zwei Prozent fiel, machte sich bei mir ein Verlierergefühl breit. Mein Geld stellte das Arbeiten ein, und ich verstand nicht, warum.
Auf der Suche nach Antworten begann ich, den Wirtschaftsteil der Zeitung zu lesen. Ich las von Leitzinsen, Sparschwemme und Vermögenspreisblasenproblemen. Ich begriff nicht viel, nur dass alles irgendwie mit allem zusammenhängt, und dass es nie mehr werden würde, wie es war. Selbst die schönen Zinsen, musste ich lernen, waren nur Augenwischerei, ein Nullsummenspiel auf lange Sicht, denn hohe Habenzinsen auf der Bank korrelierten fast immer mit hoher Inflationsrate im echten Leben. Was einem die Bank gutschreibt, geht einem an der Supermarktkasse wieder flöten, ohne dass man es merkt. Steigende Preise nimmt man als höhere Gewalt hin, sinkende Zinsen aber lastet man der Bank an. Am Rat der Finanzfachleute änderte sich wenig: Statt sein Geld auf dem Konto zu parken, solle man es besser an der Börse anlegen oder – ja, warum denn nicht – verprassen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Der Sparer, früher noch Tugendvorbild, war plötzlich der Dumme.
Freunde rieten mir, eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu bauen. Das rechne sich immer. Sie zeigten mir Computeranimationen ihres Rohbaus und schwärmten von Planungs-Apps, die den Einfall des Sonnenlichts simulieren könnten. Auf meine Frage, von welchem Geld ich das bezahlen soll, sagten sie, auf Pump. Kredite gebe es derzeit schließlich zum Nulltarif. Doch da, wo andere eine clevere Wette auf die Zukunft sehen, sehe ich nur drückende Schulden. Ich schlafe lieber gut.
Nur dank Zinsen würden obszöne Vermögen überhaupt erst möglich
Ich finde, das Sparen um des Sparens willen ist zu Unrecht in Verruf geraten. Man darf es sich von den Predigern des Neoliberalismus nicht miesmachen lassen. Menschheitsgeschichtlich lag man damit nie falsch: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. So hat es der Bauer in Kriegs- und Krisenzeiten gehalten, so hält es der Hamster bis heute. Ein Anspruch auf Gewinn leitet sich daraus nicht zwangsläufig ab. Wer das einmal verinnerlicht hat, lässt sich von fallenden Zinsen nicht mehr aus der Ruhe bringen. Erst mit der Einführung der Geldwirtschaft und des Zinsprinzips wurde das Sparen zum Selbstzweck, für nicht wenige sogar zum Geschäftsmodell. Vorausgesetzt, man hat genug. Es gibt Volkswirte, die glauben, ohne Zinsen als Anreiz würde niemand mehr sparen wollen. Mir genügt als Anreiz, nicht mit blanken Händen dazustehen, wenn meine Kinder ihre ersten Wohnungen einrichten.
Der Philosoph Andreas Brenner findet, Zinsen verstärken die Ungleichheit in der Gesellschaft. Wer schon hat, dem wird auch noch gegeben. Ohne Arbeit. Nur dank Zinsen würden obszöne Vermögen überhaupt erst möglich. Brenner plädiert für ein Zinsverbot, dann wäre das Wirtschaftswachstum wieder an die Realwirtschaft gekoppelt.
Ich gönne jedem seinen Zinsertrag. Aber beim Sparen im eigentlichen Sinne, also dem vorausschauenden Anlegen eines Vorrats für die Zukunft, spielt er für mich keine Rolle. Das ist eine Privatangelegenheit, die man mit sich selbst ausmachen muss. Ein Akt der Verantwortung gegen die Unwägbarkeiten des Daseins. Entsagung gehört zum Sparen, manchmal gilt das sogar für Verluste.
Denke ich ans Sparen, fällt mir meine Oma ein. Sie war, glaube ich, in ihrem Leben fünfmal im Urlaub gewesen, hatte nie ein Auto besessen und sich auch sonst nichts geschenkt. Im Geld-auf-die-Seite-Legen aber war sie unübertroffen. Sie bunkerte es vornehmlich in Schubladen. Sie trotzte es dem Leben ab, einem Leben auf Sparflamme. So brachte sie es zu einem Haus mit Garten. Nie wäre sie auf die Idee gekommen, dass sich Geld von allein zu vermehren habe.