Stricken? Natürlich strickte niemand auf dem Parteitag in Rostock. Lange vorbei. Die Grünen sind eine Partei wie jede andere, die Einzigen, die das immer noch nicht richtig wahrhaben wollen, sind die Grünen selbst. Renate Künast stand bei den Journalisten und ließ ein paar Informationen in ihre Hemdkragen fallen, danach kam Sven Giegold, der früher mal bei Attac war, danach Tarek Al-Wazir, der Versöhner mit der sanften Stimme. Das ganz normale Taktieren auf so einem Parteitag? Ich saß in der letzten Reihe und fühlte, wie der Sauerstoff aus dem Saal entwich.
Die anderen Journalisten waren alle Parteitagsprofis, aber jetzt waren auch sie ein wenig irritiert. Was denn? All die kritischen Anträge sollten zurückgezogen werden? Statt der großen Aussprache, statt des gemeinsamen Nachdenkens darüber, wie es weitergehen soll mit den Grünen – nur eine lustlose Selbstfeier der Parteiführung? »Die haben Angst«, zischelte eine Funktionärsstimme hinter mir. Angst raubt einem die Luft. Die Grünen sind eine Partei wie alle anderen; die Frage ist, was das für Konsequenzen hat.
»Linke Mitte«, das wollen sie sein, das war die Botschaft von Rostock. »Linke Mitte«, da stöhnt jemand wie Ludger Volmer auf, »das ist fast ein Aufruf zum Parteiaustritt. Das bedeutet Klientelpolitik für das linke Bürgertum. Als wir die Partei 1980 gründeten, wollten wir Mitte-Links sein, das ist etwas ganz anderes. Es ging uns darum, zwischen den Unter- und den Mittelschichten einen Interessenausgleich herzustellen. Wir nannten das den ökologisch-solidarischen Gesellschaftsvertrag. Heute heißt das, vollkommen verflacht: Grüner New Deal.« Volmer ist jemand, der das alte, linke Wort »dialektisch« in den Mund nimmt, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Er wirkt gut gelaunt, obwohl sein Abschied nach 25 Jahren Politik nicht gerade glorreich war. Er ist ein Veteran und neigt als solcher ein wenig zur Melancholie. Im Dezember erscheint sein Buch über die Grünen, »eine Bilanz«, sagt er. Und? »Der GAU war 1994, als es unter Joschka Fischer eine gezielte Diskursverschiebung gab. Die grüne FDP, die ökologische Bürgerrechtspartei. Das war eine strategische Selbstkastration. Damit hat man freiwillig Platz gemacht für die Linke und das soziale Profil aufgegeben.«
30 Jahre alt werden die Grünen im Januar 2010, irgendwie drohend schwebte dieses Datum auch über dem Rostocker Parteitag, Ende Oktober. Sie hatten die Bundestagswahl gewonnen, ohne sie zu gewinnen.
10,7 Prozent, das beste Wahlergebnis jemals. Und jetzt saßen sie alle da und trauten sich überhaupt nichts mehr zu. Keine Debatten, keine Diskussionen. Unbehagen an der eigenen Unmotiviertheit, und eine Parteispitze, deren Mitglieder »Kampfschweine« genannt werden. Ein echtes Generationendrama: Die Alten versuchen, ihr rot-grünes Erbe zu retten. Die Noch-nicht-Alten sagen, dass Rot-Grün eh nicht ihr Projekt war. Und die Jungen fragen: Projekt, was für ein Projekt?
Diesen ganzen Wirrwarr hätte man in Rostock klären können, klären müssen. Ein Neuanfang im Schatten von Schwarz-Gelb. Klare Konturen, neue Konstellationen im Fünf-Parteien-System. Der Mut zu Jamaika und zu Schwarz-Grün. Umworben von den jüngeren Machtstrategen der CDU, denen mit den randlosen Brillen. Eine SPD, die in sich zusammenfällt, der alte Feind, denn gegen die SPD wurden die Grünen ja 1980 gegründet. Und eine Linke, die die Grünen allerdings genauso ratlos macht wie die SPD. Aber das ist der traurige grüne Realismus 2009: Die Jungen träumen wieder von einem Projekt, die Alten machen weiter Politik.
Und so ist ausgerechnet diese Generationenpartei in Lager gespalten, die sich anhand von Altersgrenzen ziehen lassen. Dabei sind die Fragen, die Gesine Agena oder Max Löffler stellen, die beiden Vorsitzenden der Grünen Jugend, gar nicht so viel anders als die Fragen von Ludger Volmer. Im grünen Schlüsseljahr 1994 kamen Agena und Löffler gerade mal in die Schule, ihr politischer Horizont war immer schon rot-grün eingefärbt. Kohl kennen sie nicht einmal mehr als Schatten und Worte wie »Wirtschaftsdemokratie« nur aus den Büchern. »Bei dem Wort werden die Jungen immer ganz hellhörig«, sagt Volmer, »die internationale Finanzpolitik war mal eine grüne Domäne. Das wurde alles von Fischer abgeräumt, als er 1994 gesagt hat, Wachstum ist gut, weil nur so Arbeitsplätze geschaffen werden. Und von der Fraktion gab es dafür Beifall.«
Was junge Grüne wie Agena und Löffler mit jemandem wie Volmer verbindet, ist die Unzufriedenheit mit den einfachen Antworten, mit dem auch innerparteilichen Taktieren, mit Pragmatismus als Entschuldigung für Ideenarmut. Auf dem Parteitag von Rostock erschöpfte sich das in der Diskussion um Worte: »Offenheit«, das war ein gutes Wort, das suggerierte Selbstbewusstsein und ließ die Tür zur CDU angelehnt, ohne sich irgendwie festlegen zu müssen. »Scharnier«, das war ein böses Wort, das stand für die FDP-Werdung, die Grünen als Mehrheitsbeschaffer, als Funktionspartei. Der Politikwissenschaftler Franz Walter sah die Grünen schon 2006 in der Krise und sprach vom »Karneval der Chamäleons«.
Um zu klären, wer sie sind, sprachen die Grünen auch in Rostock oft vom Milieu. Fast nur Mittelschichtgesichter waren da in den Reihen zu sehen, praktisch kein Migrant, wie man heute sagt. Die Grünen sträuben sich nur noch zum Schein dagegen, dass sie die Partei der Besserverdienenden und der Besserdenkenden sind. Sie verkaufen das gern als Notwendigkeit, als Spiegel des gesellschaftlichen Wandels. Aber langsam wird klar, was die Grünen dadurch verloren haben. Auffallend oft hört man, dass die Partei die Sozialpolitik vernachlässigt habe, dass sie sich nur auf das Wohlfühlthema Ökologie verlassen habe, dass sie den Arbeitsbegriff nicht konstruktiv hinterfragt habe, dass mit dem bisherigen Personal keine Erneuerung möglich sei, dass die Grabenkämpfe zwischen grünen Fraktionen abschreckend seien für junge Wähler. »Die sind nicht politikverdrossen«, sagt Max Löffler, 21, »die sind parteienverdrossen.
(Lesen Sie auf der nächsten Seite: Die Identitätskrise der Grünen sagt auch etwas aus über den Zustand der Politik allgemein.)
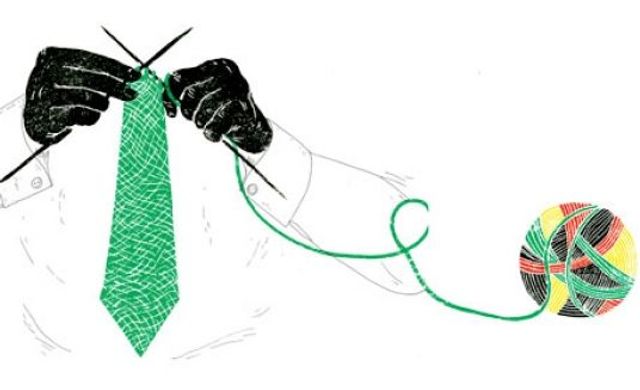
«Viele engagieren sich deshalb gleich lieber anders oder anderswo: Etwa 5000 Mitglieder hat die Grüne Jugend, eine Organisation wie Campact verschickt ihren Newsletter an 185 000 Abonnenten. Direkt vergleichen kann man beides nicht, aber Campact steht doch für eine neuere Form der Politisierung: Man ist so etwas wie die APO des Internetzeitalters, es gibt Online-Kampagnen, schnell und präzise lässt sich so der Protest gegen Atomstrom oder Gen-Mais mobilisieren. Die Schwelle fürs Engagement liegt nicht sehr hoch, Campact ist lokal präsent, modern in der latenten Bindungslosigkeit und bequem, ohne deshalb in Symbolpolitik zu versacken.
Und so sagt die Identitätskrise der Grünen auch etwas aus über den Zustand der Politik allgemein: Einst waren sie Avantgarde, heute sind sie wie alle. Sie sind ökologischer Mainstream und damit auf dem Weg zur grünen Volkspartei. Aber warum verhalten sie sich so defensiv? So ängstlich? So ungrün? Hat das mit den »Kampfschweinen« zu tun, die in den Diskussionsschlachten der Siebzigerjahre gestählt wurden? Den Funktionären, die diese einst basisdemokratische Partei im festen Griff halten? Die gelernt haben, ihre Siege zu genießen, weil sie wissen, wie gut es sich anfühlt, Macht zu haben und nicht zu den Verlierern zu gehören? Die sich wie Denkmäler benehmen, die auf ihren eigenen Staub stolz sind?
Oder hat es auch mit der etwas antriebsschwachen Riege der 30- bis 40-Jährigen zu tun, die nicht von Visionen geplagt werden, dafür von der generationstypischen Beißhemmung? Denen vieles leichter gefallen
ist, die deshalb nie einen wirklichen Machtinstinkt erworben haben, die lieber ein guter Vater sein wollen als ein guter Vatermörder? Wie will man mit solchen Angestellten eine Revolution machen? Oder wenigstens auf dem Parteitag einen kontroversen Antrag durchboxen?
Robert Habeck ist jemand aus dieser Generation und er sieht das durchaus selbstkritisch. »Ein gewisses Wabern ist zu spüren«, sagt er über Rostock und die Ratlosigkeit in der Partei und zählt lauter Fragen auf, über die sich die Partei bis zur Bundestagswahl 2013 definieren könnte. Das Thema Grundeinkommen oder Grundversorgung etwa, ein Konzept, das mit Hartz IV bricht, aber auch mit dem Denken der Gewerkschaften. Ein grünes Steuerkonzept. Oder ein großes Umverteilungsprogramm, das sich nicht im klassischen »Wir geben es den Armen« beschränkt. Wie definieren die Grünen einen neuen Wirtschaftsbegriff? Was ist die grüne Staatsvorstellung? »Wir haben Angst vor der eigenen Courage«, sagt Habeck. »Wir leiden immer noch unter dem rot-grünen Blues.«
Woher also soll die Erneuerung kommen? Jemand wie Habeck ist dabei Teil der Lösung und Teil des Problems. Er sieht aus wie der Jamie Oliver der Grünen, er hat in Schleswig-Holstein einen selbstbewussten Wahlkampf geführt, war offen für alle Koalitionen und wurde dafür mit dem bisher besten Ergebnis in diesem Bundesland belohnt. Er hätte sich um den Parteivorstand bewerben können, entschied sich aber fürs Familienleben mit den vier Söhnen auf dem Land, an der dänischen Grenze. Er ist 40 Jahre alt und fragt sich selbst, warum sich seine Generation so schwer tut mit dem Karrieremachen, diese Generation, die die Politik der nächsten 15, 20 Jahre dominieren und definieren wird, irgendwie randlos und konturenschwach, wie ihre Kollegen von der CDU-Pizza-Connection.
»Das kann man ja auch positiv interpretieren«, sagt Habeck, »es gibt da eine kommunikative Offenheit, nicht mehr die Kultur
der alten Männer, der breiten Schultern und des breiten Lachens.« Von »Grundzweifeln« spricht Habeck und von »Grundenttäuschungen«, man ist eben ein Kind der Zeit, in der man groß geworden ist. »Der Idealismus war die Grundmelodie der Siebzigerjahre, dieses Gefühl, aus eigener Kraft an die Spitze zu kommen, weil man ja der Beste ist. Unser Problem ist es, aus dem mangelnden Glauben, dass Ideale die Welt verändern können, etwas Gutes entstehen zu lassen«, sagt Habeck. Oder: »Aus der Melancholie soll Idealismus wachsen.«
Soll. Oder muss? In München sitzt Dieter Janecek, 33, der Landesvorsitzende der bayerischen Grünen, und sagt: »Wir sind mehr
als links.« Und: »Früher ging es um die Frage: Wollen wir regieren? Heute geht es um die Frage: Wie wollen wir regieren?« Janecek ist offen für Schwarz-Grün, aber das ist nicht entscheidend. So wenig wie für Gerhard
Förster, der in einem engen Büro in Lüchow sitzt, wo er für die Bürgerinitiative arbeitet, grünes Kernland also, der letzte Zipfel der alten BRD, Atom-Country. Bis Rot-Grün an die Macht kam, war die Wut, war der Protest groß. Danach kamen nur noch 5000 Leute aus dem Landkreis, um zu demonstrieren. Letztes Jahr kamen schon wieder 16 000. Grüne Erneuerung also von den Wurzeln her? Beim Wort Gorleben jedenfalls leuchten die Augen Gesine Agenas von der Grünen Jugend. »Dieses Gefühl, dass wir eine Bewegung sind«, sagt sie, »zu wissen, wo der Gegner steht.
«Ist die Zukunft der Grünen also ihre eigene Vergangenheit? Die Besteuerung des internationalen Bankverkehrs, die jemand wie Ludger Volmer in den Achtzigerjahren forderte, ist heute Konsens zwischen CDU und Gordon Brown. Postmaterialistisch klingt fast wie Wellnesshotel. Und die strukturelle Krise der Parteiendemokratie hat auch die Grünen erfasst. Woran will man sich also wärmen? In Rostock hatten sie das grüne Kuschelthema Atomkraft ans Ende des ersten Tages gesetzt, eine seltsam leuchtende Erinnerung, die nostalgische Protestsonne, die heute wieder von so vielen Aufklebern grinst. Es war das reine Kalkül. Die Grünen sind zerrissen zwischen der eigenen Folklore und der Realität einer ganz normalen Funktionärspartei.
---
Ludger Volmer, Mitbegründer der Grünen, hat ein Buch geschrieben: Die Grünen. Von der Protestbewegung zur etablierten Partei erscheint am
8. Dezember. Außerdem empfiehlt Georg Diez zwei Grünen-Videos auf Youtube aus dem Jahr 1980: "1980: Grüne zur Bundestagswahl" oder "Gründungsparteitag DIE GRÜNEN 13.1.1980 Karlsruhe" – wirklich spektakulär.
Illustration: Dirk Schmidt
